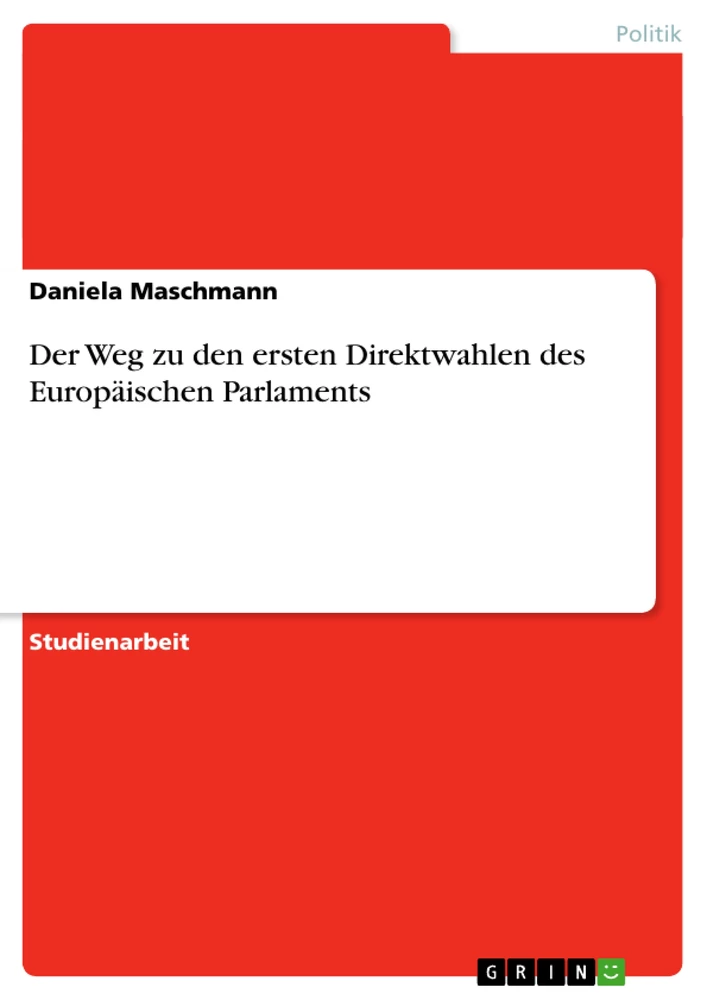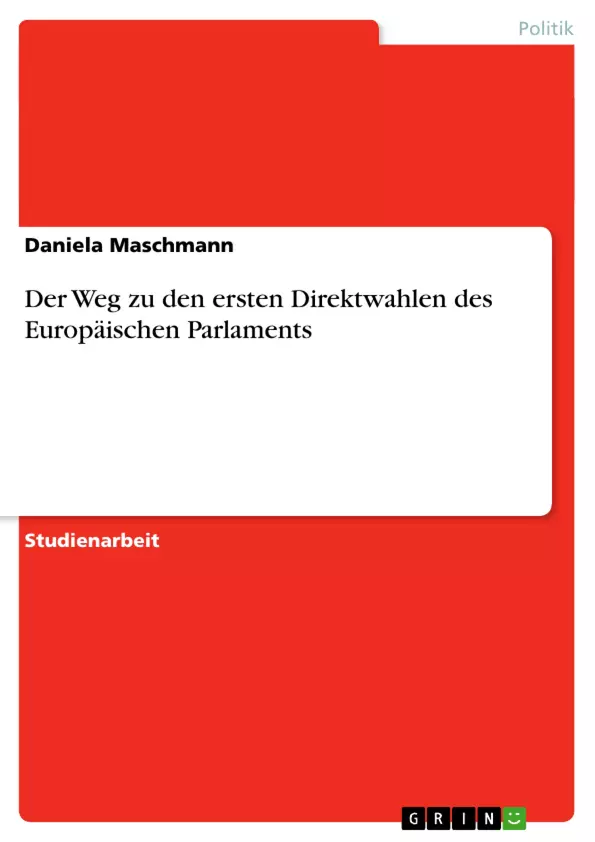Es handelt sich um die Darstellung bzw. Untersuchung der ‚Entstehung‘ der ersten Direktwahlen zum Euro-päischen Parlament. Wie kam es eigentlich dazu? Gab es Probleme bei der Durchsetzung bzw. Verwirklichung der Wahlen? Und wie gingen sie tatsächlich aus?
Dies sollen die zentralen Fragen sein, mit denen ich mich in dieser Arbeit befasse. Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf der Entwicklung zu den ersten Direktwahlen. Von den anfänglichen Verzögerungen über die Probleme des Einführungsaktes bis hin zu den Schwie-rigkeiten bei der tatsächlichen Durchführung bietet dieses Thema eine Fülle von unterschied-lichen Ansatzpunkten, die aufzeigen können, daß der Weg zu den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament keines falls ein leichter oder kurzer war. Ich möchte in dieser Arbeit die angesprochenen Schwierigkeiten und Probleme chronologisch aufarbeiten und dabei ver-suchen, ein klares Bild über die gesamte Entwicklung zu geben. Natürlich können dabei nicht alle Aspekte ausführlich behandelt werden, doch ich versuche, alle für die Entwicklung wich-tigen Ereignisse und Geschehnisse zu erwähnen.
Um in den Themenkomplex einzuführen, stelle ich eine kurze Zusammenfassung über die eigentliche Entstehung des Europäischen Parlamentes mit der Entwicklung seiner Kompeten-zen bis zur ersten Direktwahl von 1979 voran. Dies erscheint mir wichtig, da hierdurch die eigentliche Stellung des Europäischen Parlaments deutlich wird und ich gleichzeitig innerhalb dieser Arbeit auch aufzeigen kann, wie groß im Grunde das Kompetenzdefizit bis 1979 noch ist und vor allem, in welch langsamen Schritten die Kompetenzen teilweise erweitert werden und Modernisierungen in Kraft treten. Die Direktwahlen als direktes Beispiel genommen.
Im Hauptteil werde ich dann chronologisch auf die Geschehnisse bis hin zur ersten Direkt-wahl vom 7. – 10. Juni 1979 eingehen. In diesem Kontext wird außerdem kurz auf den Wahl-kampf eingegangen, wobei eine ausführliche Behandlung, zum Beispiel der einzelnen Wahl-programme der betroffenen Parteien, jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Im letzten Teil der Arbeit folgt abschließend noch eine kleine Übersicht über die Durchfüh-rung, die Wahlbeteiligung und die Ergebnisse der Direktwahl 1979, wodurch ich jedoch das Thema eher abrunden als kritisch darstellen möchte, um in den Grenzen des Themas, der ‚Vorgeschichte’ zu den Wahlen, zu bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der Aufgaben und Kompetenzen des Europäischen Parlaments bis zur ersten Direktwahl
- Die Entstehung des Europäischen Parlaments
- Kompetenzen- und Befugniserweiterung
- Legislative (Beratungsbefugnis)
- Haushalt
- Kontrollfunktion
- Der lange Weg zu den ersten Direktwahlen
- Entwicklung von den Gründungsverträgen bis zum Beschluß und Einführungsakt vom 20. Sept. 1976
- Die Verzögerungstaktik
- Der Wandel zur Initiative
- Die Erwartungen und Befürchtungen
- Der Einführungsakt vom 20. Sept. 1976
- Das Problem Wahltermin und Wahlverfahren
- Entwicklung von den Gründungsverträgen bis zum Beschluß und Einführungsakt vom 20. Sept. 1976
- Der Wahlkampf
- Die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament
- Die Durchführung
- Die Wahlbeteiligung
- Die Ergebnisse der Wahl
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Sie beleuchtet die Entwicklungsschritte, die zur Einführung der Direktwahlen führten, und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der chronologischen Darstellung der Entwicklung, um ein klares Bild der vielseitigen Prozesse zu liefern.
- Die Entwicklung des Europäischen Parlaments und seiner Kompetenzen bis zur ersten Direktwahl
- Der Weg zu den ersten Direktwahlen, einschließlich der Verzögerungen und Herausforderungen
- Die Erwartungen und Befürchtungen im Zusammenhang mit der Einführung von Direktwahlen
- Die Durchführung, Wahlbeteiligung und Ergebnisse der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das zentrale Thema der Arbeit vor, die Entstehung der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament. Sie skizziert die wichtigsten Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden. Dabei wird der Fokus auf die Entwicklung zu den ersten Direktwahlen gelegt, von den anfänglichen Verzögerungen bis hin zu den Schwierigkeiten bei der Durchführung. Die Einleitung betont die Bedeutung einer chronologischen Darstellung, um ein klares Bild der Entwicklung zu vermitteln.
- Die Entwicklung der Aufgaben und Kompetenzen des Europäischen Parlaments bis zur ersten Direktwahl: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Europäischen Parlaments und die Entwicklung seiner Kompetenzen bis zur ersten Direktwahl von 1979. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Stellung des Europäischen Parlaments und der Entwicklung seines Kompetenzdefizits bis 1979. Das Kapitel zeigt auf, wie langsam die Kompetenzen erweitert wurden und Modernisierungen in Kraft traten, wobei die Direktwahlen als Beispiel für diese Prozesse dienen.
- Der lange Weg zu den ersten Direktwahlen: Dieses Kapitel behandelt chronologisch die Geschehnisse, die zur ersten Direktwahl vom 7. – 10. Juni 1979 führten. Es befasst sich mit den Entwicklungen von den Gründungsverträgen bis zum Einführungsakt vom 20. September 1976, inklusive der Verzögerungstaktik und des Wandels zur Initiative. Weiterhin behandelt das Kapitel die Erwartungen und Befürchtungen im Zusammenhang mit der Einführung von Direktwahlen, den Einführungsakt selbst und die Herausforderungen beim Wahltermin und Wahlverfahren.
- Der Wahlkampf: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Einblick in den Wahlkampf zur ersten Direktwahl, ohne jedoch eine detaillierte Analyse der einzelnen Wahlprogramme zu liefern.
- Die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament: Dieses Kapitel fasst die Durchführung, Wahlbeteiligung und Ergebnisse der Direktwahl 1979 zusammen, ohne jedoch eine kritische Betrachtung vorzunehmen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Fakten, um den Rahmen des Themas „Vorgeschichte“ zu den Wahlen nicht zu verlassen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe und Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind: Europäisches Parlament, Direktwahl, Kompetenzentwicklung, Verzögerungstaktik, Einführungsakt, Wahlkampf, Wahlbeteiligung, Wahlresultat, Integrationsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Wann fanden die ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament statt?
Die ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament wurden vom 7. bis zum 10. Juni 1979 durchgeführt.
Warum dauerte der Weg zu den Direktwahlen so lange?
Der Prozess war durch Verzögerungstaktiken der Mitgliedstaaten, Unstimmigkeiten über den Wahltermin und Schwierigkeiten bei der Festlegung eines einheitlichen Wahlverfahrens geprägt.
Was war der Einführungsakt vom 20. September 1976?
Der Einführungsakt war der entscheidende rechtliche Beschluss, der den Weg für die allgemeine und unmittelbare Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments ebnete.
Wie entwickelten sich die Kompetenzen des Parlaments bis 1979?
Die Befugnisse in den Bereichen Gesetzgebung (Beratung), Haushalt und Kontrolle wurden nur in sehr langsamen Schritten erweitert, was bis 1979 zu einem deutlichen Kompetenzdefizit führte.
Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der ersten Wahl 1979?
Die Arbeit dokumentiert die Fakten zur Wahlbeteiligung und den Ergebnissen als Abschluss der historischen Untersuchung der Vorgeschichte.
- Citation du texte
- M.A. Daniela Maschmann (Auteur), 2000, Der Weg zu den ersten Direktwahlen des Europäischen Parlaments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12805