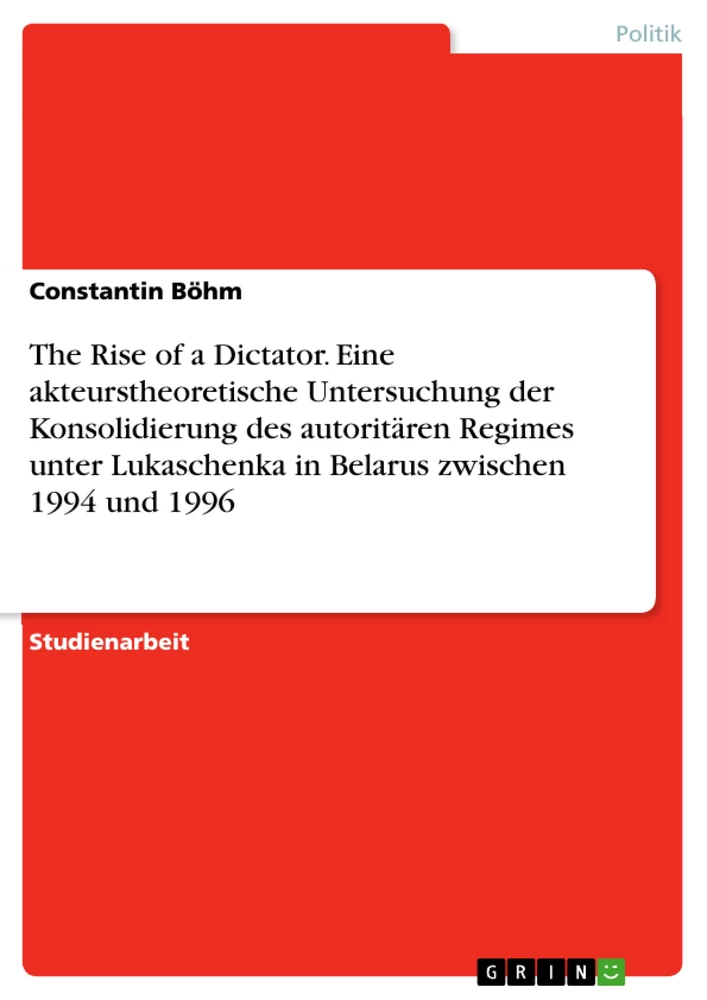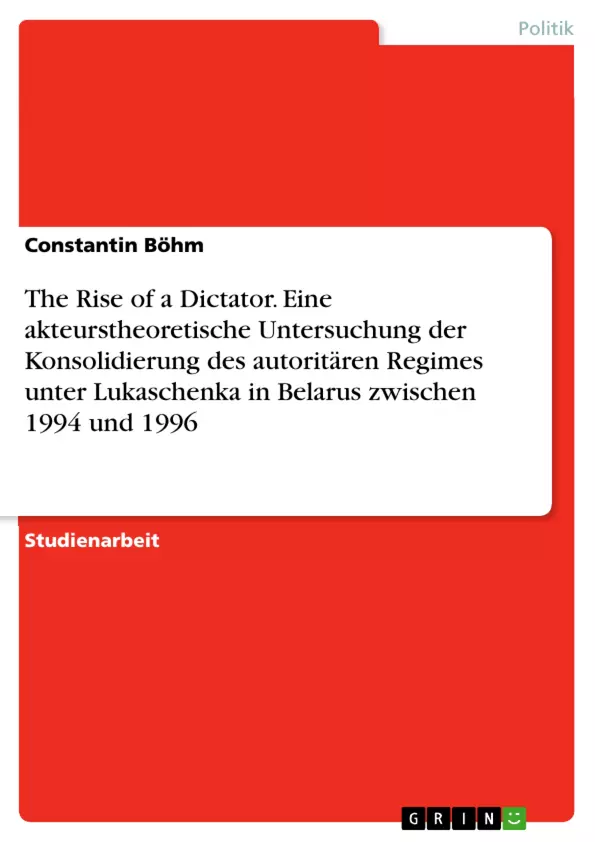Während sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den ehemaligen Satellitenstaaten weitgehend stabile Demokratien konsolidierten, widersetzte sich Lukaschenka der dritten Demokratisierungswelle und etablierte nach 1994 ein autoritäres Regime in Belarus, welches häufig als die "letzte Diktatur Europas" bezeichnet wird. Die vorliegende Arbeit wird deshalb auf die frühen Jahre der Regentschaft Lukaschenkas blicken und der Frage nachgehen, warum es Aljaksandr Lukaschenka zwischen 1994 und 1996 möglich war, ein autoritäres Regime in Belarus zu etablieren.
Die Beantwortung dieser Fragestellung geschieht im Rahmen der empirisch-deskriptiven Strömung der Akteurstheorie nach Guillermo O ́Donnell und Philippe C. Schmitter. Nachdem diese dargelegt wurde, geht die Arbeit zum Empirieteil über, in dem verschiedene Vorgehensweisen Lukaschenkas analysiert werden, in deren Rahmen der Machthaber unter- schiedliche Akteurskonstellationen beeinflusste. Abschließend wird ein Resümee gezogen, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Eignung der oben genannten Theorie für die spezifische Fragestellung bewertet. Vorweg sei jedoch auf den lückenhaften Forschungsstand hingewiesen. Der von den Akteurstheorien auf Akteure und Interessengruppen gelegte Fokus bei der Ursachensuche hinter dem Autoritarismus spielt, in der für diese Arbeit vorliegenden Literatur, keine oder nur eine marginale Rolle. Vielmehr wird in der Sekundärliteratur das Akteursverhalten während der Transition lediglich in rein deskriptiver Art und Weise untersucht.
Im Folgenden werden deshalb die Erkenntnisse aus der Sekundärliteratur in den akteurstheoretischen Rahmen gesetzt. Eine Herausforderung wird es dabei sein, aus der neueren Literatur des 21. Jahrhunderts die essenziellen Informationen für den vergleichsweise kurzen Zeitraum zwischen 1994 und 1996 herauszufiltern und in den richtigen Kontext zu setzen. Exemplarisch sei in diesem Sinne die 2019 erschienene Monographie "Belarus under Lukashenka. Adaptive Authoritarianism" von Matthew Frear zu erwähnen, welche einen tiefgreifenden Einblick in die Akteurskonstellationen ermöglicht und mitunter die Grundlage für die empirische Analyse dieser Arbeit bildet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Akteurstheorie und Begriffsdefinitionen
- 2.1 Deskriptiv-empirische Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter
- 3. Eine akteurstheoretische Untersuchung der Transition in Belarus von 1994-1996
- 3.1 Vorbedingungen für den Autoritarismus unter Lukaschenka
- 3.2 Ein durch persönliche Beziehungen und Dependenzen geprägtes Netzwerk
- 3.3 Rent-seeking
- 3.4 Kooptation drei verschiedener Akteursgruppierungen und Elitenrotation
- 3.5 Siloviki
- 3.6 Die Masse als Akteur
- 3.7 Der konsolidierte Autoritarismus
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konsolidierung des autoritären Regimes unter Alexander Lukaschenko in Belarus zwischen 1994 und 1996. Sie analysiert, wie Lukaschenko es schaffte, ein autoritäres Regime zu etablieren, während sich in anderen post-sowjetischen Staaten Demokratien entwickelten. Die Analyse basiert auf der deskriptiv-empirischen Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter.
- Die Anwendung der Akteurstheorie auf den belarussischen Kontext.
- Analyse der Strategien Lukaschenkas zur Machtkonsolidierung.
- Die Rolle verschiedener Akteursgruppen (Eliten, Bevölkerung, Sicherheitskräfte).
- Die Bedeutung von Netzwerken, persönlichen Beziehungen und Ressourcenkontrolle.
- Der Übergang von einer Übergangszeit zu einem konsolidierten Autoritarismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Etablierung des autoritären Regimes unter Lukaschenko in Belarus zwischen 1994 und 1996. Sie kontextualisiert Belarus im Vergleich zu anderen post-sowjetischen Staaten und benennt die Forschungslücke hinsichtlich akteurstheoretischer Analysen dieser Entwicklung. Die Arbeit kündigt den methodischen Ansatz an, der auf der empirisch-deskriptiven Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter basiert, und verweist auf die Herausforderungen bei der Auswahl und Interpretation relevanter Literatur für den spezifischen Zeitraum.
2. Akteurstheorie und Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Transition und Transformation und erläutert den Unterschied zwischen den Definitionen von O'Donnell/Schmitter und anderen Autoren. Es hebt die Akteurstheorien von anderen Erklärungsansätzen ab und betont den Fokus auf das Handeln von Akteuren, insbesondere Eliten, innerhalb eines dynamischen, sich verändernden strukturellen Rahmens. Die Wahl der empirisch-deskriptiven Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter wird begründet und der Fokus auf wechselnde Akteurskonstellationen und deren Strategien während der Transitionsphase hervorgehoben.
2.1 Deskriptiv-empirische Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die deskriptiv-empirische Akteurstheorie, die den theoretischen Rahmen der Arbeit bildet. Der Fokus liegt auf der Analyse der wechselnden Akteurskonstellationen während der Transitionsphasen. Die Unterscheidung zwischen Hardlinern und Softlinern innerhalb der Herrschaftsstrukturen und die Rolle der mobilisierten Bevölkerungsmassen werden erklärt.
Schlüsselwörter
Belarus, Lukaschenko, Autoritarismus, Transition, Transformation, Akteurstheorie, O'Donnell & Schmitter, Eliten, Netzwerke, Kooptation, Siloviki, Rent-seeking.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Akteurstheoretische Untersuchung der Transition in Belarus 1994-1996
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konsolidierung des autoritären Regimes unter Alexander Lukaschenko in Belarus zwischen 1994 und 1996. Sie analysiert, wie Lukaschenko trotz der Entwicklung von Demokratien in anderen post-sowjetischen Staaten ein autoritäres Regime etablieren konnte.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Analyse basiert auf der deskriptiv-empirischen Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter. Diese Theorie fokussiert auf das Handeln von Akteuren (insbesondere Eliten) innerhalb eines dynamischen, sich verändernden strukturellen Rahmens.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendung der Akteurstheorie auf den belarussischen Kontext, die Strategien Lukaschenkas zur Machtkonsolidierung, die Rolle verschiedener Akteursgruppen (Eliten, Bevölkerung, Sicherheitskräfte), die Bedeutung von Netzwerken und persönlichen Beziehungen, die Ressourcenkontrolle und den Übergang von einer Übergangszeit zu einem konsolidierten Autoritarismus.
Welche Akteursgruppen werden analysiert?
Die Analyse betrachtet verschiedene Akteursgruppen, darunter Eliten, die Bevölkerung und die Sicherheitskräfte (Siloviki). Besondere Aufmerksamkeit wird den wechselnden Akteurskonstellationen und ihren Strategien während der Transitionsphase gewidmet.
Welche Rolle spielen Netzwerke und persönliche Beziehungen?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Netzwerken, persönlichen Beziehungen und der Kontrolle von Ressourcen für die Machtkonsolidierung Lukaschenkas. Es wird analysiert, wie diese Faktoren zum Aufbau und zur Stabilisierung des autoritären Regimes beigetragen haben.
Wie wird der Übergang zum konsolidierten Autoritarismus erklärt?
Die Arbeit beschreibt den Prozess des Übergangs von einer Übergangszeit zu einem konsolidierten Autoritarismus unter Lukaschenko. Dabei werden die Strategien und Handlungen der verschiedenen Akteursgruppen analysiert, die zu diesem Übergang geführt haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Akteurstheorie und Begriffsdefinitionen (inklusive einer detaillierten Beschreibung der deskriptiv-empirischen Akteurstheorie nach O'Donnell und Schmitter), ein Kapitel zur akteurstheoretischen Untersuchung der Transition in Belarus (mit Unterkapiteln zu Vorbedingungen, Netzwerken, Rent-seeking, Kooptation, Siloviki, der Masse als Akteur und dem konsolidierten Autoritarismus) und ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Belarus, Lukaschenko, Autoritarismus, Transition, Transformation, Akteurstheorie, O'Donnell & Schmitter, Eliten, Netzwerke, Kooptation, Siloviki, Rent-seeking.
Was ist die Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie konnte Alexander Lukaschenko zwischen 1994 und 1996 ein autoritäres Regime in Belarus etablieren, während sich in anderen post-sowjetischen Staaten Demokratien entwickelten?
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen bei der Auswahl und Interpretation relevanter Literatur für den spezifischen Zeitraum und die Anwendung der Akteurstheorie auf den belarussischen Kontext.
- Citation du texte
- Constantin Böhm (Auteur), 2022, The Rise of a Dictator. Eine akteurstheoretische Untersuchung der Konsolidierung des autoritären Regimes unter Lukaschenka in Belarus zwischen 1994 und 1996, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280555