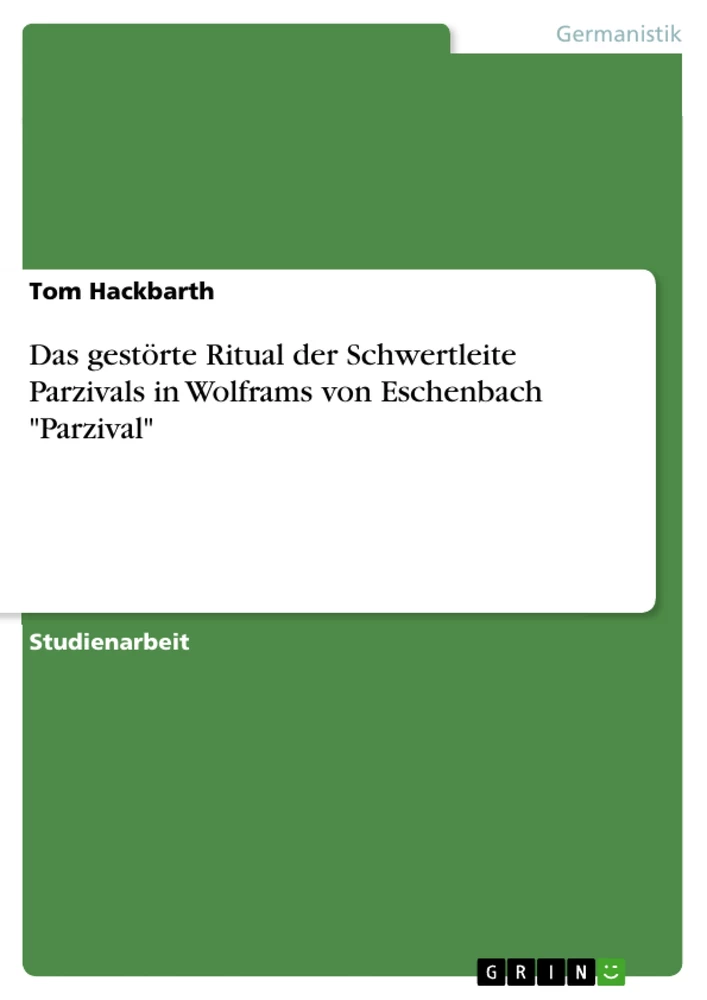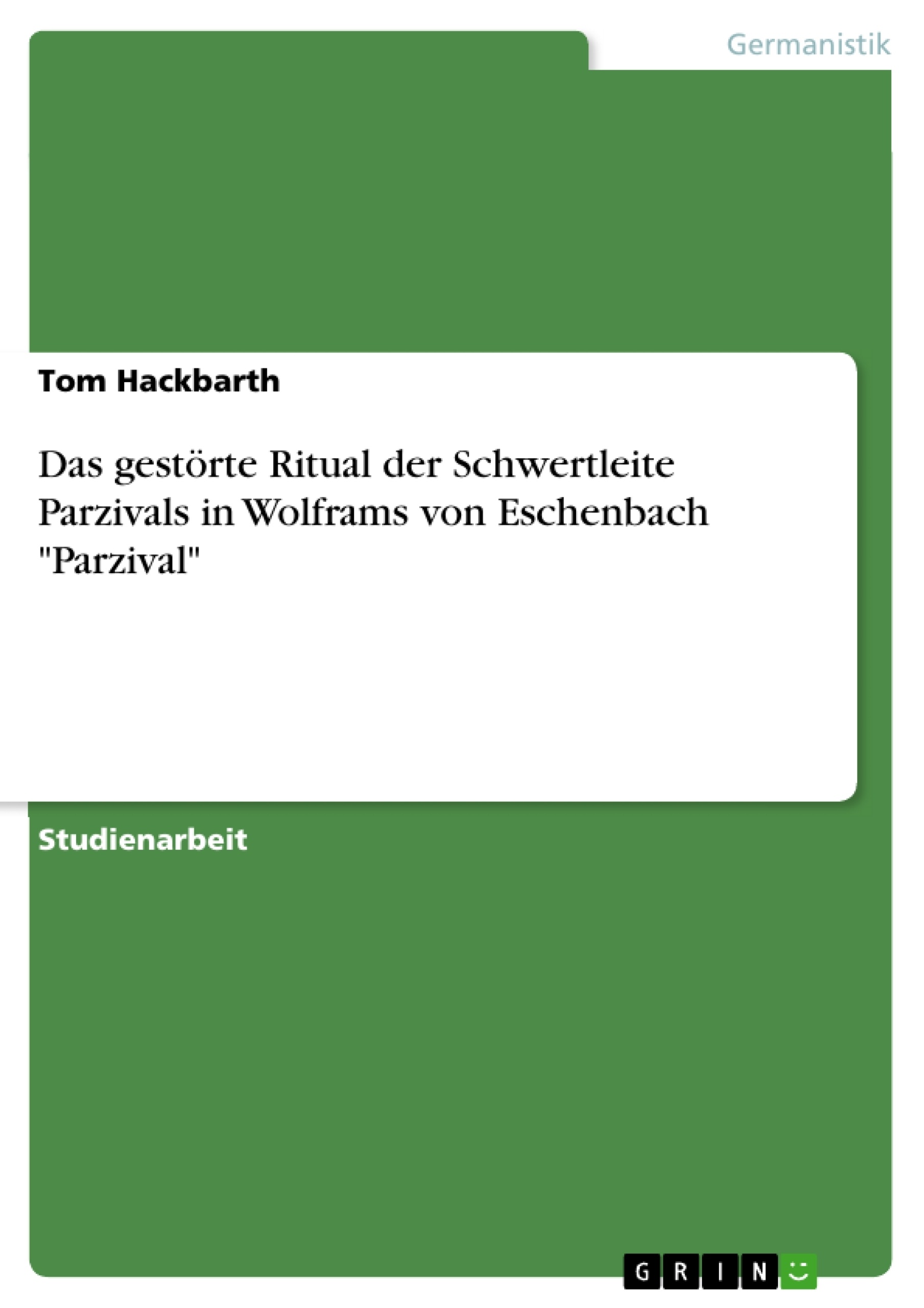Die Bedeutung von Ritualen für das soziale Miteinander von Menschen spiegelt sich häufig auch an zentralen Stellen literarischer Texte wider – dann aber auffällig oft als nicht normkonformes Ritual. Die Grundzüge der ursprünglichen Ritualhandlung sind zwar noch erkennbar, sie weichen aber so weit vom Prototyp ab, dass von einem gestörten oder gefährdeten Ritual gesprochen werden muss. Doch weshalb lassen sich in mittelhochdeutscher Literatur auffällig häufig gestörte Rituale finden und welche Bedeutung haben sie für die Texte, in denen sie sich zeigen? Um diese Frage zu beantworten, wird die vorliegende Untersuchung diesen Typus von Ritualen exemplarisch in Wolframs von Eschenbach Parzival betrachten. Hierbei steht die Untersuchung ihrer Rolle für den Gesamttext im Fokus.
Der Versroman Wolframs beinhaltet verschiedene ritualisierte Handlungen – darunter das Gralsritual, das Speiseritual oder auch das Frageritual. Als Untersuchungsgegenstand für diese Arbeit soll Parzivals Schwertleite als Ritual der Ritterpromotion dienen, da diese Textstelle den Anschein erweckt, besonders musterhaft ein von der Norm abweichendes Ritual abzubilden.
Der Fokus dieser Arbeit wird daher auf der Frage liegen, inwiefern das Ritual von Wolfram in gestörter Form, also vom Prototyp abweichend, entwickelt wird und welche Bedeutung dies für die Handlung hat.
Nach einem historisch-theoretischen Überblick über den Ablauf und die Bedeutung der Schwertleite im Mittelalter wird dieses Ritual in die Ritualtheorie Stollberg-Rilingers eingeordnet. Diese erlaubt mit ihren Einzelkriterien eine differenzierte Untersuchung des Rituals. Anschließend erfolgt eine Szenenanalyse der Schwertleite Parzivals im Rahmen des Ither-Kampfes, woraufhin die Frage nach dem gestörten Ritual erneut aufgegriffen und mit dem historischen Kontext und den Ritualkategorien Stollberg-Rilingers abgeglichen wird. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die Ergebnisse resümiert und einen Ausblick auf weitere Forschungsansätze bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eine historische und ritualtheoretische Betrachtung der Schwertleite im Mittelalter
- 2.1 Ablauf und Bedeutung der Schwertleite
- 2.2 Einordnung der Schwertleite in die Ritualtheorie Stollberg-Rilingers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Schwertleite als gestörtes Ritual in Wolframs von Eschenbachs Parzival. Ziel ist es, die Rolle dieses Rituals für den Gesamttext zu beleuchten und die Gründe für Wolframs abweichende Darstellung zu erforschen.
- Das gestörte Ritual der Schwertleite im Parzival
- Die historische Entwicklung und Bedeutung der Schwertleite im Mittelalter
- Die Anwendung der Ritualtheorie von Stollberg-Rilinger auf die Schwertleite
- Die Rolle des Rituals in der Handlung des Parzival
- Wolframs Interpretation und Adaption des mittelalterlichen Rituals
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung des gestörten Rituals der Schwertleite im Parzival. Kapitel 2 liefert einen historischen und theoretischen Überblick über die Schwertleite im Mittelalter, beschreibt ihren Ablauf, ihre Bedeutung und ordnet sie in die Ritualtheorie von Stollberg-Rilinger ein.
Schlüsselwörter
Schwertleite, Ritual, Mittelalter, Ritterpromotion, Wolfram von Eschenbach, Parzival, Stollberg-Rilinger, Gestörtes Ritual, Normkonformität, Handlungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „gestörtes Ritual“ in der Literatur?
Ein gestörtes Ritual ist eine Handlung, deren Grundzüge zwar erkennbar sind, die aber so stark von der Norm abweicht, dass sie ihre ursprüngliche soziale Funktion nicht voll erfüllt.
Warum ist Parzivals Schwertleite im Werk Wolframs von Eschenbach gestört?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Ritterpromotion Parzivals im Kontext des Ither-Kampfes vom ritterlichen Prototyp abweicht und welche Bedeutung dies für die Handlung hat.
Welche Ritualtheorie wird zur Analyse herangezogen?
Die Untersuchung basiert auf der Ritualtheorie von Stollberg-Rilinger, die differenzierte Kriterien zur Bewertung von Ritualen bietet.
Was bedeutete die Schwertleite historisch im Mittelalter?
Die Schwertleite war das zentrale Initiationsritual der Ritterpromotion, durch das ein junger Mann offiziell in den Ritterstand erhoben wurde.
Welche anderen Rituale kommen im „Parzival“ vor?
Neben der Schwertleite spielen das Gralsritual, das Speiseritual und das berühmte Frageritual eine zentrale Rolle im Versroman.
- Quote paper
- Tom Hackbarth (Author), 2022, Das gestörte Ritual der Schwertleite Parzivals in Wolframs von Eschenbach "Parzival", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1280737