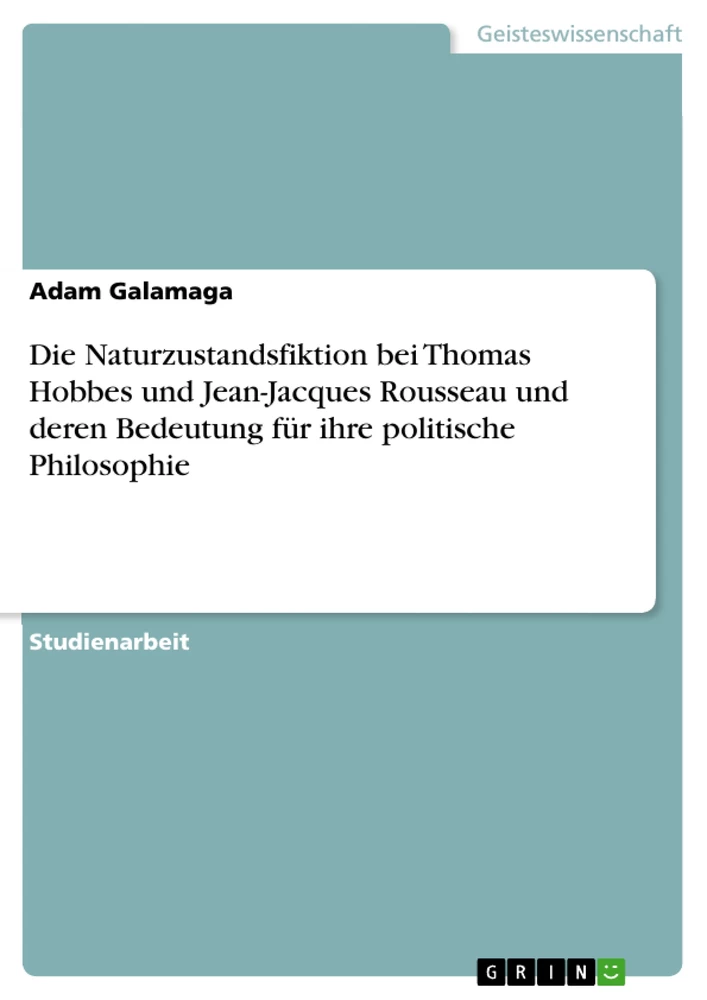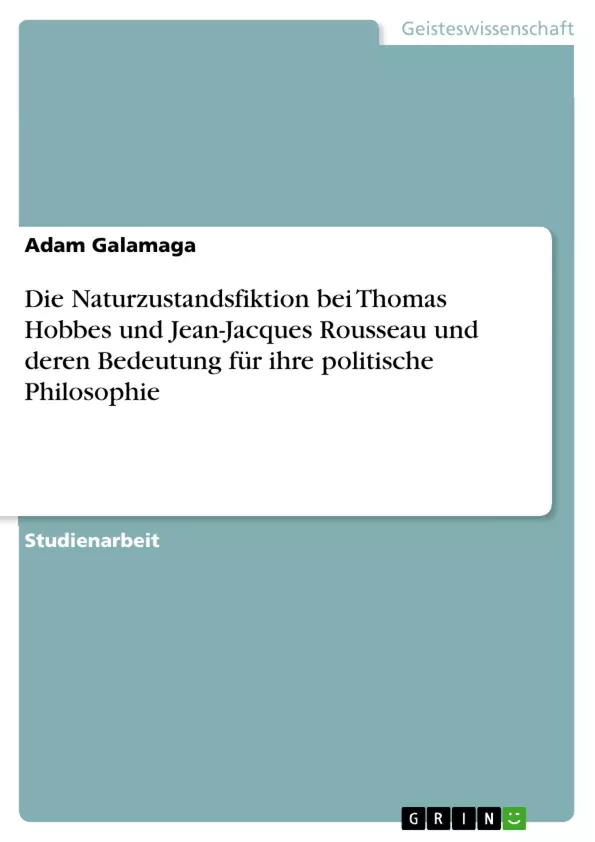Die Theorie des Gesellschaftsvertrages wird manchmal als Friedenswissenschaft bezeichnet, denn sie hat vor allem zum Ziel, die Bedingungen für die Sicherung beständigen Friedens zu bestimmen. Die Kontraktualisten behaupten, der Mensch sei kein zoon politikon; vielmehr könnte die Vergesellschaftung der Menschen erst durch souveräne Macht (Staat) erreicht werden. Die Annahme, dass die Menschen nur künstlich in die Gesellschaft integriert werden können, stellt den Ausgangspunkt für den Gesellschaftsvertrag dar.
Die politische Macht, die Einrichtungen des Staates und die Souveränität des Herrschers werden dadurch legitimiert, dass der Übergang vom Naturzustand in den gesellschaftlichen Zustand für jeden Einzelnen profitabel bzw. vernünftig ist. Damit der gesellschaftliche Zustand möglich ist, müssen die Menschen von der Notwendigkeit, in diesen einzutreten, überzeugt sein. Formal gesehen ergibt sich der gesellschaftliche Zustand aus dem Gesellschaftsvertrag. Die beiden Philosophen liefern zahlreiche Argumente dafür, warum es vorteilhaft sein sollte ihn zu schließen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Die Frage nach der Herrschaftslegitimation
- II. Theorie des Gesellschaftsvertrages
- II.I. Allgemeine Struktur des Gesellschaftsvertrages
- II.II. Die Konzeption Hobbes'
- II.III. Die Konzeption Rousseaus
- III. Naturzustandstheorie
- III.I. Die Beschreibung des Naturzustands bei Hobbes
- III.II. Die Beschreibung des Naturzustands bei Rousseau
- III.III. Philosophische Anthropologie
- III.IV. Das Hobbessche Menschenbild
- III.V. Das Rousseausche Menschenbild
- IV. Plausibilität der Naturzustandskonzeptionen
- IV.I. Kritik des homo homini lupus
- IV.II. Kritik des bon sauvage
- V. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gesellschaftsvertragstheorien von Hobbes und Rousseau und analysiert deren Konzeptionen des Naturzustands. Sie beleuchtet die anthropologischen Voraussetzungen beider Philosophen und zeigt auf, wie unterschiedliche Menschenbilder zu ähnlichen politischen Schlussfolgerungen führen können. Die Arbeit untersucht auch die Unterschiede zwischen den beiden Theorien und prüft die Plausibilität ihrer Naturzustandskonzeptionen.
- Die Theorie des Gesellschaftsvertrages bei Hobbes und Rousseau
- Der Naturzustand als Ausgangspunkt politischer Legitimation
- Vergleichende Analyse der Menschenbilder bei Hobbes und Rousseau
- Kritik der Naturzustandskonzeptionen
- Die Bedeutung der anthropologischen Voraussetzungen für die politischen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Frage nach der Herrschaftslegitimation: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Legitimation von Herrschaft und führt die Theorien von Hobbes und Rousseau als neuartige Antworten auf diese Frage ein. Sie hebt die Bedeutung des Naturzustands und der anthropologischen Voraussetzungen für die jeweiligen Gesellschaftsvertragstheorien hervor und kündigt den systematischen Vergleich und die kritische Auseinandersetzung mit den beiden Theorien an. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Naturzustandsbeschreibungen und der damit verbundenen Menschenbilder. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und deutet die zentralen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Theorien an.
II. Theorie des Gesellschaftsvertrages: Dieses Kapitel behandelt die allgemeine Struktur des Gesellschaftsvertrages als neue Variante der Herrschaftslegitimation. Es wird die Notwendigkeit einer künstlichen Vergesellschaftung der Menschen betont, die im Gegensatz zur antiken Auffassung vom Menschen als "zoon politikon" steht. Der Übergang vom Naturzustand in den gesellschaftlichen Zustand wird als für jeden Einzelnen vorteilhaft dargestellt, wobei die Notwendigkeit der Überzeugung der Individuen von diesem Übergang betont wird. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Naturzustandskonzeptionen der beiden Philosophen, die in den folgenden Kapiteln ausführlicher behandelt werden.
III. Naturzustandstheorie: Das Kapitel widmet sich der detaillierten Beschreibung des Naturzustands bei Hobbes und Rousseau. Es analysiert die jeweiligen anthropologischen Voraussetzungen, die zu unterschiedlichen Bildern des Menschen im Naturzustand führen. Bei Hobbes wird der Naturzustand als Kriegszustand aller gegen alle dargestellt, während Rousseau den Menschen im Naturzustand als weitgehend von Bedrohungen durch andere verschont beschreibt. Die unterschiedliche Auffassung vom Menschen im Naturzustand bildet die Grundlage für die unterschiedlichen Konzeptionen des Gesellschaftsvertrages und wird im weiteren Verlauf der Arbeit kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Gesellschaftsvertrag, Naturzustand, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Menschenbild, Herrschaftslegitimation, Philosophische Anthropologie, homo homini lupus, bon sauvage, Politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gesellschaftsvertragstheorien von Hobbes und Rousseau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gesellschaftsvertragstheorien von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau, mit besonderem Fokus auf deren Konzeptionen des Naturzustands und der damit verbundenen Menschenbilder. Es wird ein Vergleich der beiden Theorien vorgenommen und deren Plausibilität kritisch hinterfragt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die allgemeine Struktur des Gesellschaftsvertrages, die Beschreibung des Naturzustands bei Hobbes und Rousseau, einen Vergleich der anthropologischen Voraussetzungen beider Philosophen (ihre Menschenbilder), eine kritische Auseinandersetzung mit den Konzeptionen des Naturzustands ("homo homini lupus" und "bon sauvage") und die Bedeutung der anthropologischen Voraussetzungen für die jeweiligen politischen Theorien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage nach der Herrschaftslegitimation stellt; ein Kapitel zur allgemeinen Struktur des Gesellschaftsvertrages; ein Kapitel zur Naturzustandstheorie bei Hobbes und Rousseau mit detaillierter Analyse der Menschenbilder; ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit den Naturzustandskonzeptionen; und abschließend eine Schlussbemerkung.
Was ist der Naturzustand nach Hobbes und Rousseau?
Hobbes beschreibt den Naturzustand als einen "Kriegszustand aller gegen alle" ("homo homini lupus"), gekennzeichnet durch ständige Bedrohung und Unsicherheit. Rousseau hingegen sieht den Menschen im Naturzustand als "bon sauvage", weitgehend friedlich und von Bedrohungen durch andere verschont. Diese unterschiedlichen Auffassungen bilden die Grundlage für ihre unterschiedlichen Gesellschaftsvertragstheorien.
Wie unterscheiden sich die Menschenbilder von Hobbes und Rousseau?
Hobbes zeichnet ein pessimistisches Menschenbild, das den Menschen als von Natur aus egoistisch und machtgierig darstellt. Rousseau hingegen sieht den Menschen im Naturzustand als gut und frei, erst die Gesellschaft korrumpiert ihn. Trotz dieser unterschiedlichen Menschenbilder kommen beide zu ähnlichen Schlussfolgerungen bezüglich der Notwendigkeit eines Gesellschaftsvertrages.
Welche Kritik wird an den Naturzustandskonzeptionen geübt?
Die Arbeit hinterfragt die Plausibilität beider Naturzustandskonzeptionen. Die extreme Pessimismus von Hobbes' "homo homini lupus" und der idealisierte "bon sauvage" Rousseaus werden kritisch beleuchtet und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Gesellschaftsvertrag, Naturzustand, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Menschenbild, Herrschaftslegitimation, Philosophische Anthropologie, homo homini lupus, bon sauvage, Politische Philosophie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gesellschaftsvertragstheorien von Hobbes und Rousseau zu vergleichen und zu analysieren, die anthropologischen Grundlagen beider Theorien aufzuzeigen und die Plausibilität ihrer Naturzustandskonzeptionen zu überprüfen. Es wird gezeigt, wie unterschiedliche Menschenbilder zu ähnlichen politischen Schlussfolgerungen führen können.
- Quote paper
- Adam Galamaga (Author), 2007, Die Naturzustandsfiktion bei Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau und deren Bedeutung für ihre politische Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128079