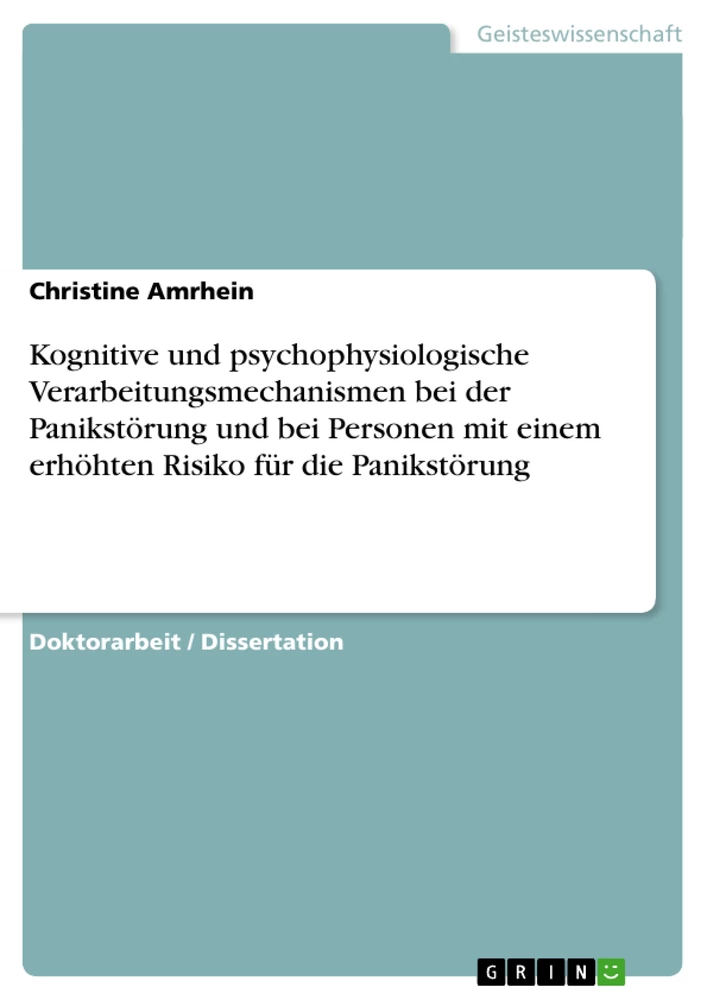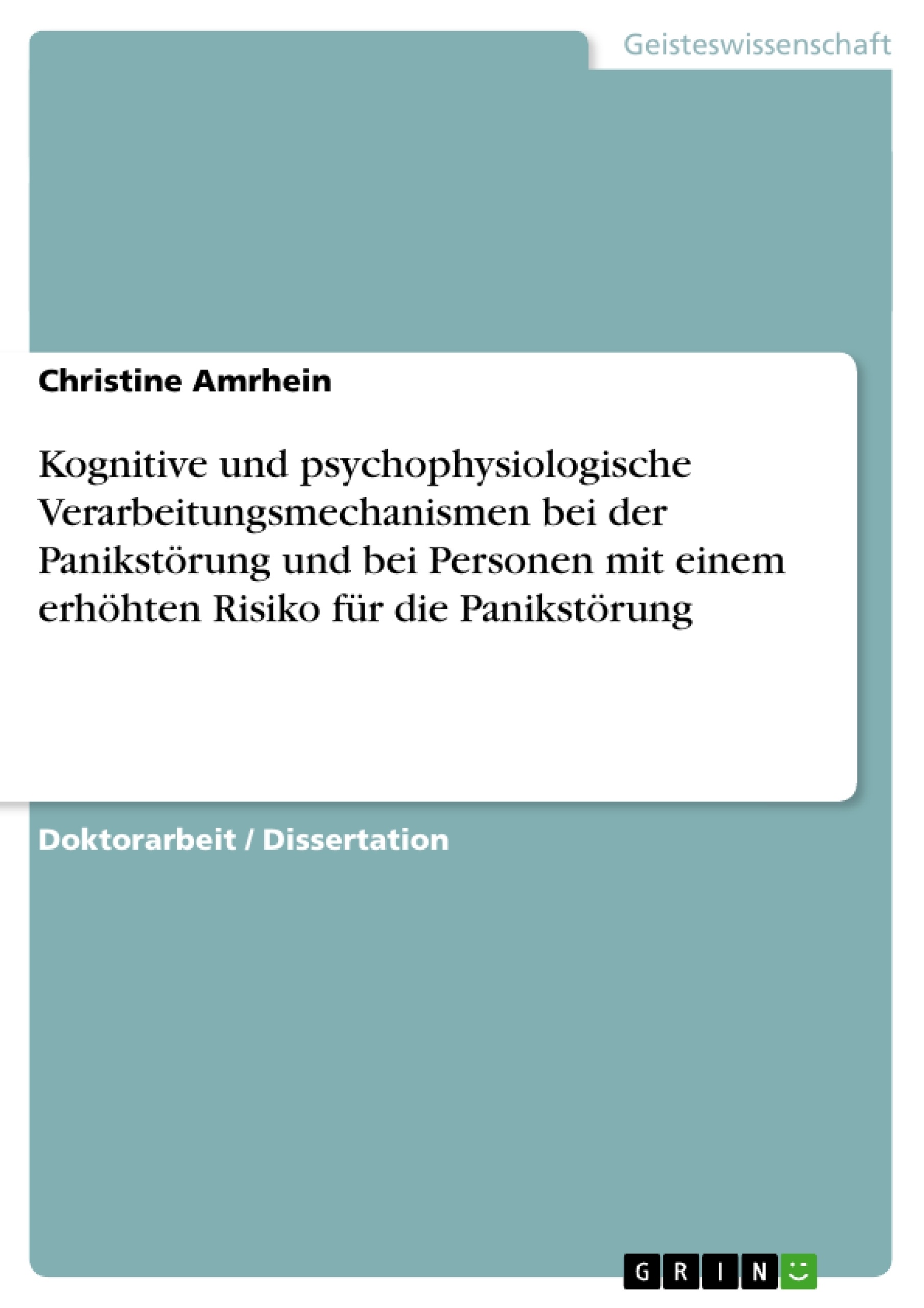The aim of the present dissertation was to examine particularities in the processing of emotional picture stimuli in panic disorder patients and risk groups for panic disorder. A pre-study with healthy participants showed that their reactions to positive, neutral and negative pictures can be differentiated on the basis of subjective ratings, electrocortical and peripheral physiological measures.
Therefore, the first study examined whether subjects at risk for panic disorder (subjects with high anxiety sensitivity (AS), and subjects with high AS and non-clinical panic attacks) differ from healthy controls with low AS in their reactions to emotional stimuli. Aside from positive, neutral and negative pictures, panic-relevant (PR) pictures were presented. Only PR pictures were rated as more negative and more arousing by both groups with high AS, compared to the control group. Subjects with non-clinical panic attacks showed an elevated SCR specifically for PR pictures. For startle reflex and EEG parameters, no differences between groups were found. The results support the idea of an altered processing of PR stimuli in both risk groups; yet, this alteration is more pronounced in subjects with non-clinical panic attacks, and more pronounced for subjective than for psychophysiological measures.
As studies have shown that anxiety disorder patients have an elevated expectancy of negative consequences after fear-relevant stimuli, this "covariation bias" was examined in a further study with panic disorder patients. PR, neutral and phobia-relevant pictures were presented, with half of the pictures of each category being followed by an unpleasant startle sound. Panic patients, as compared to controls, did not show an overestimation of the unpleasant consequence after PR pictures, but revealed a higher CNV amplitude - considered as a psychophysiological indicator of expectancy. These findings indicate that, on a psychophysiological level, panic patients show an altered processing of PR stimuli.
Taken together, the studies in this dissertation show that panic patients and individuals with an elevated risk for panic disorder react more intensely to panic-relevant stimuli than healthy controls or individuals with low AS. A direction for future studies could be to examine if these particularities can serve as predictors for the course of panic disorder, for treatment outcome, and for the onset of panic disorder in risk groups.
Inhaltsverzeichnis
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ZUSAMMENFASSUNG
- ABSTRACT
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER TEIL
- 1. DIE PANIKSTÖRUNG
- 1.1. DEFINITION UND DIAGNOSEKRITERIEN
- 1.2. EPIDEMIOLOGIE UND VERLAUF
- 1.3. NEUROBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN VON PANIKATTACKEN
- 1.4. PSYCHOPHYSIOLOGISCHE BESONDERHEITEN DER PANIKSTÖRUNG
- 2. PSYCHOPHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1. EVOZIERTE POTENTIALE
- 2.1.1. P3 UND POSITIVE SLOW WAVE (PSW)
- 2.1.2. CONTINGENT NEGATIVE VARIATION (CNV)
- 2.2. STARTLE-REFLEX
- 2.3. HAUTLEITFÄHIGKEIT
- 3. EMOTIONSTHEORIEN
- 3.1. ÜBERSICHT
- 3.2. DIE EMOTIONSTHEORIE VON LANG
- 3.2.1. GRUNDLAGEN
- 3.2.2. METHODIK
- 3.2.3. BEFUNDE ZUR EMOTIONALEN BILDBETRACHTUNG BEI GESUNDEN PERSONEN
- 3.2.4. BEFUNDE ZUR VERARBEITUNG EMOTIONALER REIZE BEI HOCHÄNGSTLICHEN PERSONEN UND PERSONEN MIT ANGSTSTÖRUNGEN
- 4. THEORIEN ZUR ENTSTEHUNG DER PANIKSTÖRUNG
- 4.1. KONDITIONIERUNGSTHEORIEN
- 4.1.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 4.1.2. BEFUNDE ZUR DEN KONDITIONIERUNGSTHEORIEN
- 4.2. KOGNITIVE THEORIEN
- 4.2.1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 4.2.2. BEFUNDE ZU DEN KOGNITIVEN THEORIEN
- 4.3. DIE THEORIE DER ANXIETY SENSITIVITY
- 5. DER COVARIATION BIAS
- 5.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND THEORETISCHER HINTERGRUND
- 5.2. DAS PARADIGMA DER ILLUSORISCHEN KORRELATION: BEFUNDE
- 5.2.1. COVARIATION BIAS BEI HOCHÄNGSTLICHEN PROBANDEN UND ANGSTPATIENTEN
- 5.2.2. COVARIATION BIAS UND STARTLE-REFLEX
- 5.3. COVARIATION BIAS UND CONTINGENT NEGATIVE VARIATION (CNV)
- 5.3.1. BEFUNDE ZUR CNV BEI ANGSTPATIENTEN
- 5.3.2. BEFUNDE ZUM ZUSAMMENHANG VON COVARIATION BIAS UND CNV
- 6. RISIKOFAKTOREN FÜR ENTSTEHUNG UND VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
- 6.1. ÜBERBLICK ÜBER MÖGLICHE RISIKOFAKTOREN
- 6.2. ANXIETY SENSITIVITY ALS RISIKOFAKTOR FÜR ENTSTEHUNG UND VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
- 6.2.1. DER ANXIETY SENSITIVITY INDEX (ASI)
- 6.2.2. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ANXIETY SENSITIVITY UND PANIKATTACKEN
- 6.2.3. ANXIETY SENSITIVITY ALS PRÄDIKTOR FÜR PANIKATTACKEN BEI GESUNDEN
- 6.2.4. ANXIETY SENSITIVITY ALS PRÄDIKTOR FÜR DEN VERLAUF DER PANIKSTÖRUNG
- 6.2.5. DIE ROLLE DER ANXIETY SENSITIVITY BEI DER REAKTION AUF STREẞINDUKTION UND PANIKPROVOKATION
- 6.2.6. PARALLELEN ZWISCHEN HOHER ANXIETY SENSITIVITY UND PANIKATTACKEN
- 6.2.6.1. Kognitive Verarbeitungsprozesse bei hoher Anxiety Sensitivity
- 6.2.6.2. Beeinflussung von Anxiety Sensitivity durch Therapie
- 6.2.7. ZUSAMMENFASSUNG
- 6.3. NICHT-KLINISCHE PANIKATTACKEN ALS RISIKOFAKTOR FÜR DIE PANIKSTÖRUNG
- 6.3.1. KOGNITIVE VERARBEITUNGSPROZESSE BEI PERSONEN MIT NICHT-KLINISCHER PANIK
- 6.3.2. REAKTION AUF STREẞINDUKTION UND PANIKPROVOKATION BEI PERSONEN MIT NICHT-KLINISCHER PANIK
- 6.3.3. ZUSAMMENFASSUNG
- 7. ZIELSETZUNG UND ALLGEMEINE HYPOTHESEN
- EMPIRISCHER TEIL
- 8. VORVERSUCH: MODULATION PSYCHOPHYSIOLOGISCHER VARIABLEN DURCH EMOTIONALE BILDREIZE BEI GESUNDEN PROBANDEN
- 8.1. ZIELSETZUNG
- 8.2. METHODIK
- 8.2.1. REKRUTIERUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
- 8.2.2. VERSUCHSMATERIAL
- 8.2.3. VERSUCHSABLAUF UND VERSUCHSDESIGN
- 8.2.4. AUFZEICHNUNG UND VORAUSWERTUNG DER PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN DATEN
- 8.2.5. STATISTISCHE ANALYSE
- 8.3. HYPOTHESEN
- 8.4. ERGEBNISSE
- 8.4.1. BESCHREIBUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
- 8.4.2. VALENZ- UND AROUSALRATINGS UND BETRACHTUNGSZEIT
- 8.4.3. EEG-DATEN
- 8.4.4. STARTLE-REFLEX
- 8.4.5. SCR
- 8.4.6. KORRELATIONEN ZWISCHEN SUBJEKTIVEN UND PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN VARIABLEN
- 8.5. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION
- 9. HAUPTVERSUCH I: VERARBEITUNG EMOTIONALER Reize bei RISIKOGRUPPEN FÜR DIE PANIKSTÖRUNG
- 9.1. ZIELSETZUNG
- 9.2. METHODIK
- 9.2.1. REKRUTIERUNG DER VERSUCHSTEILNEHMER
- 9.2.2. AUSWAHLKRITERIEN
- 9.2.3. VERSUCHSMATERIAL
- 9.2.4. VERSUCHSABLAUF UND VERSUCHSDESIGN
- 9.2.5. AUFZEICHNUNG UND VORAUSWERTUNG DER PSYCHOPHYSIOLOGISCHEN DATEN
- 9.2.6. STATISTISCHE ANALYSE
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- Kognitive und psychophysiologische Verarbeitungsmechanismen bei der Panikstörung
- Neurobiologische Grundlagen von Panikattacken
- Rolle kognitiver Prozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Panikstörung
- Risikofaktoren für die Entstehung und den Verlauf der Panikstörung
- Anxiety Sensitivity als Risikofaktor für die Panikstörung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit den kognitiven und psychophysiologischen Verarbeitungsmechanismen bei der Panikstörung und bei Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung. Ziel ist es, die neurobiologischen und psychophysiologischen Grundlagen von Panikattacken zu untersuchen und die Rolle kognitiver Prozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Dissertation beginnt mit einer umfassenden Darstellung der Panikstörung, ihrer Definition, Diagnose, Epidemiologie und neurobiologischen Grundlagen. Anschließend werden die psychophysiologischen Grundlagen der Forschung, insbesondere evozierte Potentiale, Startle-Reflex und Hautleitfähigkeit, erläutert.
Im weiteren Verlauf werden Emotionstheorien, insbesondere die Theorie von Lang, vorgestellt, die die Verarbeitung emotionaler Reize und deren Einfluss auf die Entstehung von Angst und Panik beleuchten.
Die Dissertation beleuchtet verschiedene Theorien zur Entstehung der Panikstörung, darunter Konditionierungstheorien, kognitive Theorien und die Theorie der Anxiety Sensitivity.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Covariation Bias, einem kognitiven Verzerrungsphänomen, das bei Angstpatienten verstärkt auftritt.
Die Arbeit untersucht verschiedene Risikofaktoren für die Entstehung und den Verlauf der Panikstörung, insbesondere die Anxiety Sensitivity.
Im empirischen Teil der Dissertation werden zwei Studien vorgestellt. Der Vorversuch untersucht die Modulation psychophysiologischer Variablen durch emotionale Bildreize bei gesunden Probanden. Der Hauptversuch I analysiert die Verarbeitung emotionaler Reize bei Risikogruppen für die Panikstörung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Panikstörung, Angststörungen, kognitive Verarbeitung, psychophysiologische Prozesse, evozierte Potentiale, Startle-Reflex, Hautleitfähigkeit, Emotionstheorien, Anxiety Sensitivity, Covariation Bias, Risikofaktoren, Entstehung und Verlauf der Panikstörung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Anxiety Sensitivity (Angstsensitivität)?
Angstsensitivität bezeichnet die Angst vor den körperlichen Symptomen der Angst, basierend auf der Überzeugung, dass diese schädliche Folgen haben (z. B. Herzrasen führt zum Herzinfarkt).
Wie reagieren Panikpatienten auf panikrelevante Reize?
Studien zeigen, dass Panikpatienten und Risikogruppen panikrelevante Bilder als negativer und erregender empfinden und psychophysiologisch (z. B. SCR, CNV) stärker darauf reagieren.
Was versteht man unter dem „Covariation Bias“?
Es ist das Phänomen, dass Menschen mit Angststörungen den Zusammenhang zwischen angst-relevanten Reizen und negativen Konsequenzen überschätzen.
Welche psychophysiologischen Messmethoden werden in der Panikforschung genutzt?
Häufig genutzte Parameter sind evozierte Potentiale im EEG (P3, PSW, CNV), der Startle-Reflex (Lidschlussreaktion) und die Hautleitfähigkeit (SCR).
Können diese Merkmale als Prädiktoren für eine Panikstörung dienen?
Die Dissertation legt nahe, dass die veränderte Verarbeitung emotionaler Reize als Prädiktor für den Ausbruch, den Verlauf oder den Therapieerfolg der Störung dienen könnte.
- Arbeit zitieren
- Christine Amrhein (Autor:in), 2003, Kognitive und psychophysiologische Verarbeitungsmechanismen bei der Panikstörung und bei Personen mit einem erhöhten Risiko für die Panikstörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128106