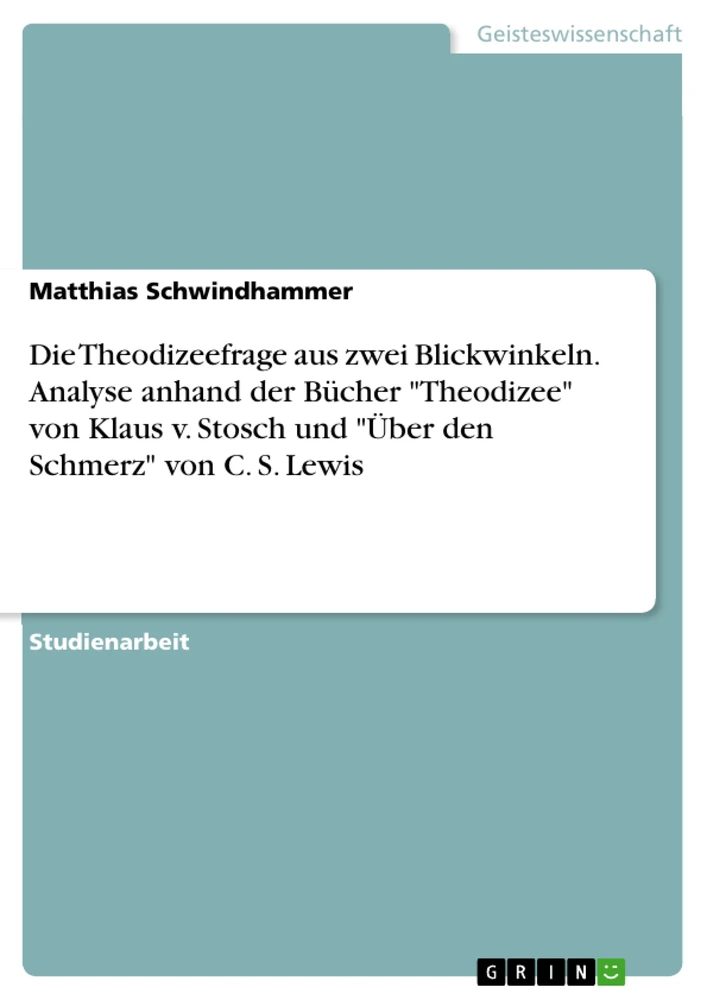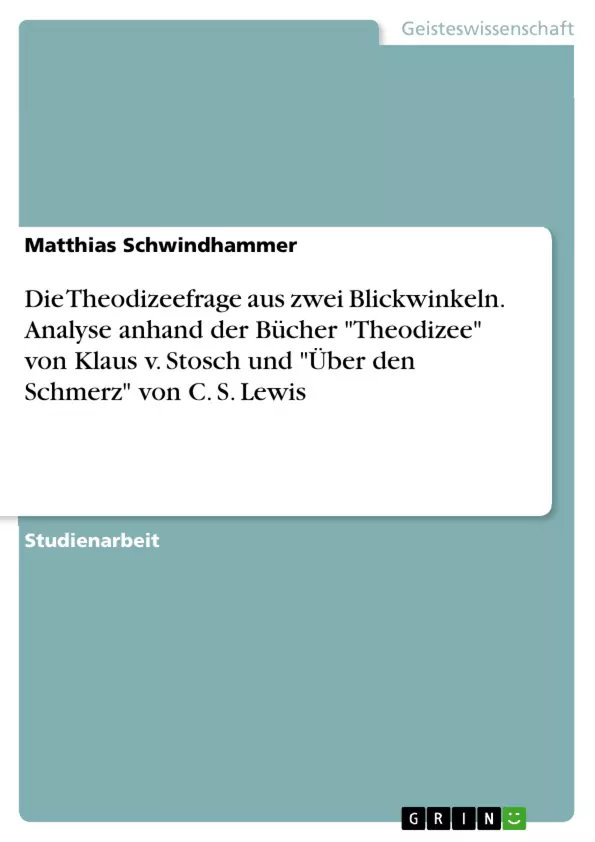Ziel dieser Arbeit ist die Ausarbeitung der Argumentationsstrategien beider Autoren, um einen umfassenden Einblick in die Fragestellung der Theodizee zu gewinnen.
Krankheiten, Schmerzen und menschliche Tragödien gehören untrennbar zu dieser Welt. Jeden Tag und jede Minute gibt es Menschen, die unsagbarem, sinnlosem Leiden ausgesetzt sind. Wie kann in Anbetracht der Tatsache sinnlosen Leidens überhaupt ein Glaube an einen allgütigen, allmächtigen und allwissenden Gott verantwortet werden? Dieser Frage soll in dieser Seminararbeit mithilfe zweier Bücher nachgegangen werden.
Zu Beginn liegt das Buch „Theodizee“ von Klaus v. Stosch im Fokus. Mithilfe einer ausführlichen Schilderung sowohl der Argumente als auch deren Beurteilung durch den Autor soll hiermit ein Überblick zu den Antwortversuchen in der Theodizeefrage gegeben werden. Als Vergleichswerk wird im zweiten Teil dieser Arbeit das Buch „Über den Schmerz“ von C. S. Lewis herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antwortstrategien und deren Bewertung bei Klaus v. Stosch
- Theoretische Theodizee
- Bonisierungs- und Depotenzierungsversuche
- Die Verteidigung der Prädikationen Gottes
- Die Verteidigung der Naturgesetze
- Die Menschliche Freiheit
- Praktische Theodizee
- Theodizee und Handeln Gottes
- Theoretische Theodizee
- Antwortstrategien bei C.S. Lewis
- Das Problem
- Die Allmacht
- Die Gutheit
- Die Menschliche Bosheit
- Der Fall des Menschen
- Menschlicher Schmerz
- Die Hölle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Theodizeefrage, also der Frage, wie sich ein allmächtiger, allwissender und allgütiger Gott mit dem Vorhandensein von Leid in der Welt vereinbaren lässt. Die Arbeit analysiert zwei unterschiedliche Ansätze zur Beantwortung dieser Frage, die in den Büchern "Theodizee" von Klaus v. Stosch und "Über den Schmerz" von C.S. Lewis dargestellt werden.
- Analyse der Argumentationsstrategien zur Beantwortung der Theodizeefrage
- Untersuchung der verschiedenen Lösungsansätze für das Problem des Leids
- Vergleich der Theodizeemodell von Klaus v. Stosch und C.S. Lewis
- Reflexion der Rolle der menschlichen Freiheit und Bosheit im Zusammenhang mit dem Leiden
- Betrachtung des Themas Leid aus verschiedenen Perspektiven: theologischer, philosophischer und psychologischer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Theodizeefrage als grundlegendes Problem des christlichen Glaubens vor und führt die beiden untersuchten Bücher von Klaus v. Stosch und C.S. Lewis ein. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Analyse der Argumentationsstrategien beider Autoren.
- Antwortstrategien und deren Bewertung bei Klaus v. Stosch: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Antwortstrategien auf die Theodizeefrage, die von Klaus v. Stosch in seinem Buch "Theodizee" vorgestellt werden. Es werden die theoretische und praktische Theodizee sowie die Rolle des Handelns Gottes diskutiert. Das Kapitel untersucht die Bonisierungs- und Depotenzierungsversuche, die Stosch als mögliche Lösungsansätze präsentiert.
- Antwortstrategien bei C.S. Lewis: Dieses Kapitel behandelt die Argumentationsstrategien von C.S. Lewis aus seinem Buch "Über den Schmerz". Es untersucht Lewis' Sicht auf die Theodizeefrage im Kontext der Allmacht, Gutheit und Bosheit Gottes sowie des Falls des Menschen und des menschlichen Schmerzes.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der Theodizeefrage, der Analyse von Antwortstrategien auf das Problem des Leids in der Welt und dem Vergleich der Ansätze von Klaus v. Stosch und C.S. Lewis. Zentrale Themen sind: Leiden, Schmerz, Theodizee, Gott, Allmacht, Gutheit, Bosheit, Menschliche Freiheit, Bonisierung, Depotenzierung, Moral, Glaube, Handlung, Philosophie, Theologie, Religion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theodizeefrage?
Die Theodizeefrage untersucht, wie die Existenz eines allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gottes mit dem Vorhandensein von Leid und Schmerz in der Welt vereinbart werden kann.
Wie nähert sich Klaus v. Stosch der Theodizeefrage?
Stosch analysiert theoretische und praktische Antwortstrategien, darunter die Verteidigung der Naturgesetze und die Bedeutung der menschlichen Freiheit.
Welchen Ansatz verfolgt C. S. Lewis in "Über den Schmerz"?
Lewis betrachtet Schmerz als Instrument, das den Menschen zur Umkehr bewegen kann, und betont die Rolle der menschlichen Bosheit und des Sündenfalls.
Was versteht man unter "Bonisierungsversuchen"?
Dies sind Argumentationsmuster, die versuchen, dem Leid einen tieferen Sinn oder ein höheres Gut zuzuschreiben, um die Güte Gottes zu rechtfertigen.
Welche Rolle spielt die menschliche Freiheit beim Problem des Leids?
Beide Autoren argumentieren, dass die Freiheit des Menschen, sich für das Böse zu entscheiden, eine notwendige Bedingung für eine echte Beziehung zu Gott ist, was jedoch Leid zur Folge haben kann.
Was ist der Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Theodizee?
Theoretische Theodizee sucht nach logischen Erklärungen für das Leid, während praktische Theodizee fragt, wie Menschen und Gott im Angesicht des Leids handeln können.
- Quote paper
- Matthias Schwindhammer (Author), 2022, Die Theodizeefrage aus zwei Blickwinkeln. Analyse anhand der Bücher "Theodizee" von Klaus v. Stosch und "Über den Schmerz" von C. S. Lewis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1281077