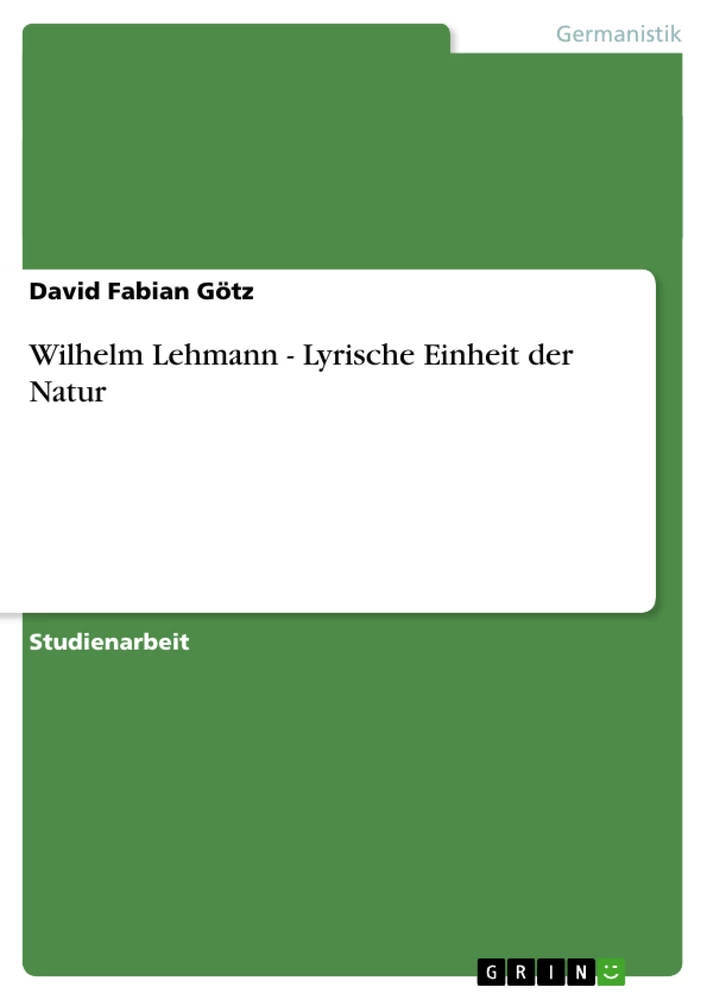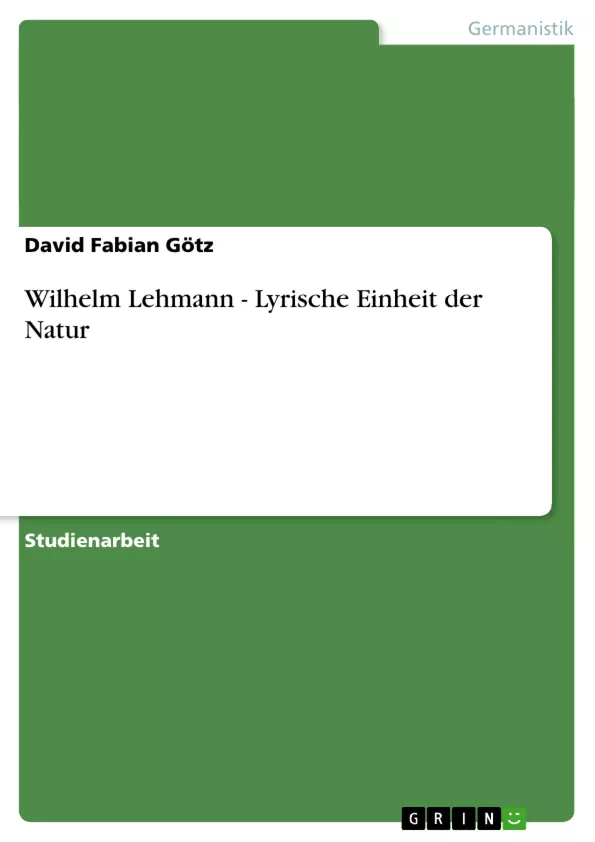Über Wilhelm Lehmann schreiben heißt: Über einen nahezu Unbekannten, wenn nicht in weiten Kreisen bereits Vergessenen schreiben. Der Name Wilhelm Lehmann ruft nicht nur bei sogenannten Laien, sondern auch bei Germanistikstudenten oder gar Lehrern der jüngeren Generation Unkenntnis und Ratlosigkeit hervor. Die wenig vorhandene Forschungsliteratur spiegelt diesen Befund in deutlicher Weise wider. Dabei wird Lehmann in einschlägigen Lexika und Überblicksdarstellungen in Reihung mit Oskar Loerke, Karl Krolow und Peter Huchel gestellt. Man könnte also konstatieren, dass seine Bedeutung für die deutsche Literaturgeschichte unumstritten ist, eine Beschäftigung mit Lehmann aber wohl zu wenig ergiebig und lohnenswert scheint. Zu Lehmanns Lebzeiten wurden seine literarischen Ambitionen durchaus honoriert, was sich u.a. an der Verleihung des Heinrich-von-Kleist-Preises im Jahre 1923 durch Alfred Döberlin an Lehmann und Robert Musil zeigt. Außerdem nahm Lehmann an literarischen Gesellschaften mit z.B. Loerke, Buber, Hauptmann und Rathenau teil; auch dies zeigt die allgemeine Wertschätzung, welche Lehmann erfahren hat. Doch auch im öffentlichen literarischen Bewusstsein wurde Lehmann geachtet und in Rezensionen seiner Werke hoch geschätzt und positiv besprochen.
Kritik an Lehmann als Person wurde jedoch besonders in der Bundesrepublik zur Zeit der Studentenbewegungen geäußert, welche ihm Opportunismus und seine Mitgliedschaft in der NSDAP vorwarf. Als Folge dessen geriet v.a. in dieser „politischen Zeit“ Lehmann und seine als apolitisch angesehene Lyrik in Vergessenheit.
Lange Zeit wurde Lehmanns Schaffen als strikt der Naturlyrik immanentes Dichten und Schreiben gesehen. Naturlyrik galt in der Zeit der politischen Unruhen als nicht mehr dem Zeitgeist adäquat. Sofern man Natur nicht als Vegetation, sondern als „Möglichkeit wahren menschlichen Daseins“ definiert, gewinnt der Begriff Naturlyrik eine Schwingungsbreite, welche auch der Lyrik Lehmanns immanent ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Naturlyrik
- Gliederung
- Biographische Grundzüge Wilhelm Lehmanns
- Interpretationen
- ,,An meinen ältesten Sohn“
- ,,Altjahrsabend"
- ,,Signale"
- ,,Abgeblühter Löwenzahn"
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, unter Zuhilfenahme einzelner Auszüge seiner Lyrik an Wilhelm Lehmann heranzuführen sowie vereinzelte Charakteristika und Grundzüge des Dichters darzustellen und somit den Zugang zu Lehmann und seinem Werk zu erleichtern.
- Das Phänomen der Naturlyrik
- Tendenzen der Lyrikproduktion in der Zeit des Dritten Reiches und im Nachkriegsdeutschland
- Das Leben Wilhelm Lehmanns und seine Naturstudien
- Die Frage, ob Lehmann wirklich „nur“ ein apolitischer, detailverliebter Natur- und deshalb auch ein zu Recht meist unbeachteter Lyriker war und ist
- Lehmanns Verdienste um eine deutsche Lyrik und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Wilhelm Lehmann als einen nahezu vergessenen Dichter vor, dessen Bedeutung für die deutsche Literaturgeschichte dennoch unumstritten ist. Die Arbeit beleuchtet die Gründe für Lehmanns Vergessenheit, insbesondere die Kritik an seiner NSDAP-Mitgliedschaft und die Einordnung seiner Lyrik in die Kategorie der „Inneren Emigration“.
Der Abschnitt „Naturlyrik“ befasst sich mit der Definition und den verschiedenen Interpretationen des Begriffs „Naturlyrik“ im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Dabei wird die Rolle der Naturlyrik im Dritten Reich und in der Nachkriegszeit beleuchtet, sowie die Kritik an den „inneren Emigranten“ und deren vermeintlicher Apologie des Nazi-Regimes durch ihre „unkritische“ Naturlyrik.
Die Gliederung stellt die biographischen Grundzüge Wilhelm Lehmanns dar und beleuchtet seine Naturstudien im Hinblick auf seine Gedichte.
Der Hauptteil der Arbeit analysiert einzelne Gedichte Lehmanns aus den Sammlungen „Antwort des Schweigens“, „Der grüne Gott“ und „Entzückter Staub“, um zu erörtern, ob Lehmann tatsächlich „nur“ ein apolitischer, detailverliebter Naturlyriker war und ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Wilhelm Lehmann, Naturlyrik, Innere Emigration, Deutsches Reich, Nachkriegszeit, Lyrik, Literaturgeschichte, Politische Lyrik, Apolitik, Naturstudien, Gedichte, „Antwort des Schweigens“, „Der grüne Gott“, „Entzückter Staub“.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Wilhelm Lehmann?
Wilhelm Lehmann war ein bedeutender deutscher Dichter des 20. Jahrhunderts, der vor allem für seine Naturlyrik bekannt ist und in einer Reihe mit Oskar Loerke steht.
Was zeichnet Lehmanns Naturlyrik aus?
Seine Lyrik ist geprägt von präzisen Naturbeobachtungen und einer magischen Naturauffassung, die die Natur als „Möglichkeit wahren menschlichen Daseins“ begreift.
Warum geriet Wilhelm Lehmann zeitweise in Vergessenheit?
Kritik an seiner NSDAP-Mitgliedschaft während der Studentenbewegung und die Einordnung seiner apolitischen Lyrik als nicht mehr zeitgemäß führten zu einem Rückgang seiner Bekanntheit.
Was versteht man unter „Innerer Emigration“?
Es beschreibt Schriftsteller, die während des Nationalsozialismus in Deutschland blieben, aber sich durch unpolitische Themen (wie Naturlyrik) geistig vom Regime distanzierten.
Welche Gedichtsammlungen von Lehmann sind besonders wichtig?
Zu seinen zentralen Werken gehören „Antwort des Schweigens“, „Der grüne Gott“ und „Entzückter Staub“.
- Arbeit zitieren
- David Fabian Götz (Autor:in), 2009, Wilhelm Lehmann - Lyrische Einheit der Natur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128118