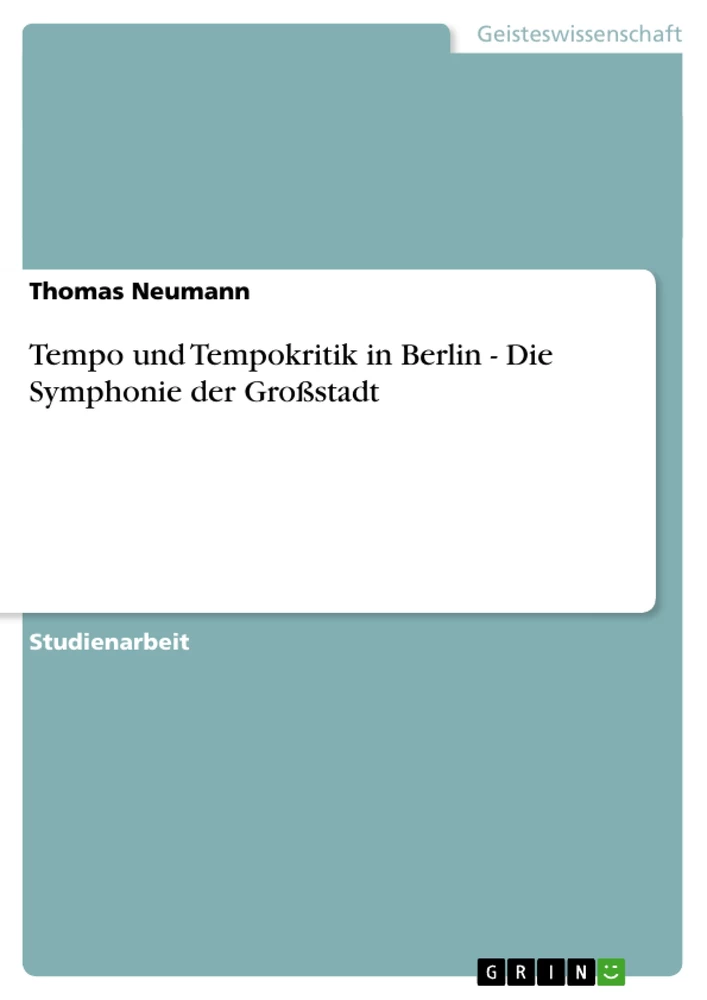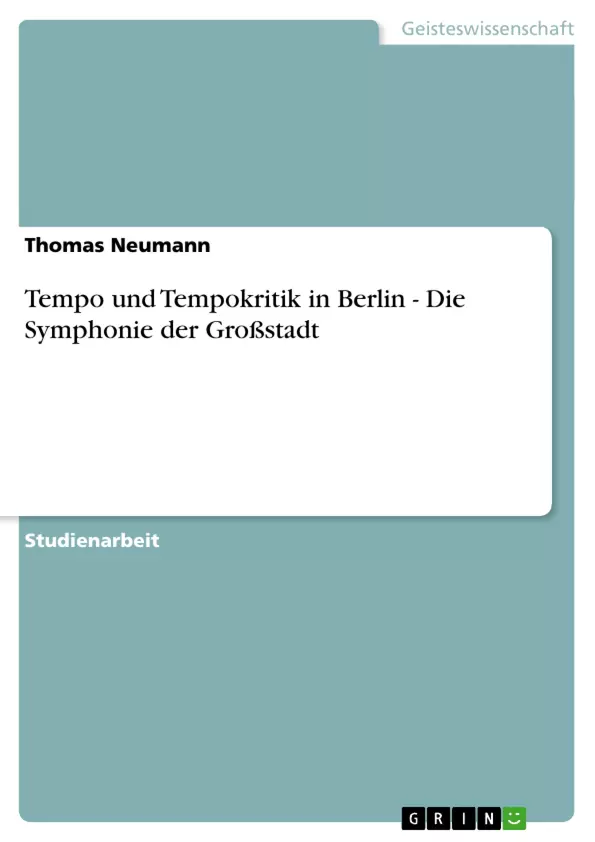„In einem Punkt“, so schreibt Hartmut Rosa in seinem 2005 erschienenen Werk "Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne", „sind sich die Verfechter wie die Verächter der Moderne von Anfang an [...] einig: ihre konstitutive Grunderfahrung ist diejenige einer ungeheuren Beschleunigung der Welt und des Lebens und des je individuellen Erfahrungsstromes“. Die von Rosa getroffene Feststellung, dass die „Erfahrung von Modernisierung [...] eine Erfahrung der Beschleunigung“ ist, führt zu der Frage, wie diese durch eine Erhöhung des Lebenstempos gekennzeichnete Moderne individuell und kollektiv wahrgenommen, bewertet und medial inszeniert wird.
Die vorliegende Arbeit will dieser Fragestellung am Beispiel des Dokumentarfilms Berlin – Die Sinfonie der Großstadt von Walter Ruttmann aus dem Jahre 1927 nachgehen. Der Film zeigt in dokumentarischen Aufnahmen, die mittels der Montagetechnik verbunden werden, in fünf ‚Akten‘ einen Tag im Leben der Großstadt Berlin. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der für die Selbstwahrnehmung der Moderne entscheidende Topos des ‚Tempos‘ in Berlin inszeniert und bewertet wird. Entgegen vieler zeitgenössischer Wahrnehmungen und den meisten wissenschaftlichen Analysen3, die den Film als unkritische Apotheose des Tempos interpretieren, wird dabei die These vertreten, dass Berlin nicht ausschließlich, aber auch als eine Kritik an der als Beschleunigungsphänomen verstandenen Moderne gelesen werden kann.
Vor der formalen wie inhaltlichen Analyse des Films soll in einem theoretischen Teil dargestellt werden, warum gerade Berlin als paradigmatisch für die Auseinandersetzung mit dem Topos des ‚Tempos‘ in der Weimarer Republik gelten kann. Zunächst wird auf die enge Verbindung der Stadt als Ort der Moderne mit dem ‚Tempo‘ und dem Medium Film eingegangen. Anschließend wird die besondere Rolle gezeigt, die Berlin im Diskurs über den Topos des ‚Tempos‘ einnimmt. Den Hauptteil der Arbeit bildet dann die Analyse des Films Berlin – Die Sinfonie der Großstadt. Nach dem Nachweis, dass der Film auf bekannte Topoi über Berlin zurückgreift, wird die Inszenierung des Tempos im Film analysiert. Schließlich wird gezeigt, wie der Film die negativen Folgen des großstädtischen Tempos darstellt und somit als Kritik an einer als Beschleunigung verstandenen Moderne gesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Stadt - Film - Tempo
- Stadt und Tempo
- Stadt und Film
- Berlin als Stadt des Tempos
- Stadt - Film - Tempo
- Berlin – Die Sinfonie der Großstadt
- Topos Tempo vs. Objektivitätspostulat
- Inszenierung von Tempo
- Inszenierung von Tempo auf technisch-formaler Ebene
- Inszenierung von Tempo auf inhaltlicher Ebene
- Tempokritik
- Tempokritik als Sozialkritik
- Die Spirale als Leitmotiv überforderter Wahrnehmung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Dokumentarfilm "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt" von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1927, um die Inszenierung und Bewertung des Tempos in der Großstadt Berlin zu analysieren. Der Film zeigt einen Tag im Leben der Stadt und stellt die Frage, wie das Tempo in der Selbstwahrnehmung der Moderne eine Rolle spielt. Die Arbeit argumentiert, dass der Film nicht nur eine unkritische Apotheose des Tempos darstellt, sondern auch als Kritik an der als Beschleunigungsphänomen verstandenen Moderne gelesen werden kann.
- Die Rolle des Tempos in der Selbstwahrnehmung der Moderne
- Die Inszenierung des Tempos in "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt"
- Die Kritik an der Beschleunigungsphänomen der Moderne im Film
- Die Bedeutung von Berlin als Stadt des Tempos in der Weimarer Republik
- Die Verbindung von Stadt, Film und Tempo
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Beschleunigung in der Moderne ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie wird das Tempo in der Großstadt Berlin inszeniert und bewertet? Die Arbeit setzt sich mit der These auseinander, dass "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt" nicht nur eine unkritische Apotheose des Tempos darstellt, sondern auch als Kritik an der als Beschleunigungsphänomen verstandenen Moderne gelesen werden kann.
Der theoretische Teil der Arbeit beleuchtet die enge Verbindung der Stadt als Ort der Moderne mit dem Tempo und dem Medium Film. Es wird gezeigt, warum gerade Berlin als paradigmatisch für die Auseinandersetzung mit dem Topos des Tempos in der Weimarer Republik gelten kann. Die Analyse des Films "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt" zeigt, dass der Film auf bekannte Topoi über Berlin zurückgreift und das Tempo auf technisch-formaler und inhaltlicher Ebene inszeniert. Schließlich wird gezeigt, wie der Film die negativen Folgen des großstädtischen Tempos darstellt und somit als Kritik an einer als Beschleunigung verstandenen Moderne gesehen werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Tempo, Tempokritik, Berlin, Großstadt, Moderne, Beschleunigung, Film, Walter Ruttmann, "Berlin - Die Sinfonie der Großstadt", Stadt und Film, Stadt und Tempo, Inszenierung, Kritik, Sozialkritik, Wahrnehmung, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Film „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“?
Der Film von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1927 zeigt dokumentarisch einen Tag im Leben der Metropole Berlin unter Einsatz innovativer Montagetechniken.
Ist der Film eine reine Verherrlichung des Tempos?
Nein, der Text vertritt die These, dass der Film auch kritische Elemente enthält, die die negativen Folgen der Beschleunigung und des großstädtischen Tempos thematisieren.
Wie wird Tempo im Film technisch inszeniert?
Durch schnelle Schnitte, Rhythmus in der Montage und die Darstellung von Maschinen, Verkehr und hektischen Bewegungen auf formaler Ebene.
Was bedeutet „Tempokritik als Sozialkritik“?
Der Film zeigt die Überforderung des Individuums durch die moderne Beschleunigung, was als Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen der Weimarer Republik gelesen werden kann.
Warum war Berlin das Paradigma für das Thema Tempo?
In der Weimarer Republik galt Berlin als der Ort der Moderne schlechthin, an dem technische Neuerungen und die Beschleunigung des Lebens am deutlichsten spürbar waren.
- Citation du texte
- Thomas Neumann (Auteur), 2008, Tempo und Tempokritik in Berlin - Die Symphonie der Großstadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128206