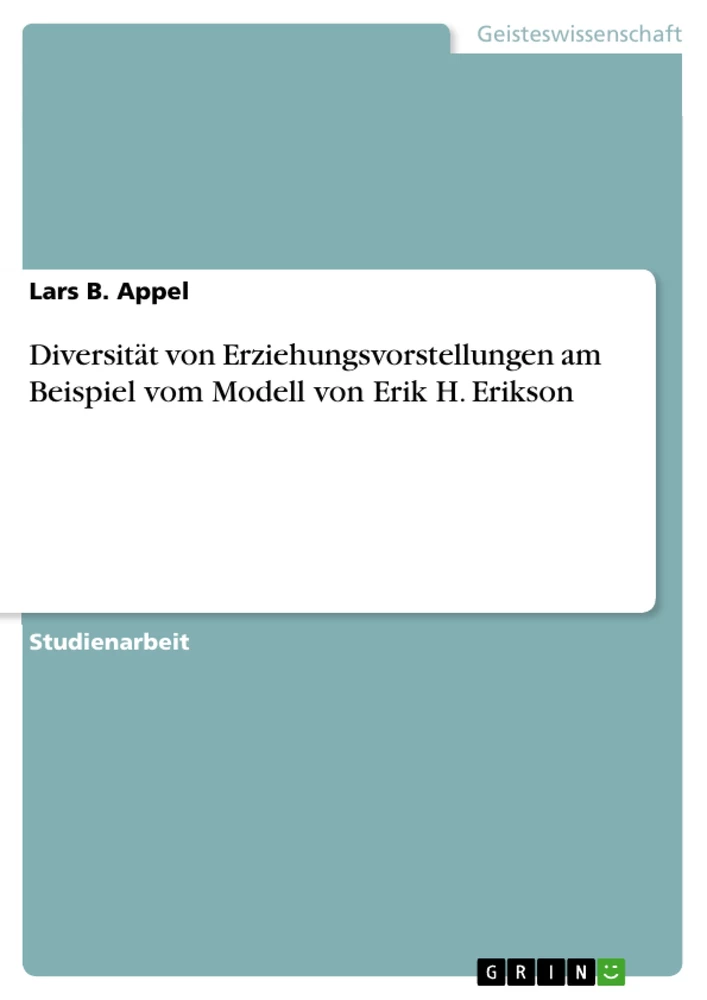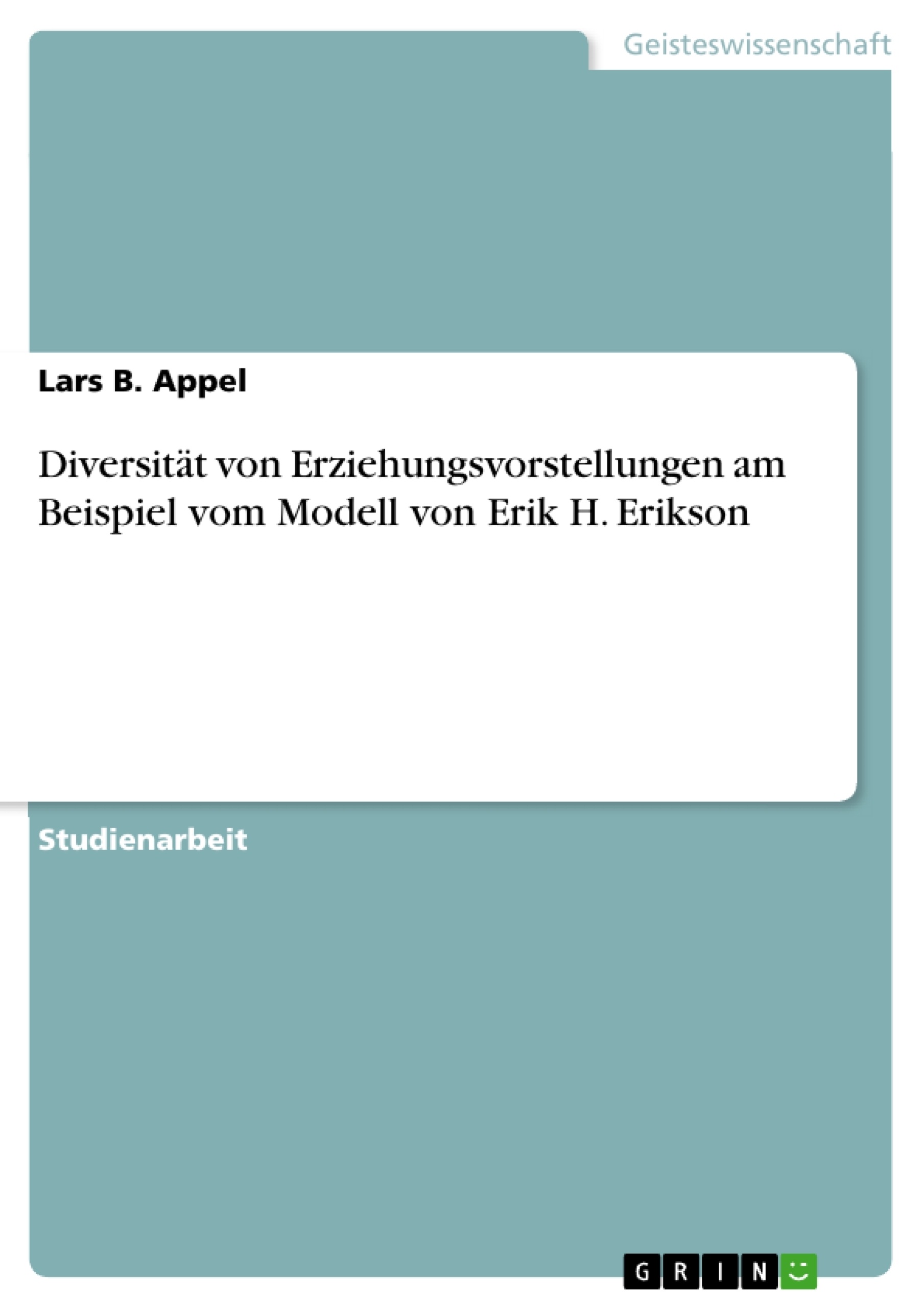Die vorliegende Studienarbeit beschäftigt sich mit Eriksons Stufenmodell und bezieht sich auf die Vielfalt (Diversität) von Erziehungsvorstellungen und Erziehungsstilen. Sie hat zum Ziel, in Form einer Literaturanalyse, Eriksons Modell zu erklären und einen Einblick in die Vielfalt an Erziehungsstilen und Mischformen der Erziehung zu geben. Darüber hinaus soll sein Modell auf die Erziehungsstile nach Lippitt und White übertragen und mögliche Grenzen des Modells aufgezeigt werden.
Im Alltag und auch im wissenschaftlichen Umfeld neigen Menschen nach Leiprecht (2011, S.16) zu unterschiedlichen Lesearten, Interpretationen und Assoziationen. Bedingt ist dies durch unsere selektive Wahrnehmung. Damit ein besseres Leseverständnis gewährleistet werden kann und um Missverständnisse zu reduzieren, werden in Kapitel 2 zunächst wichtige Begrifflichkeiten, die diesem Diskurs zugrunde liegen, näher erläutert. Dazu gehören die Begriffe Diversität, Erziehung und Erziehungsvorstellungen, insbesondere im soziokulturellen Kontext.
In Kapitel 3 erfolgt die Darstellung der ersten vier Stufen von Eriksons Stufenmodell, woraufhin in Kapitel 5 die Erziehungsstile nach Lippitt und White erläutert und auf Eriksons Stufenmodell bezogen werden. In Kapitel 4 folgt ein Einblick in Eriksons Vorstellungen von Kultur und wie diese Erziehungsvorstellungen prägen und beeinflussen. Ferner wird im Ansatz auf die Bedeutsamkeit/Rolle der Sozialen Arbeit eingegangen. Kapitel 6 beinhaltet die kritische Würdigung von Eriksons Modell und thematisiert dessen Grenzen. Das abschließende Fazit der vorliegenden Studienarbeit erfolgt in Kapitel 7.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
- 2.1 Diversität
- 2.2 Erziehung
- 2.3 Erziehungsvorstellungen und Kultur
- 3. ERIKSONS STUFENMODELL
- 4. KULTURELLER EINFLUSS AUF ERZIEHUNGSVORSTELLUNGEN
- 5. ERZIEHUNGSSTILE NACH LIPPITT UND WHITE
- 5.1 Übertragbarkeit
- 6. GRENZEN UND KRITIK
- 7. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung im Kontext der Diversität von Erziehungsvorstellungen und -stilen. Ziel ist es, Eriksons Modell mittels Literaturanalyse zu erklären und die Vielfalt an Erziehungsstilen aufzuzeigen. Weiterhin soll das Modell auf die Erziehungsstile nach Lippitt und White übertragen und dessen Grenzen beleuchtet werden.
- Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
- Diversität von Erziehungsvorstellungen
- Kultureller Einfluss auf Erziehung
- Erziehungsstile nach Lippitt und White
- Grenzen und Kritik an Eriksons Modell
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung stellt Erik Homburger Erikson als bedeutenden Psychoanalytiker vor und beschreibt seine Biographie und seine wichtigsten wissenschaftlichen Beiträge, insbesondere sein Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Die Arbeit kündigt die Zielsetzung an: Erläuterung von Eriksons Modell, Darstellung der Vielfalt von Erziehungsstilen und die Übertragung auf das Modell von Lippitt und White, sowie die kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen des Modells. Die Notwendigkeit der Begriffsklärung in Kapitel 2 wird begründet, um Missverständnisse zu vermeiden.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit: Diversität, Erziehung und Erziehungsvorstellungen. Diversität wird im Kontext der Sozialen Arbeit als spezifisch menschliche Vielfalt verstanden, die aus historischen und gesellschaftlichen Prozessen erwächst und soziale Ungleichheiten hervorbringen kann. Erziehung wird als Weitergabe moralischer und normativer Regularien der Gesellschaft durch ältere an jüngere Individuen definiert, wobei die heutige Zeit eine Umkehrung dieser Verhältnisse in manchen Bereichen aufzeigt. Erziehungsvorstellungen werden als kulturspezifische Sichtweisen auf das Kind und den optimalen Umgang mit ihm beschrieben, die sich soziokulturell unterscheiden.
3. Eriksons Stufenmodell: Dieses Kapitel beschreibt die ersten vier Stufen von Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Es werden die zentralen Herausforderungen und die jeweiligen positiven und negativen Ausgänge jeder Stufe detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der jeweiligen Entwicklungsaufgaben und der Bedeutung dieser Stufen für die spätere Persönlichkeitsentwicklung. Die Interaktion zwischen den einzelnen Stufen und deren Einfluss aufeinander wird erläutert. Die Kapitel 3-6 setzen an dieser Stelle an und beleuchten die einzelnen Punkte der Entwicklung mit Bezug auf weitere Faktoren.
4. Kultureller Einfluss auf Erziehungsvorstellungen: Kapitel 4 beleuchtet den Einfluss kultureller Faktoren auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Es wird untersucht, wie unterschiedliche soziokulturelle Kontexte die Erziehungsvorstellungen prägen und wie diese sich auf die Bewältigung der von Erikson beschriebenen Entwicklungsaufgaben auswirken. Der Einfluss von kulturellen Normen, Werten und Erwartungen auf den Erziehungsstil wird analysiert, und die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Berücksichtigung dieser kulturellen Unterschiede wird diskutiert.
5. Erziehungsstile nach Lippitt und White: In diesem Kapitel werden die Erziehungsstile nach Lippitt und White vorgestellt und im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf Eriksons Stufenmodell analysiert. Die verschiedenen Erziehungsstile werden beschrieben und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung im Kontext der Eriksonschen Stufen diskutiert. Die Kapitel analysiert, inwiefern die verschiedenen Stile die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben unterstützen oder behindern und welche Implikationen sich daraus für die Praxis der Sozialen Arbeit ergeben.
Schlüsselwörter
Erik Homburger Erikson, Stufenmodell, psychosoziale Entwicklung, Diversität, Erziehungsvorstellungen, Erziehungsstile, Lippitt und White, Kultur, Soziale Arbeit, Lebenszyklus, Identitätskrise, Urvertrauen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Studienarbeit zu Eriksons Stufenmodell und Diversität von Erziehungsstilen
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung im Kontext der Diversität von Erziehungsvorstellungen und -stilen. Sie analysiert den Einfluss kultureller Faktoren auf die Erziehung und die Übertragbarkeit der Erziehungsstile nach Lippitt und White auf Eriksons Modell.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung, Diversität von Erziehungsvorstellungen, kultureller Einfluss auf Erziehung, Erziehungsstile nach Lippitt und White, sowie Grenzen und Kritik an Eriksons Modell. Die zentralen Begriffe Diversität, Erziehung und Erziehungsvorstellungen werden ausführlich geklärt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Eriksons Modell mittels Literaturanalyse zu erklären, die Vielfalt an Erziehungsstilen aufzuzeigen, das Modell auf die Erziehungsstile nach Lippitt und White zu übertragen und dessen Grenzen zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen (Diversität, Erziehung, Erziehungsvorstellungen und Kultur), Eriksons Stufenmodell, Kultureller Einfluss auf Erziehungsvorstellungen, Erziehungsstile nach Lippitt und White (inkl. Übertragbarkeit), Grenzen und Kritik, und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Aspekte von Eriksons Stufenmodell werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die ersten vier Stufen von Eriksons Stufenmodell, detailliert die Herausforderungen und positiven/negativen Ausgänge jeder Stufe, und erläutert die Interaktion zwischen den Stufen und deren Einfluss aufeinander.
Wie werden die Erziehungsstile nach Lippitt und White behandelt?
Die Arbeit stellt die Erziehungsstile nach Lippitt und White vor und analysiert deren Übertragbarkeit auf Eriksons Stufenmodell. Sie untersucht, inwiefern die verschiedenen Stile die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben unterstützen oder behindern.
Welche Rolle spielt der kulturelle Kontext?
Die Arbeit untersucht den Einfluss kultureller Faktoren auf die Entwicklung der Persönlichkeit und die Erziehungsvorstellungen. Sie analysiert, wie soziokulturelle Kontexte die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben beeinflussen und die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Berücksichtigung kultureller Unterschiede diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Erik Homburger Erikson, Stufenmodell, psychosoziale Entwicklung, Diversität, Erziehungsvorstellungen, Erziehungsstile, Lippitt und White, Kultur, Soziale Arbeit, Lebenszyklus, Identitätskrise, Urvertrauen.
Gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Modell?
Ja, die Arbeit beinhaltet ein Kapitel, das sich kritisch mit den Grenzen und der Kritik an Eriksons Modell auseinandersetzt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Pädagogik und Psychologie, sowie für alle, die sich mit der psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und dem Einfluss kultureller Faktoren auf die Erziehung auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Lars B. Appel (Auteur), 2020, Diversität von Erziehungsvorstellungen am Beispiel vom Modell von Erik H. Erikson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282134