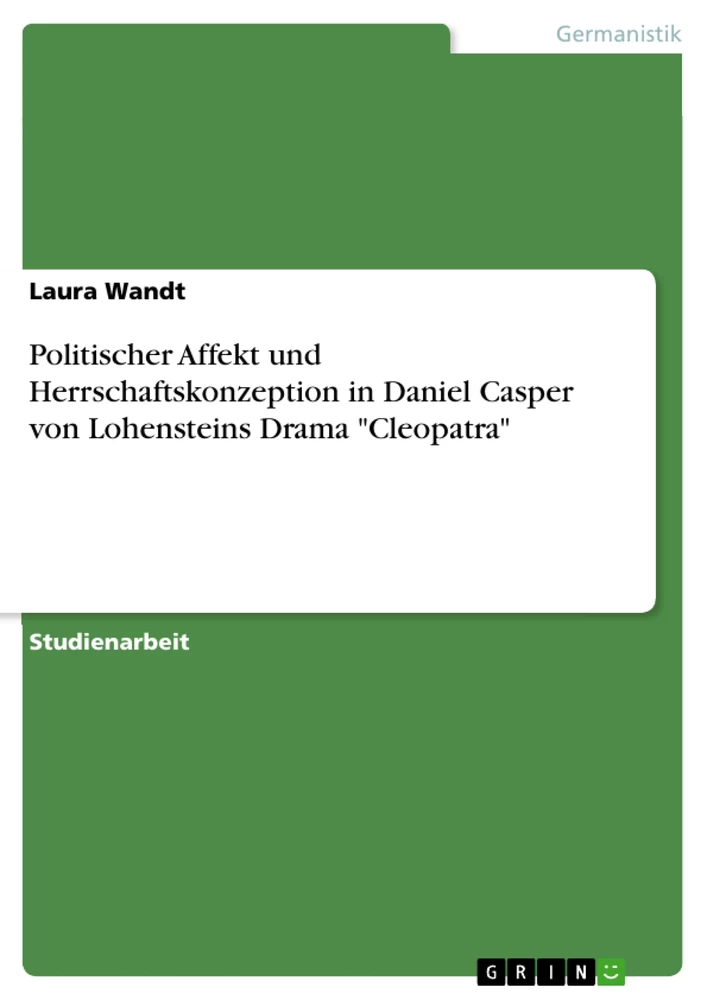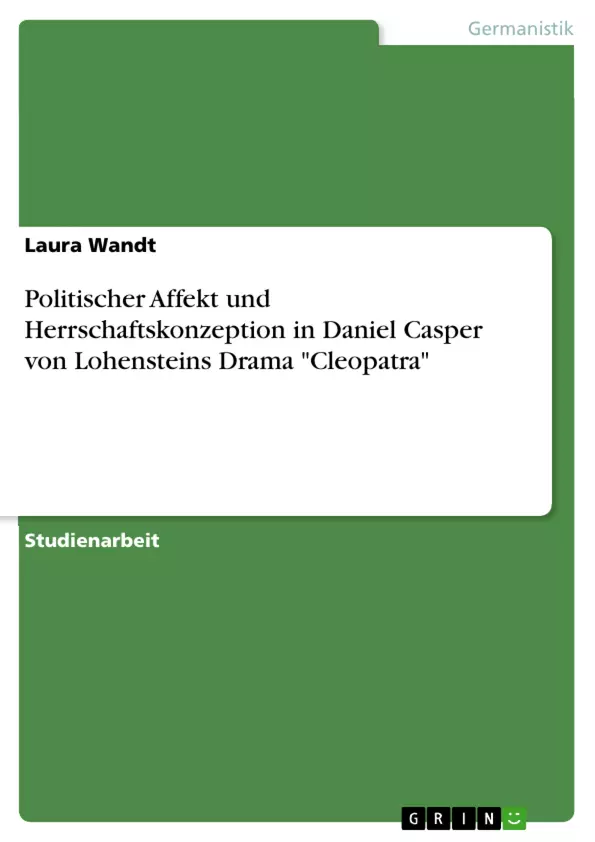Getreu ihrem Titel soll diese wissenschaftliche Arbeit die in "Cleopatra" dargestellte Herrschaftskonzeption und die des politischen Affekts untersuchen. In welcher Konstellation stehen die Figuren zueinander? Wie zeigen sich Affekte? Dies geschieht unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses der Affekte zum Begriff der Staatsklugheit. Hierfür wird dieser zunächst definiert. Nach einem kurzen staatstheoretischen Exkurs möchte ich auch das Konzept der Staatsräson erläutern.
Anschließend an diese theoretische Einführung widmet sich der Hauptteil der Arbeit der Konzeption der Herrschaft und der Affektdarstellung im Drama. Jeder Protagonist wird, unter Bezugnahme der vorangegangenen theoretischen Überlegungen, individuell betrachtet, sein Affektverhalten und seine politische Klugheit erläutert. In der Anschließenden Schlussbetrachtung werden nicht nur die Ergebnisse zusammengefasst, viel mehr soll ein ganzheitliches Bild des politischen Affekts in Cleopatra skizziert werden. Als Primärliteratur dient mir die Zweitfassung des Werkes von 1680.
Nachdem man das Daniel Casper von Lohensteins Drama "Cleopatra" rezipiert hat, ist man sich der vollen Tragweite der Symbolik bewusst. Hier spricht der Fluss Tiber, stellvertretend für das Römische Reich, Ägypten, verkörpert durch den Nil, an. Ein Ausspruch, der eine tatsächliche Begebenheit der Geschichtsschreibung beschreibt und höchstpolitisch ist. Ebenso lässt sich auch "Cleopatra" beschreiben. Als eines von Lohensteins Afrikanischen Trauerspielen beschäftigt es sich mit moralischen und politischen Überzeugungen und setzt diese in einen Kontext mit frühmodernem Gedankengut.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- STAATSKLUGHEIT
- EXKURS: MACHIAVELLI
- DEFINITION UND KONZEPT DER STAATSRÄSON
- HERRSCHAFTSKONZEPTION
- ANTONIUS UND CLEOPATRA IM HANDLUNGSTHEORETISCHEN LABOR
- ANTONIUS MACHT VS. LEIDENSCHAFT
- CLEOPATRA - VERSUCH DES MACHTERHALTS
- AFFEKTPOLITIK UND POLITISCHER AFFEKT IN CLEOPATRA
- AFFEKTBEFANGENHEIT BEI ANTONIUS
- CLEOPATRA - AFFEKTLOS?
- STAATSRÄSON AM BEISPIEL DES AFFEKTVERHALTENS DES AUGUSTUS
- ANTONIUS UND CLEOPATRA IM HANDLUNGSTHEORETISCHEN LABOR
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die in Lohensteins Drama "Cleopatra" dargestellte Herrschaftskonzeption und die des politischen Affekts zu untersuchen. Die Arbeit analysiert das Verhältnis der Figuren zueinander sowie die Manifestation von Affekten, insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Affekten und Staatsklugheit. Hierzu wird zunächst der Begriff der Staatsklugheit definiert und das Konzept der Staatsräson erläutert.
- Analyse der Herrschaftskonzeption in Lohensteins "Cleopatra"
- Untersuchung des politischen Affekts und seiner Darstellung im Drama
- Beziehung zwischen Affekten und Staatsklugheit
- Theoretische Grundlagen: Staatsräson und Affekttheorien des 17. Jahrhunderts
- Individuelle Betrachtung der Protagonisten und ihrer Affektverhaltensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Kontext des Dramas "Cleopatra" von Daniel Casper von Lohenstein. Dabei wird auf die Tragödienformel von Aristoteles und ihre Neuinterpretation im Barock eingegangen sowie die Bedeutung der Staatsräson und der Affekttheorien für das 17. Jahrhundert.
- Das Kapitel "Staatsklugheit" beleuchtet den Begriff der politischen Klugheit im Sinne der zeitgenössischen Klugheits- und Verhaltenslehre. Es wird ein Bezug zur "machiavellischen prudentia-Lehre" hergestellt und anhand von Dialogen aus dem Drama der Stellenwert der Staatsklugheit in Lohensteins Werk verdeutlicht.
- Im Exkurs "Machiavelli" wird die politische Philosophie Niccoló Machiavellis mit Bezug auf die Staatsräson-Theorie beleuchtet. Es wird deutlich, dass Lohensteins Konzept der Klugheit nicht nur von Machiavelli beeinflusst wurde, sondern auch von anderen "Lehrmeistern" des 17. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Staatsklugheit, Staatsräson, politische Klugheit, Affekt, Affektpolitik, Herrschaftskonzeption, Tragödie, Barock, Daniel Casper von Lohenstein, "Cleopatra", Machiavelli.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Analyse von Lohensteins "Cleopatra"?
Die Arbeit untersucht die Herrschaftskonzeption und die Darstellung des politischen Affekts unter besonderer Berücksichtigung der Staatsklugheit im Drama.
Wie wird der Begriff "Staatsräson" in der Arbeit verwendet?
Staatsräson wird als theoretisches Konzept erläutert, das das Handeln der Herrscherfiguren im Hinblick auf Machterhalt und politische Notwendigkeit leitet.
Welche Rolle spielen Affekte für die Figur des Antonius?
Bei Antonius wird eine starke "Affektbefangenheit" analysiert, wobei seine Leidenschaft oft im Konflikt mit seiner politischen Macht und Klugheit steht.
Wie unterscheidet sich Cleopatra in ihrem Affektverhalten von anderen Figuren?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob Cleopatra "affektlos" agiert oder ob sie ihre Emotionen strategisch für den Machterhalt instrumentalisiert.
Welchen Einfluss hatte Machiavelli auf das Werk?
In einem Exkurs wird die machiavellische Prudentia-Lehre beleuchtet, die Lohensteins Konzept der Staatsklugheit und des Herrscherhandelns maßgeblich beeinflusst hat.
Was symbolisieren Tiber und Nil im Drama?
Der Tiber steht stellvertretend für das Römische Reich, während der Nil Ägypten verkörpert; ihr Dialog spiegelt die hochpolitischen Spannungen der Handlung wider.
- Citar trabajo
- Laura Wandt (Autor), 2021, Politischer Affekt und Herrschaftskonzeption in Daniel Casper von Lohensteins Drama "Cleopatra", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282248