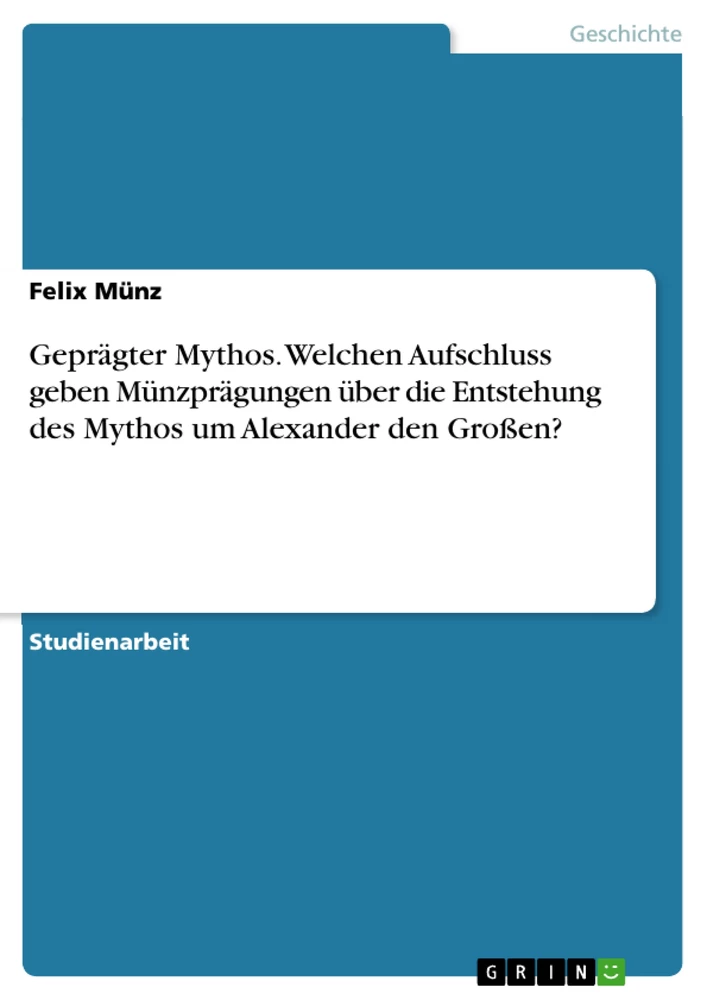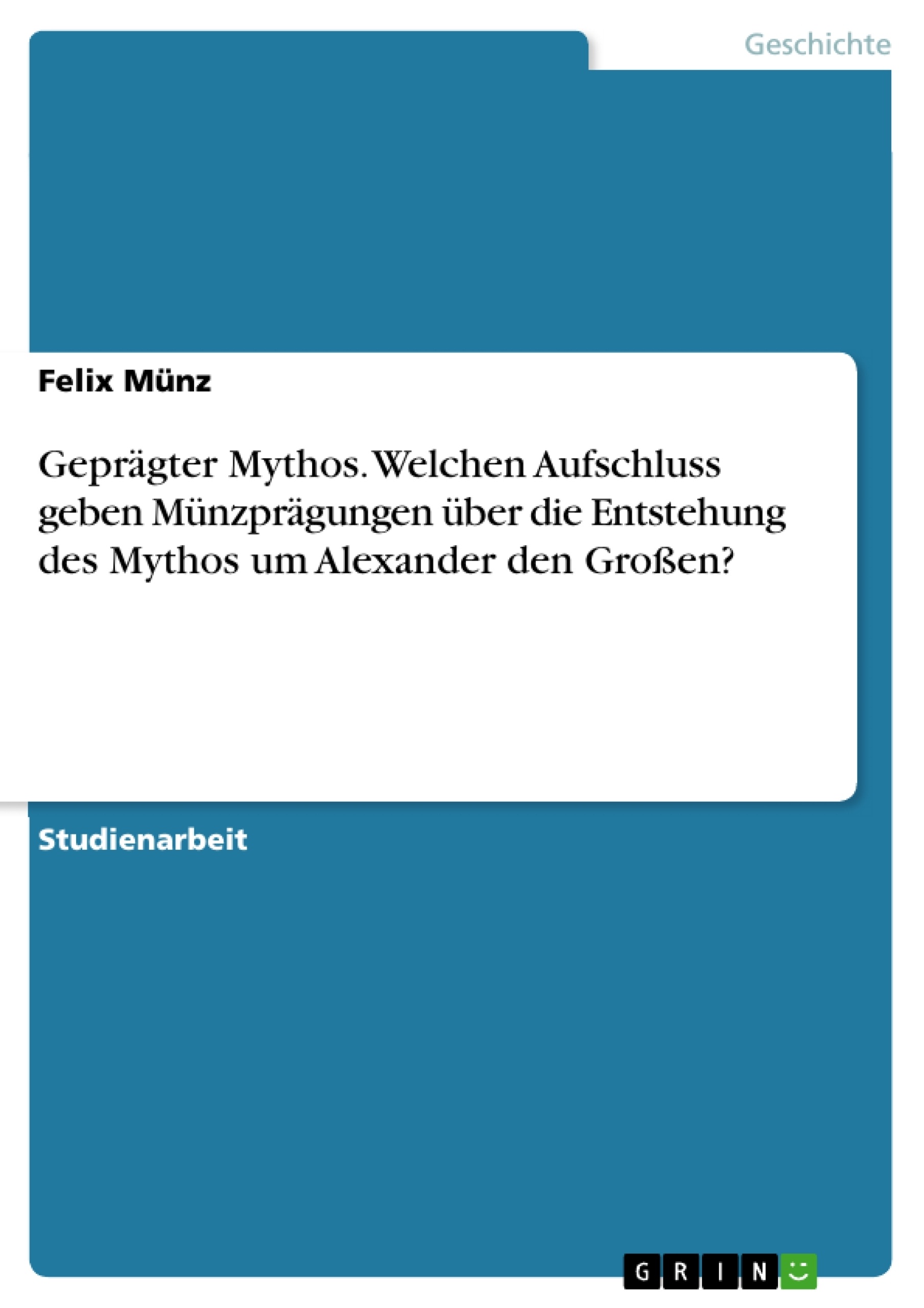Alexander der Große war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Antike, dessen Mythos die Geschichte überdauerte. Münzen sind heute wichtige Überreste aus der Zeit Alexanders des Großen. Deren Münzprägungen portraitieren das Leben Alexanders des Großen, sie berichten von seiner Geschichte. Doch lassen sich auch Alexanders Etappen hin zu einem Mythos anhand der Münzprägungen ausmachen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Münzprägung unter Alexander
- 2. Auswertung der Münzen
- 2.1 Alexander III., Siegesmedaille, 326-223 vor Christus
- 2.2 Ptolemaios I., Tetradrachme, um 316 vor Christus
- 2.3 Lysimachos, Tetradrachme, 297-281 vor Christus
- 3. Geprägte Erinnerungskultur
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Münzprägungen aus der Zeit Alexanders des Großen und der Diadochen Aufschluss über die Entstehung seines Mythos geben. Die Analyse fokussiert sich auf die ikonografische Darstellung Alexanders und seiner Taten auf ausgewählten Münzen und vergleicht diese mit den Berichten antiker Autoren.
- Analyse der Münzprägungen als Quelle zur Rekonstruktion der Erinnerungskultur um Alexander den Großen.
- Untersuchung der Entwicklung der Selbstdarstellung Alexanders auf Münzen im Laufe seiner Herrschaft.
- Vergleich der ikonografischen Darstellung Alexanders auf Münzen mit den Beschreibungen in antiken Quellen.
- Interpretation der Symbolik und der Botschaft der ausgewählten Münzprägungen.
- Beurteilung des Beitrags der Münzprägungen zur Mythenbildung um Alexander.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt Alexander den Großen als schillernde Persönlichkeit der Antike vor, dessen Mythos bis heute fortdauert. Sie erwähnt das Streben Alexanders nach Weltherrschaft und seinen Alexanderzug, der zu einem kurzlebigen, aber weitreichenden Reich führte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle von Münzprägungen als stille Zeitzeugen und untersucht, ob sich Alexanders Weg zum Mythos anhand dieser Quellen nachvollziehen lässt. Die Einleitung führt kurz die relevanten Forschungsarbeiten zur Münzprägung im Hellenismus an, um den Kontext der vorliegenden Arbeit zu etablieren.
II. Hauptteil: Der Hauptteil analysiert die Münzprägungen unter Alexander dem Großen und untersucht drei ausgewählte Münzen im Detail. Er beginnt mit einer Betrachtung der Münzprägung unter Alexanders Herrschaft, die zunächst die Münzen seines Vaters weiterführte, bevor Alexander nach dem Sieg bei Issos eigene Prägungen in Auftrag gab. Die Analyse der drei ausgewählten Münzen – darunter eine Siegesmedaille – fokussiert auf die ikonografischen Darstellungen und deren Interpretation im Kontext der historischen Ereignisse und der Berichte antiker Autoren wie Curtius Rufus und Arrian. Der Vergleich zwischen den Münzen und den schriftlichen Quellen soll Aufschluss über die Entwicklung des Mythos um Alexander geben und den Einfluss der Prägungen auf die Erinnerungskultur beleuchten.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Hellenismus, Münzprägung, Diadochen, Mythosbildung, Erinnerungskultur, Ikonografie, Alexanderzug, antike Quellen, Selbstdarstellung, Siegesmedaille, Tetradrachme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Münzprägungen Alexanders des Großen und der Diadochen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht, inwieweit Münzprägungen aus der Zeit Alexanders des Großen und seiner Nachfolger (Diadochen) Aufschluss über die Entstehung seines Mythos geben. Der Fokus liegt auf der ikonografischen Darstellung Alexanders und seiner Taten auf ausgewählten Münzen und deren Vergleich mit antiken schriftlichen Quellen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Münzprägungen als Quelle zur Rekonstruktion der Erinnerungskultur um Alexander den Großen. Sie untersucht die Entwicklung seiner Selbstdarstellung auf Münzen im Laufe seiner Herrschaft und vergleicht die ikonografische Darstellung mit Beschreibungen in antiken Quellen. Ziel ist die Interpretation der Symbolik und Botschaft der Münzen und die Beurteilung ihres Beitrags zur Mythenbildung um Alexander.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Die Einleitung stellt Alexander und seinen Alexanderzug vor und beschreibt die Bedeutung der Münzprägungen als historische Quellen. Der Hauptteil analysiert detailliert die Münzprägung unter Alexander und drei ausgewählte Münzen (eine Siegesmedaille Alexanders III., eine Tetradrachme Ptolemaios I. und eine Tetradrachme Lysimachos), wobei ikonografische Darstellungen im Kontext historischer Ereignisse und antiker Berichte (z.B. Curtius Rufus und Arrian) interpretiert werden. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Münzen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert drei spezifische Münzen: eine Siegesmedaille Alexanders III. (326-223 v. Chr.), eine Tetradrachme Ptolemaios I. (um 316 v. Chr.) und eine Tetradrachme Lysimachos (297-281 v. Chr.). Die ikonografischen Darstellungen auf diesen Münzen bilden einen zentralen Bestandteil der Analyse.
Welche Quellen werden neben den Münzen herangezogen?
Neben den Münzprägungen werden antike schriftliche Quellen, wie die Berichte von Curtius Rufus und Arrian, herangezogen, um die ikonografischen Darstellungen auf den Münzen zu kontextualisieren und die Entwicklung des Mythos um Alexander zu rekonstruieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Alexander der Große, Hellenismus, Münzprägung, Diadochen, Mythosbildung, Erinnerungskultur, Ikonografie, Alexanderzug, antike Quellen, Selbstdarstellung, Siegesmedaille, Tetradrachme.
- Quote paper
- Felix Münz (Author), 2022, Geprägter Mythos. Welchen Aufschluss geben Münzprägungen über die Entstehung des Mythos um Alexander den Großen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282267