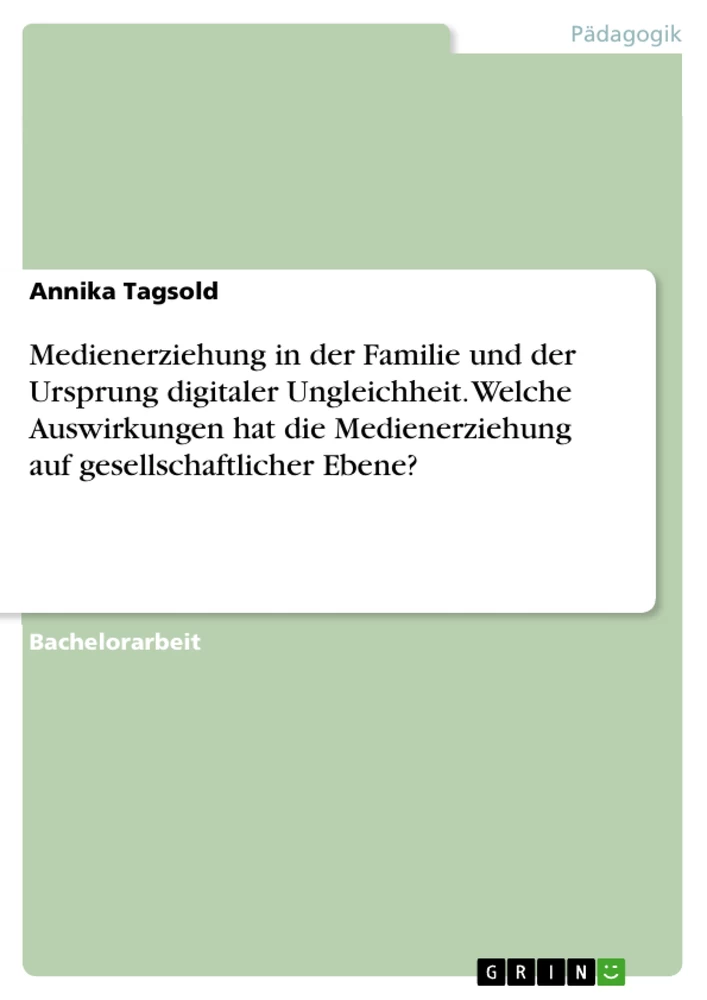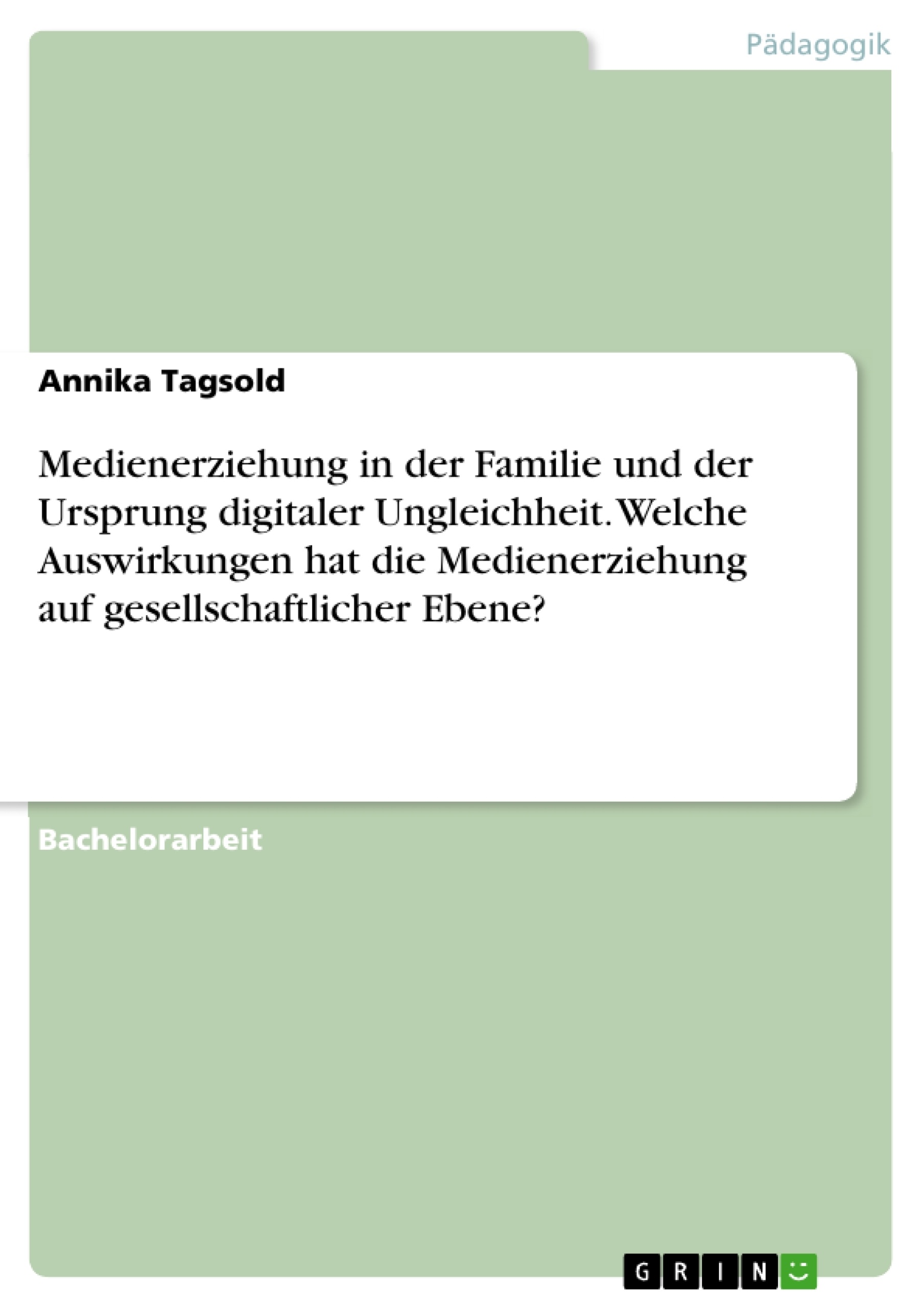In der Folge „Arkangel“ der Science-Fiction Serie „Black Mirror“ bekommt ein Mädchen einen Chip unter die Kopfhaut gesetzt, nachdem sie der Mutter beim Spielen einmal weggelaufen war und daraufhin diese ihre Tochter verzweifelt suchen musste. Durch diesen Chip kann die Alleinerziehende ihr Kind über Tablet lokalisieren, dessen Gefühle steuern und sogar die Umwelt aus Sicht ihrer Tochter mitbeobachten. Der Produzent Charlie Brooker wirft einen Blick in die Zukunft, wo Technik und Medien so stark mit unserem Alltagsleben verschmolzen sind, dass durch Medien sogar Handlungen und Emotionen des eigenen Kindes kontrolliert werden können. Werden in Zukunft Medien so in der Erziehung genutzt? Zugegebenermaßen ist dieses Zukunftsszenario extrem, dennoch wirft es bei dem Zuschauenden die Frage auf, inwieweit Umgang und Nutzung der Medien in der Erziehung schon heute eine Rolle spielen und welche Auswirkungen Medienerziehung auf gesellschaftlicher Ebene hat. Genau diese Fragen greift die Arbeit auf und gibt einen umfassenden Einblick in die Medienerziehung von Familien.
Dazu werden im ersten Kapitel wichtige Begriffe erläutert, Medienerziehung und Mediensozialisation sowie die Aufgaben und Funktionen von Medienpädagogik werden beschrieben. Der Begriff der Medienkompetenz wird aus Sicht von zwei Ansätzen beschrieben und dabei kritisch hinterfragt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Medien in Familien in Deutschland. Es wird erläutert, wie Familien mit Mediengeräten ausgestattet sind und welchen Stellenwert sie im Alltag haben. Anhand der Darstellung von Studienergebnissen zum Thema Medien werden Nutzung und Umgang mit Medien in den Familien beschrieben. Der Fokus liegt auf der Rolle der Eltern in der Medienerziehung, weshalb sich im Weiteren damit auseinandergesetzt wird, wie Medienerziehung von Eltern gestaltet wird und wie sie als Adressaten von medienpädagogischen Angeboten gelten.
Im dritten Teil der Arbeit rückt die gesellschaftliche Ebene in Bezug auf Medien in den Mittelpunkt. Es wird dargestellt, wie Medien einen gesellschaftlich sozialen Wandel bewirken und welche Folgen sich daraus ergeben. Das Phänomen der Digitalen Ungleichheit, begründet auf der Theorie von Nicole Zilien, wird ausführlich beschrieben. Darüber hinaus werden Überlegungen ausgeführt, wie der digitale Wandel sich im Familienleben spiegelt und welche Unterstützung Familien von politischer Seite erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle der Medien im pädagogischen Kontext
- Begriffsbestimmung von Medien, Medienerziehung, Mediensozialisation und Medienkompetenz
- Aufgaben und Funktionen der Sozialen Arbeit in der Medienpädagogik
- Zwischenfazit
- Medien und Familie
- Familie in Deutschland
- Nutzung (neuer) Medien in der Familie
- Erziehung, Umgang und Auswirkungen von Medien
- Eltern als Zielgruppe von medienpädagogischen Angeboten
- Zwischenfazit
- Mediatisierung der Gesellschaft und die Entstehung neuer Ungleichheitsformen
- Digitale Ungleichheit in der Wissens- und Informationsgesellschaft
- Herausforderungen digitalen Wandels im Familienleben
- Zwischenfazit
- Vorstellung von ELTERNTALK
- Aktueller Stand
- Ablauf einer Gesprächsrunde
- Theoretischer Hintergrund und Herausforderungen
- Wirkungseffekte des Projekts
- Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung für die Untersuchung
- Empirische Untersuchung anhand von ELTERNTALK
- Qualitative Untersuchung
- Begründung der Methodenwahl
- Merkmale und Durchführung der qualitativen Untersuchung
- Definition der Analysetechnik
- Analyse des Materials
- Definierung der transferunterstützenden Faktoren
- Medienerziehung als Ursprung Digitaler Ungleichheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Medienerziehung in der Familie und befasst sich mit der Frage, ob sich durch diese digitale Ungleichheit entwickelt. Die Arbeit analysiert die Nutzung von Medien aus soziologischer Perspektive, insbesondere auf Mikro-, Meso- und Makroebene. Das zentrale Ziel der Arbeit besteht darin, transferunterstützende Faktoren zu identifizieren, die die Umsetzung von Verhaltens- und Einstellungsänderungen, die durch die Teilnahme an einem medienpädagogischen Angebot angeregt wurden, in der alltäglichen Medienerziehung erleichtern. Die Forschungsfrage wird mithilfe von leitfadengestützten Interviews mit Teilnehmenden des Projekts ELTERNTALK untersucht.
- Einflüsse und Gestaltung von Medienerziehung in der Familie
- Auswirkungen von Medienerziehung aus soziologischer Sicht
- Die Rolle der Eltern in der Medienerziehung
- ELTERNTALK als Beispiel für medienpädagogisches Angebot für Eltern
- Transferunterstützende Faktoren für die Umsetzung von Verhaltens- und Einstellungsänderungen in der alltäglichen Medienerziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die Forschungsfrage sowie die Relevanz der Thematik.
- Die Rolle der Medien im pädagogischen Kontext: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffen Medien, Medienerziehung, Mediensozialisation und Medienkompetenz und beleuchtet die Aufgaben und Funktionen der Sozialen Arbeit im Bereich der Medienpädagogik.
- Medien und Familie: Das Kapitel befasst sich mit dem Thema Mediennutzung in der Familie, einschließlich der Bedeutung der Familie in Deutschland und den Auswirkungen von Medien auf die Erziehung und den Umgang mit Medien.
- Mediatisierung der Gesellschaft und die Entstehung neuer Ungleichheitsformen: Dieses Kapitel untersucht die digitale Ungleichheit in der Wissens- und Informationsgesellschaft und die Herausforderungen, die der digitale Wandel für Familienleben und die Medienerziehung mit sich bringt.
- Vorstellung von ELTERNTALK: Hier wird das medienpädagogische Angebot ELTERNTALK vorgestellt und der theoretische Hintergrund, die Zielsetzung und die Umsetzung des Projekts erläutert.
- Empirische Untersuchung anhand von ELTERNTALK: Dieses Kapitel beschreibt die qualitative Forschungsmethode und die Analysetechnik, die für die Untersuchung der transferunterstützenden Faktoren in der Medienerziehung angewandt wurden.
Schlüsselwörter
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Medienerziehung, digitale Ungleichheit, Mediennutzung, Familie und den Auswirkungen der Mediatisierung auf die Gesellschaft. Darüber hinaus werden Aspekte der Sozialen Arbeit im Bereich der Medienpädagogik und die Rolle von Eltern in der Medienbildung behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht digitale Ungleichheit in der Familie?
Digitale Ungleichheit entsteht durch unterschiedliche Zugänge zu Medien, aber vor allem durch die Art der Nutzung und die medienpädagogische Begleitung durch die Eltern.
Was ist das Projekt ELTERNTALK?
ELTERNTALK ist ein medienpädagogisches Angebot, bei dem sich Eltern in moderierten Gesprächsrunden über Erziehungsthemen und Mediennutzung im Alltag austauschen.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz der Eltern?
Die Medienkompetenz der Eltern ist entscheidend dafür, wie Kinder den Umgang mit digitalen Geräten erlernen und welche Risiken oder Chancen sie dabei wahrnehmen.
Was sind transferunterstützende Faktoren in der Medienerziehung?
Dies sind Bedingungen, die es Eltern erleichtern, gelernte pädagogische Inhalte tatsächlich im stressigen Familienalltag umzusetzen, wie z.B. soziale Unterstützung oder klare Regeln.
Wie wirkt sich die Mediatisierung auf die Gesellschaft aus?
Die Mediatisierung verändert soziale Beziehungen und Kommunikationsformen tiefgreifend und kann bestehende soziale Ungleichheiten durch unterschiedliches Medienwissen verstärken.
- Quote paper
- Annika Tagsold (Author), 2019, Medienerziehung in der Familie und der Ursprung digitaler Ungleichheit. Welche Auswirkungen hat die Medienerziehung auf gesellschaftlicher Ebene?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282747