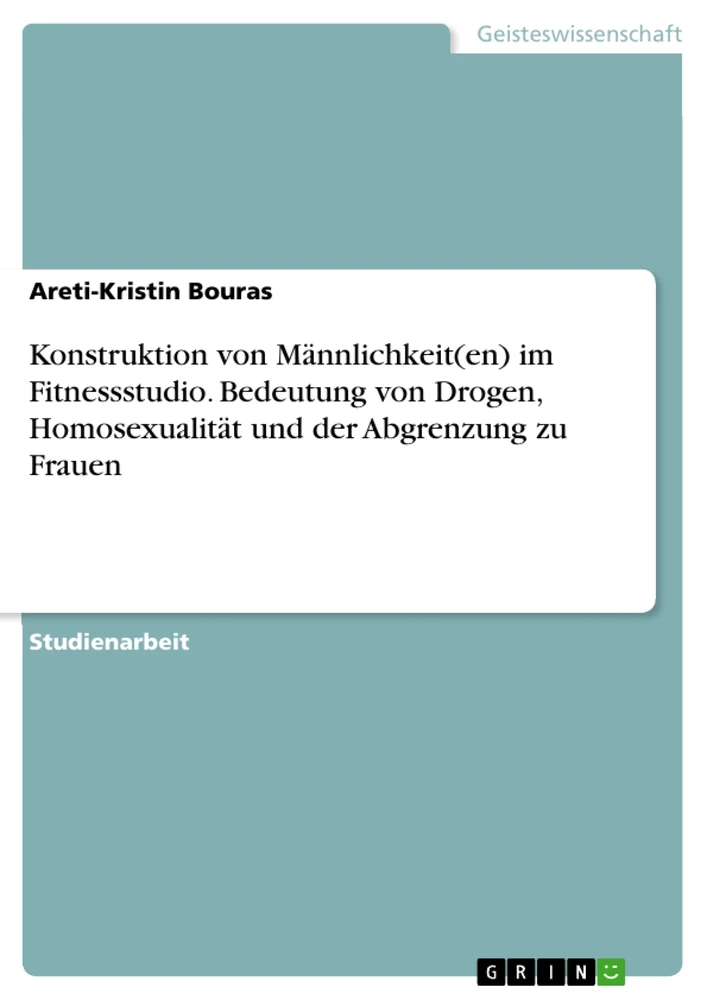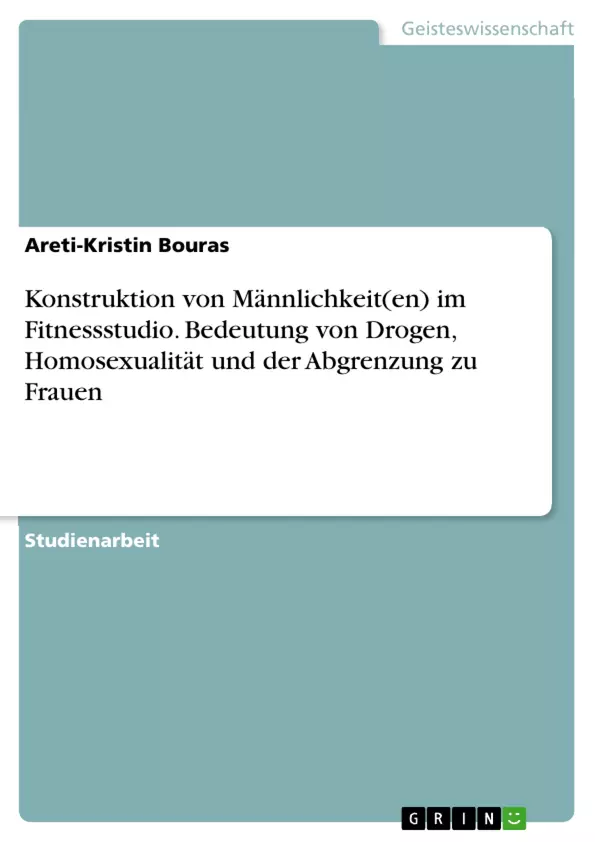Diese Arbeit wird der Frage danach nachgehen, wie Männlichkeit im Fitnessstudio hergestellt und reproduziert wird. Dabei soll auch gezeigt werden, welche Aspekte zur Konstruktion von Männlichkeit beitragen und inwiefern diese im Fitnessstudio erkennbar sind. Um diese Frage beantworten zu können, wurde eine literature review durchgeführt mit Publikationen aus den Jahren 1996 bis 2022, die sich alle mit der Konstruktion von Männlichkeit im Kontext von Fitness(-studios) beschäftigen. In der verwendeten Literatur geht es zumeist um die Darstellung von Studien, die in Fitnessstudios durchgeführt wurden und bei denen zumeist männlich gelesene Personen zu ihren Beweggründen befragt wurden, warum sie das Studio besuchen.
Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich so aufgebaut, dass es zunächst eine Einführung in Körperbilder, soziale Kontrolle und Fitness im Allgemeinen geben wird. Anschließend wird sich auf männliche Körperbilder fokussiert. Bei der Analyse der Literatur sind vier Unterpunkte herausgefiltert worden, anhand derer die Konstruktion von Männlichkeit verdeutlicht werden soll. Bei ihnen handelt es sich um Drogen, performance-enhancing substances (PES) und Bodybuilding, Homosexualität und Homoerotik, Deindustrialisierung und Moderne sowie Homosoziale Netzwerke und die Abgrenzung zu Frauen. Am Ende schließt sich noch ein Fazit an, in dem auch Hinweise auf zukünftige Forschung gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Körperbilder, soziale Kontrolle und Fitness
- Männliche Körper
- Konstruktion von Männlichkeit im Fitnessstudio.
- Drogen, PES und Bodybuilding ...
- Homosexualität und Homoerotik.
- Deindustrialisierung und Moderne...
- Homosoziale Netzwerke und die Abgrenzung zu Frauen ..........\li>
- Fazit.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Männlichkeit im Fitnessstudio konstruiert und reproduziert wird. Sie analysiert die Faktoren, die zur Konstruktion von Männlichkeit beitragen und wie diese im Fitnessstudio erkennbar sind. Die Arbeit basiert auf einer Literaturübersicht von Publikationen aus den Jahren 1996 bis 2022, die sich mit der Konstruktion von Männlichkeit im Kontext von Fitnessstudios beschäftigen.
- Körperbilder und soziale Kontrolle im Fitnessstudio
- Die Rolle von Drogen, PES und Bodybuilding bei der Konstruktion von Männlichkeit
- Die Bedeutung von Homosexualität und Homoerotik im Fitnessstudio
- Der Einfluss von Deindustrialisierung und Moderne auf die Konstruktion von Männlichkeit
- Homosoziale Netzwerke und die Abgrenzung zu Frauen im Fitnessstudio
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie den Aufbau der Arbeit vor. Das zweite Kapitel beleuchtet Körperbilder, soziale Kontrolle und Fitness im Allgemeinen. Es werden die Theorien von Michel Foucault und Jeremy Bentham zu Disziplinierung und Überwachung des Körpers vorgestellt sowie die Bedeutung des Körpers für die Identität und das Selbstbild der Individuen.
Das dritte Kapitel fokussiert auf männliche Körperbilder und die Idealisierung des trainierten Körpers in der Fitnessstudiokultur. Es wird untersucht, wie der Körper in der Fitnessstudiokultur als ästhetisches und erotisches Objekt wahrgenommen wird und welche Geschlechterkonstruktionen damit einhergehen.
Das vierte Kapitel analysiert die Konstruktion von Männlichkeit im Fitnessstudio anhand von vier Unterpunkten: Drogen, PES und Bodybuilding, Homosexualität und Homoerotik, Deindustrialisierung und Moderne sowie Homosoziale Netzwerke und die Abgrenzung zu Frauen.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt Hinweise auf zukünftige Forschungsrichtungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Konstruktion von Männlichkeit im Fitnessstudio, Körperbildern, sozialer Kontrolle, Fitnesskultur, Drogen, PES, Bodybuilding, Homosexualität, Homoerotik, Deindustrialisierung, Moderne, homosozialen Netzwerken, Abgrenzung zu Frauen und Genderidentität. Die Arbeit untersucht, wie diese Themen zusammenhängen und welche Rolle sie bei der Konstruktion von Männlichkeit im Fitnessstudio spielen.
- Quote paper
- Areti-Kristin Bouras (Author), 2022, Konstruktion von Männlichkeit(en) im Fitnessstudio. Bedeutung von Drogen, Homosexualität und der Abgrenzung zu Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283017