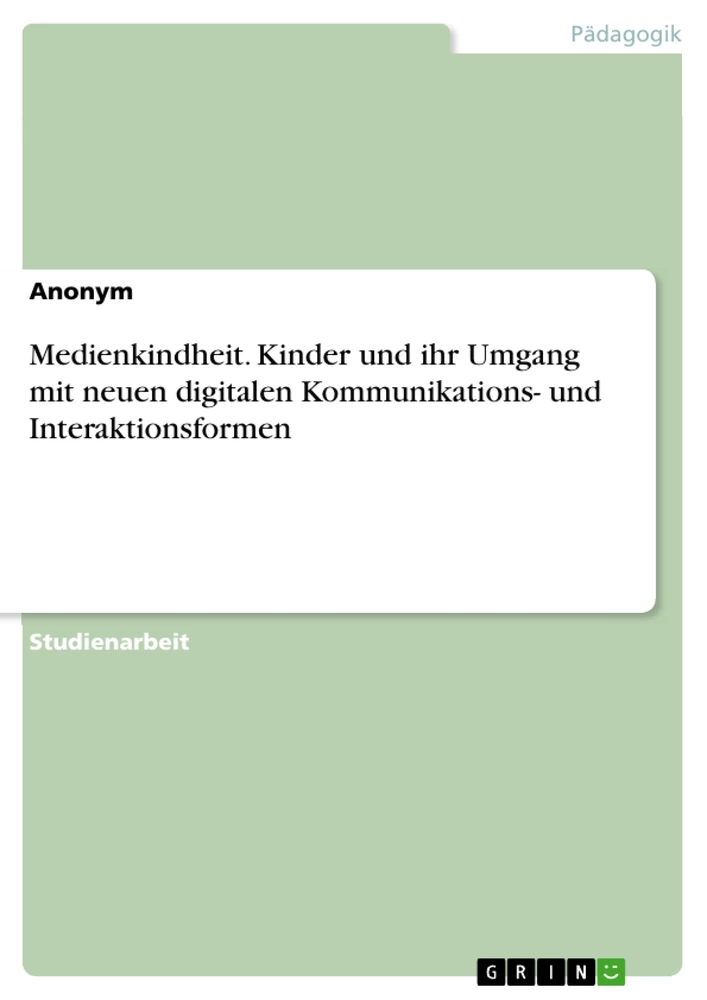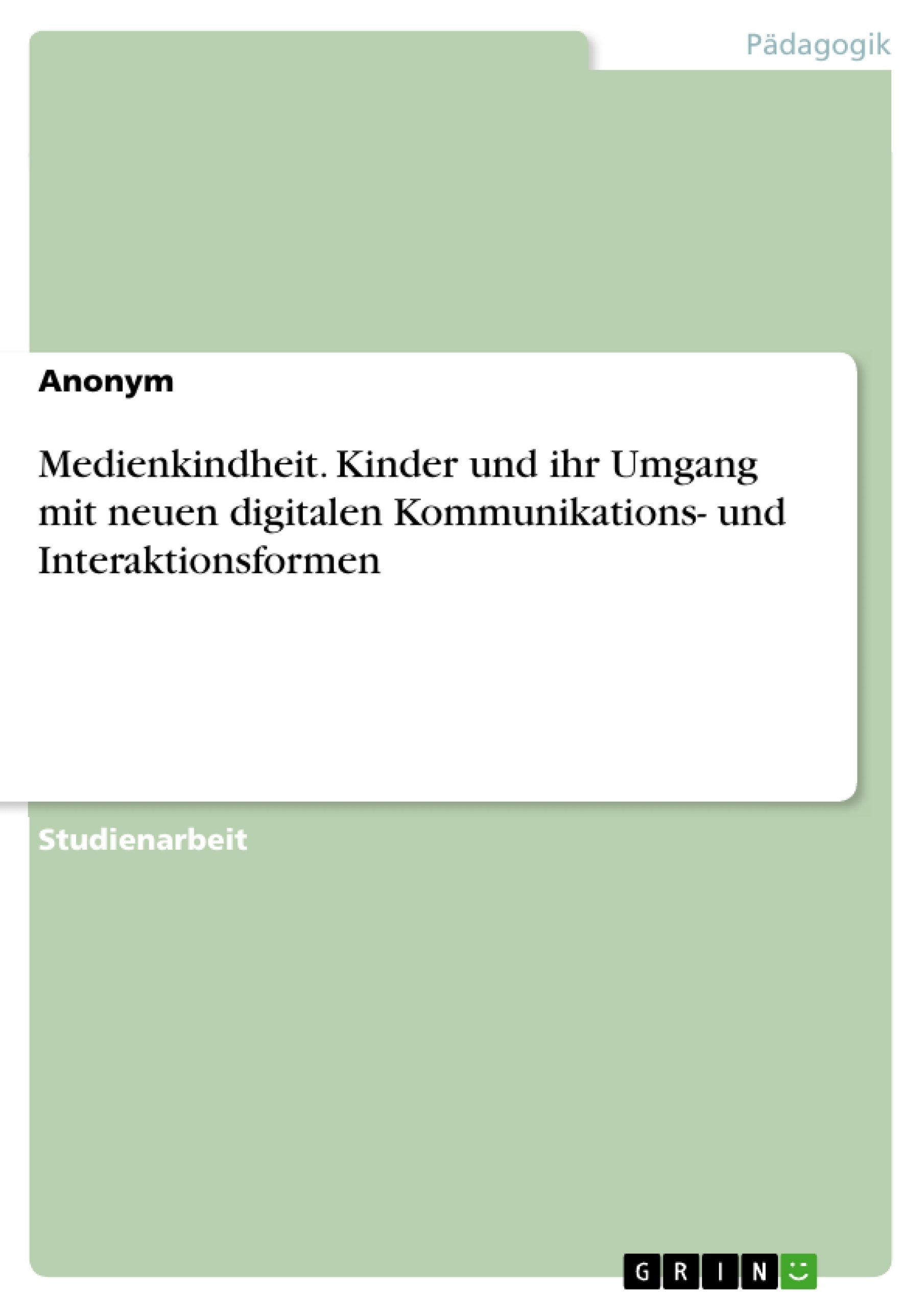In dieser Arbeit geht es zunächst um die Erläuterung des Begriffs der Medienkindheit. Anschließend wird die Stellung der Medien in der Lebenswelt von Kindern thematisiert. Hierbei geht es zu aller erst, um verschiedene Positionen/Grundhaltungen in der Mediennutzung für Kinder. Dann folgt eine kurze Erklärung von Kindermedien. In Folge dessen wird die KIM-Studie 2016 erläutert, um den Stellenwert von Medien in der Lebenswelt von Kindern darzustellen.
In diesem Sinne werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie, angesichts der Medienausstattung, der Medienbeschäftigung, Fernseher und YouTube, der Internetnutzung, Handy und Smartphones und digitalen Spielen dargestellt. Im nächsten Kapitel geht es um eine sich wandelnde Kindheit. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der mediatisierten Kindheit und den damit einhergehenden Entgrenzungen. Im fünften Kapitel wird die Medienerziehung erklärt. Es werden Schwerpunkte und mögliche Konzepte in den Bereichen der Familie, des Kindergartens, der Schule und des Sachunterrichts herausgearbeitet.
Im Kapitel der Medienerziehung in der Familie wird der Fokus auf mögliche medienerzieherische Aufgaben der Eltern gelegt, um die Chancen und Risiken der neuen digitalen Interaktionsformen zu erkennen. Im Bereich der Medienerziehung im Kindergarten geht es darum, was Erzieher:innen verbessern können. Das Kapitel der Medienerziehung in der Schule fokussiert sich auf zu bewältigende Aufgaben in der Schule, um die Medien integrativ zu nutzen. Im Bereich der Medienerziehung des Sachunterrichts werden primär Kompetenzziele des Perspektivrahmens Sachunterricht genannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienkindheit
- Stellung der Medien in der Lebenswelt von Kindern
- Kindermedien
- Medienausstattung und Medienbesitz
- Freizeitaktivitäten und Medienbeschäftigung
- Fernsehen und YouTube
- Internetnutzung
- Handy und Smartphone
- Digitale Spiele
- Veränderte Kindheit
- mediatisierte Kindheit und Entgrenzung
- Medienerziehung
- Medienerziehung in der Familie
- Medienerziehung im Kindergarten
- Medienerziehung in der Schule
- Im Sachunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der medialen Lebenswelt von Kindern und analysiert den Einfluss von digitalen Medien auf deren Entwicklung. Sie untersucht die verschiedenen Positionen in der Mediennutzung für Kinder, beleuchtet die Bedeutung von Medien in der Kindheit und erörtert Herausforderungen und Chancen der Medienerziehung in unterschiedlichen Kontexten.
- Einfluss von Medien auf die kindliche Entwicklung
- Verschiedene Positionen zur Mediennutzung für Kinder
- Stellung der Medien in der Lebenswelt von Kindern
- Herausforderungen und Chancen der Medienerziehung
- Veränderte Kindheit im Kontext der digitalen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Medienkindheit" dar und skizziert die Entwicklung der digitalen Medien und deren Einfluss auf die Lebenswelt von Kindern. Sie führt die wichtigsten Kapitelthemen ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
- Medienkindheit: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der "Medienkindheit" und untersucht, wie Medien den Alltag von Kindern prägen. Es beleuchtet die frühzeitige Begegnung mit Medien, die Rolle von Vorbildfunktionen und die Auswirkungen von digitalen Medien auf die kindliche Entwicklung.
- Stellung der Medien in der Lebenswelt von Kindern: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Positionen in der Mediennutzung für Kinder. Es beleuchtet die kulturpessimistische, die medieneuphorische und die kritisch-optimistische Position, um die vielschichtigen Perspektiven auf die Mediensozialisation von Kindern zu verdeutlichen.
- Veränderte Kindheit: Dieses Kapitel fokussiert auf die Veränderungen in der Kindheit, die durch die zunehmende Digitalisierung und die damit einhergehende "mediatisierte Kindheit" entstehen. Es untersucht die Entgrenzungen, die durch die Mediennutzung entstehen, und analysiert die Auswirkungen auf die Lebenswelt von Kindern.
- Medienerziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Medienerziehung in verschiedenen Kontexten. Es betrachtet die medienerzieherischen Aufgaben von Eltern, Erzieher_innen und Lehrkräften und beleuchtet die Bedeutung der Integration von Medien in den Bildungsprozess. Es werden verschiedene Konzepte der Medienerziehung vorgestellt und die Bedeutung von Kompetenzzielen im Sachunterricht erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Medienkindheit, digitale Medien, Mediensozialisation, Medienerziehung, Kindheit, Lebenswelt, Interaktion, Kommunikation, digitale Spielwelten, empirische Forschung, KIM-Studie, Bildung, Schule, Kindergarten, Familie, Sachunterricht und Kompetenzziele.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Medienkindheit“?
Medienkindheit beschreibt das Aufwachsen von Kindern in einer Welt, die massiv von digitalen Medien geprägt ist. Medien sind heute ein integraler Bestandteil der kindlichen Lebenswelt und beeinflussen die Sozialisation von Beginn an.
Was sind die zentralen Ergebnisse der KIM-Studie 2016?
Die KIM-Studie zeigt den hohen Stellenwert von Fernsehen, YouTube, Smartphones und digitalen Spielen im Alltag von Kindern. Sie belegt zudem eine zunehmende Medienausstattung in den Kinderzimmern und eine frühe Internetnutzung.
Was bedeutet „Entgrenzung“ im Kontext der mediatisierten Kindheit?
Entgrenzung meint das Verschwimmen der Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt sowie zwischen privatem und öffentlichem Raum durch die ständige Verfügbarkeit digitaler Kommunikation und Information.
Welche Aufgaben haben Eltern bei der Medienerziehung?
Eltern fungieren als Vorbilder und Begleiter. Ihre Aufgabe ist es, Chancen und Risiken digitaler Medien zu erkennen, Regeln für die Nutzung aufzustellen und Kindern einen reflektierten Umgang mit Inhalten zu vermitteln.
Wie kann der Kindergarten die Medienerziehung unterstützen?
Erzieher können Medien integrativ nutzen, um die Medienkompetenz spielerisch zu fördern. Ziel ist es, Kinder nicht nur zu Konsumenten, sondern zu aktiven Gestaltern im Umgang mit digitalen Werkzeugen zu machen.
Welche Rolle spielt der Sachunterricht bei der Vermittlung von Medienkompetenz?
Im Sachunterricht werden Kompetenzziele des Perspektivrahmens genutzt, um Kindern technisches Verständnis und eine kritische Reflexion über die Wirkung von Medien in der Gesellschaft zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Medienkindheit. Kinder und ihr Umgang mit neuen digitalen Kommunikations- und Interaktionsformen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283048