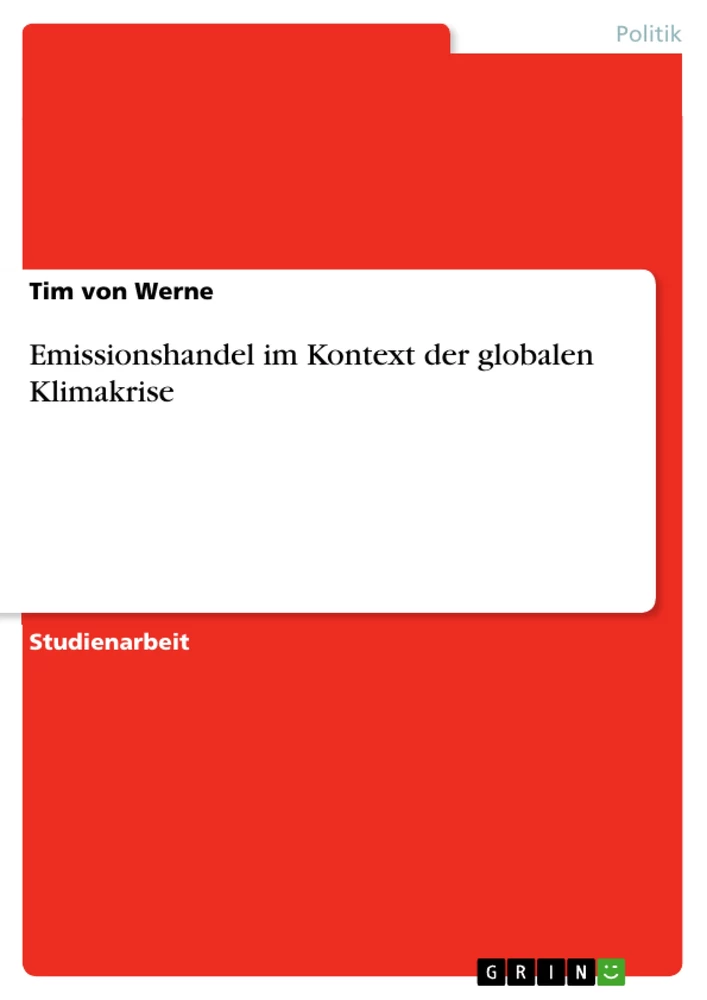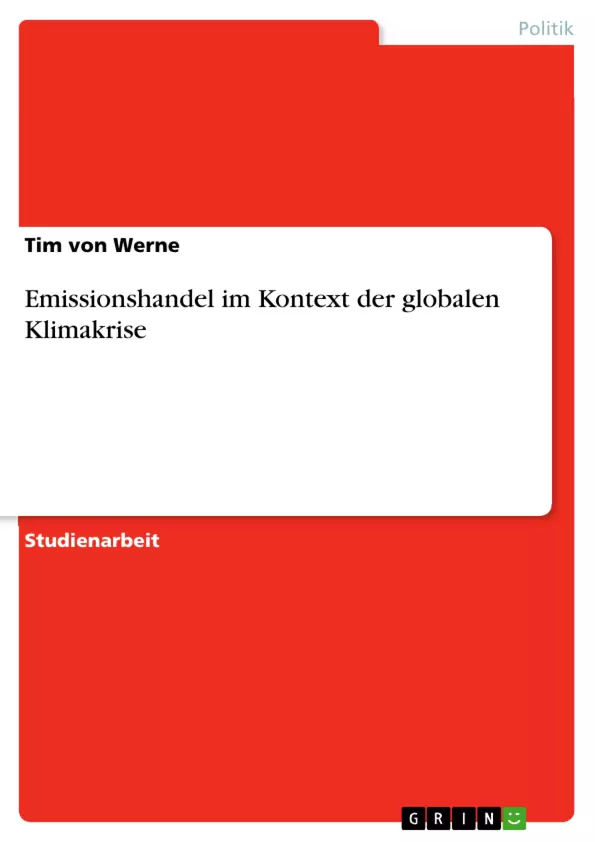Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist es, zu klären, ob die Einführung eines neuen Marktes, auf dem Rechte zum CO2-Ausstoß gehandelt werden, tatsächlich zu den zielführenden Rettungsmaßnahmen in der Klimakrise zählt. Dazu werden sowohl positive wie auch negative Aspekte herausgearbeitet. Zum Einstieg wird zunächst die Entstehung der Emissionshandelssysteme genauer betrachtet. Dazu zählt unter anderem die Zielsetzung der Mechanismen sowie eine kurze Umschreibung, wie sich diese in den vergangenen Jahren verändert haben (z. B. durch Aufnahme des innereuropäischen Flugverkehrs im Jahr 2013).
Um die Frage beantworten zu können, wie erfolgreich die Einführung der Systeme war, muss außerdem deren Funktionsweise geklärt werden. Dazu schaut sich diese Arbeit am Beispiel von Deutschland die Unternehmen mit dem größten CO2-Ausstoß an und wertet aus, welche Unternehmen Emissionszertifikate verkaufen und welche noch zusätzliche Zertifikate einkaufen.
Abschließend wird bewertet, ob die Unterschiede in den CO2-Bilanzen einen Rückschluss auf die Einführung des Emissionshandels zulassen und damit auch wie zuverlässig die Systeme funktionieren und den gewünschten Effekt erbringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung eines neuen Marktes: wie das Kyoto-Protokoll zum Startschuss internationaler Klimapolitik wurde
- Der Europäische Emissionshandel: Betrachtung der Entwicklung von CO2-Preisen und Emittenten
- Effekte der Einführung des EU-ETS aus unternehmerischer Sicht
- Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Einführung von Emissionshandelssystemen, die Rechte zum CO2-Ausstoß handeln, zu den zielführenden Rettungsmaßnahmen in der Klimakrise zählen. Dazu werden sowohl positive als auch negative Aspekte beleuchtet.
- Die Entstehung von Emissionshandelssystemen und deren Zielsetzung
- Die Funktionsweise des Europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS)
- Die Effekte des EU-ETS aus unternehmerischer Sicht
- Kritik an Emissionshandelssystemen
- Die Rolle des Emissionshandels im Kontext der globalen Klimakrise
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der globalen Klimaerwärmung und die Notwendigkeit der Reduzierung von Treibhausgasemissionen dar. Sie führt das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) als ein Instrument zur Erreichung dieser Ziele ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor.
- Die Entstehung eines neuen Marktes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Emissionshandels im Kontext des Kyoto-Protokolls. Es werden die Zielsetzungen und Mechanismen des Protokolls erläutert, sowie die Unterschiede zwischen dem internationalen Emissionshandel und dem EU-ETS.
- Der Europäische Emissionshandel: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung des EU-ETS, insbesondere der Preisentwicklung von CO2-Zertifikaten und der Rolle verschiedener Emittenten.
- Effekte der Einführung des EU-ETS aus unternehmerischer Sicht: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des EU-ETS auf Unternehmen, indem es am Beispiel Deutschlands Unternehmen mit dem größten CO2-Ausstoß betrachtet und untersucht, welche Unternehmen Emissionszertifikate verkaufen und welche zusätzliche Zertifikate einkaufen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselwörtern: Emissionshandel, Klimakrise, Treibhausgase, CO2-Zertifikate, Kyoto-Protokoll, EU-ETS, Nachhaltigkeit, Unternehmen, Energiepolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Emissionshandels?
Das Ziel ist die Reduktion von Treibhausgasemissionen durch die Schaffung eines Marktes für CO2-Ausstoßrechte, um die globale Klimakrise einzudämmen.
Wie funktioniert das EU-ETS?
Das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) begrenzt die Gesamtmenge an CO2, die von Unternehmen ausgestoßen werden darf. Diese erwerben Zertifikate, die auf einem Markt gehandelt werden können.
Welche Rolle spielt das Kyoto-Protokoll?
Das Kyoto-Protokoll gilt als Startschuss für die internationale Klimapolitik und legte den Grundstein für die Mechanismen des heutigen Emissionshandels.
Wie wirkt sich der Emissionshandel auf Unternehmen aus?
Unternehmen mit hohem Ausstoß müssen zusätzliche Zertifikate kaufen, während solche, die Emissionen einsparen, überschüssige Rechte verkaufen können, was finanzielle Anreize für Klimaschutz schafft.
Welche Kritikpunkte gibt es am Emissionshandel?
Kritiker bemängeln oft eine zu geringe Preisstabilität, die Verteilung von kostenlosen Zertifikaten oder die unzureichende Wirksamkeit bei der schnellen Reduktion globaler Emissionen.
- Quote paper
- Tim von Werne (Author), 2021, Emissionshandel im Kontext der globalen Klimakrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283053