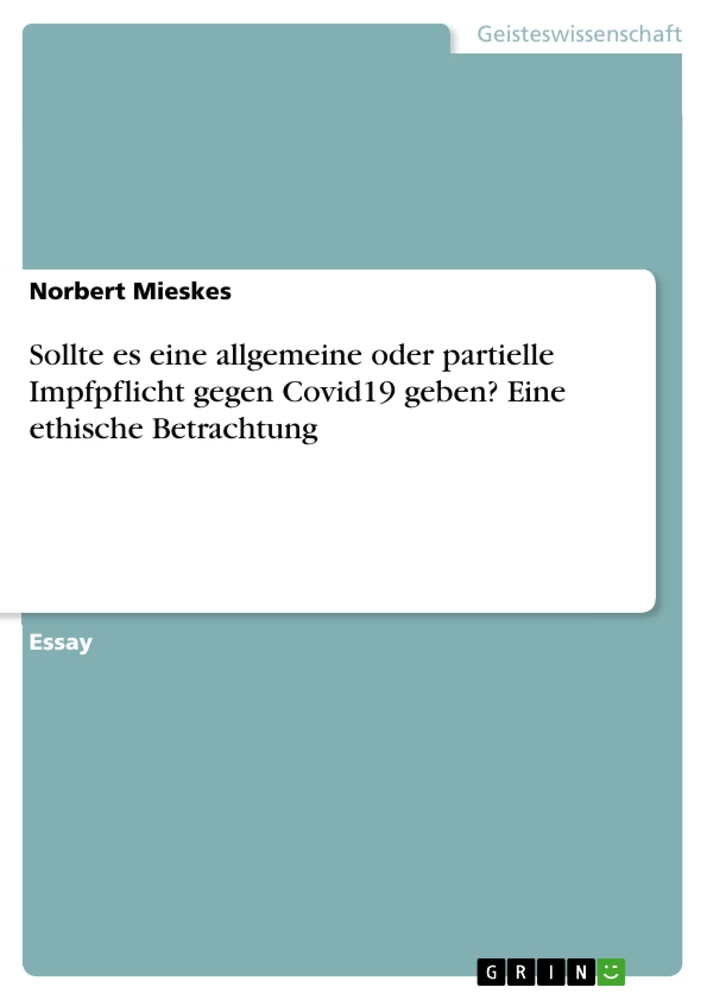Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach einer allgemeinen oder partiellen Covid19-Impfpflicht unter rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten. Die zentrale Frage, die sich bezüglich angemessener Strategien zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellt, dreht sich im Kern darum, wie die Freiheit des Einzelnen mit der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden kann. Das Recht des Individuums auf körperliche Unversehrtheit ist mit dem Recht der Gemeinschaft auf Gesundheit zu beleuchten.
Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen werden Forderungen nach einer partiellen Impfpflicht, speziell im Pflege-, Erziehungs- und Gesundheitsbereich, als auch für körpernahe Berufe laut. Unter Berücksichtigung der diversen Standpunkte als auch der ethischen Moraltheorien leistet dieser Essay einen Beitrag zur Lösung der drängenden Fragen. Für unser Gesundheitssystem, die Wirtschaft und für die die Gesellschaft im Allgemeinen stellt die Covid19-Pandemie eine der größten Herausforderung dar. Die weltweit steigenden Infektionszahlen beweisen, dass das Virus, speziell die ansteckendere Delta-Variante nach wie vor unser Leben dominiert.
Vor allem die kommenden Herbst- und Wintermonate, in welchen die Indoor-Aktivitäten der Bevölkerung wieder steigen sowie die Bildungseinrichtungen geöffnet werden, schüren Ängste und Verunsicherung vor einer vierten Corona-Welle, einem weiteren Lockdown und im schlimmsten Fall einer Überlastung des Gesundheitssystems. Gesellschaftliches Ziel und gemeinsame Verantwortung sollte das Erreichen einer Herdenimmunität sein. Mittlerweile sind über 61% der österreichischen Bevölkerung vollständig geimpft. Die Rate der Genesenen beträgt circa zehn Prozent, was eine Immunisierungsrate von circa 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung ergibt. Laut Epidemiologen bräuchte es jedoch eine Immunisierungsrate (Geimpfte und Genesene) von 80%, um auf einer freiwilligen Basis eine Herdenimmunität zu erzielen. Die Möglichkeit der Einführung einer Impfpflicht hat den Covid19-Impfdiskurs stark belebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Covid19 und der Impfdiskurs
- Impfgegner und - skeptiker
- Impfbefürworter
- Covid19-Impfung - Zulassungsverfahren
- Long Covid - Langzeitfolgen
- Stellungnahme der Bioethikkommission
- Medizinisch-pharmakologische Grundlagen
- Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen
- Gerechtigkeit und Solidarität
- Indirekte Impfpflicht/Impfpflicht
- Ethische Aspekte der Covid19-Impfung
- Individuelles Grundrecht versus Rechte der anderen
- Österreichische Kommentare zu Medizinrecht, Medizin- und Bioethik
- Ethische Theorien
- Utilitarismus nach Bentham
- Kants Pflichtethik
- Liberalismus nach John Rawls
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage einer allgemeinen oder partiellen Covid19-Impfpflicht in Österreich. Die Arbeit analysiert die aktuellen Herausforderungen, die die Covid19-Pandemie für das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und die Gesellschaft darstellt, sowie die ethischen und rechtlichen Aspekte einer möglichen Impfpflicht.
- Ethische und rechtliche Aspekte einer allgemeinen oder partiellen Impfpflicht
- Das Verhältnis von individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung
- Die Bedeutung von Herdenimmunität für die Eindämmung der Pandemie
- Die Argumente von Impfgegnern und Impfskeptikern
- Die Rolle ethischer Theorien im Kontext der Impfpflichtdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung präsentiert die aktuelle Situation der Covid19-Pandemie in Österreich und stellt die Bedeutung der Impfpflicht für die Erreichung einer Herdenimmunität heraus. Die Arbeit analysiert die Debatte um die Impfpflicht aus rechtlicher und ethischer Perspektive.
Covid19 und der Impfdiskurs
Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Standpunkte im Impfdiskurs, insbesondere die Argumente von Impfgegnern und Impfskeptikern. Es beleuchtet die Gründe für Impfskepsis und die verschiedenen Argumente gegen die Impfung.
Stellungnahme der Bioethikkommission
Dieses Kapitel analysiert die Stellungnahme der Bioethikkommission zu den medizinisch-pharmakologischen Grundlagen der Covid19-Impfung, den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und den ethischen Aspekten der Impfpflicht. Es befasst sich auch mit dem Konzept der Gerechtigkeit und Solidarität im Kontext der Pandemie.
Ethische Aspekte der Covid19-Impfung
Dieses Kapitel untersucht die ethischen Aspekte der Covid19-Impfung, insbesondere das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Es analysiert die unterschiedlichen Positionen in der Debatte um die Impfpflicht.
Ethische Theorien
Dieses Kapitel stellt verschiedene ethische Theorien vor, die für die Analyse der Impfpflicht relevant sind. Es untersucht den Utilitarismus nach Bentham, Kants Pflichtethik und den Liberalismus nach John Rawls.
Schlüsselwörter
Covid19-Impfpflicht, Herdenimmunität, individuelle Freiheit, gesellschaftliche Verantwortung, ethische Theorien, Utilitarismus, Pflichtethik, Liberalismus, Impfgegner, Impfskeptiker, Bioethikkommission, Medizinrecht, Medizin- und Bioethik.
Häufig gestellte Fragen
Sollte es eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 geben?
Die Arbeit beleuchtet diese Frage aus ethischer Sicht und wägt zwischen individueller Freiheit und der gesellschaftlichen Verantwortung zur Erreichung der Herdenimmunität ab.
Was ist der utilitaristische Standpunkt zur Impfpflicht?
Nach Bentham würde der Utilitarismus die Impfpflicht befürworten, wenn sie das größte Glück für die größte Zahl (Schutz der Volksgesundheit) gewährleistet.
Wie bewertet Kants Pflichtethik die Impfpflicht?
Kants Ethik würde prüfen, ob die Impfung als allgemeingültiges Gesetz (kategorischer Imperativ) zum Schutz der Würde anderer Menschen notwendig ist.
Was ist eine „indirekte Impfpflicht“?
Eine indirekte Impfpflicht entsteht, wenn Ungeimpfte von wesentlichen Teilen des sozialen Lebens oder bestimmten Berufen ausgeschlossen werden, was den Druck zur Impfung erhöht.
Welche Rolle spielt die Bioethikkommission in dieser Debatte?
Die Bioethikkommission liefert wissenschaftliche und ethische Empfehlungen, die verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen und medizinische Fakten in den politischen Diskurs einbringen.
- Quote paper
- Norbert Mieskes (Author), 2021, Sollte es eine allgemeine oder partielle Impfpflicht gegen Covid19 geben? Eine ethische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283103