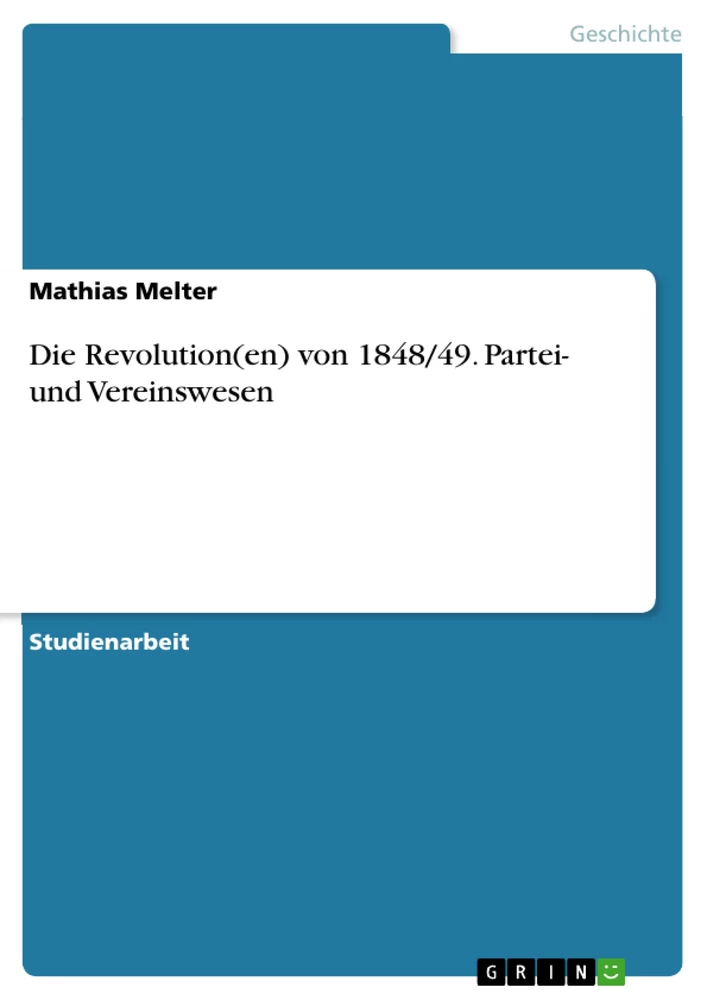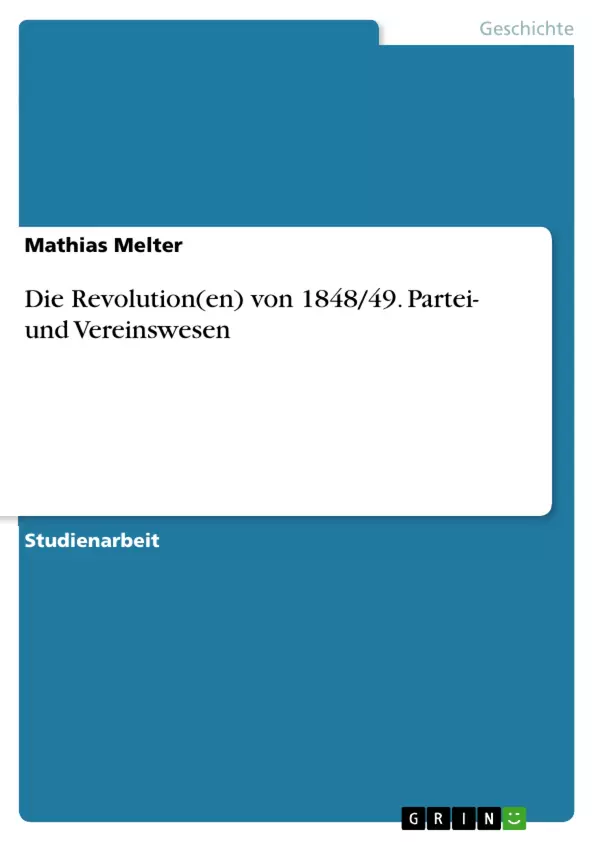In dieser Arbeit wird die Entstehung der verschiedenen Vereine und Parteien geschildert und darauf eingegangen, welche Interessen die verschiedenen Gruppierungen verfolgten, um die Bedürfnisse der Menschen sicherzustellen. Parteien und Vereine, welche heute in unserer Gesellschaft alltäglich sind, waren in den Jahren 1848/49 etwas ganz Anderes. Diese Gesellschaften entwickelten ein enormes Interesse an der Politik.
Die Menschen in der Revolution wollten etwas bewegen, verändern, an der Politik teilnehmen und auch selbst Entscheidungen treffen. Kurz vor dem Ausbruch der Revolution im Jahre 1848 entstanden diverse politische Parteien und einige Vereine in Mitteleuropa. Dies zuerst nur auf regionaler Basis, da eine überregionale Organisation sehr herausfordernd war. Politische Organisationen der Bürgschaften entstanden immer aus gesellschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen innerhalt des Staates.
Bei diesen Auseinandersetzungen gibt es eine Mischung aus Konflikten und diese prägt das jeweilige nationale Parteiensystem. Die Systeme sehen im internationalen Vergleich unterschiedlich aus. Im deutschen Bund beispielsweise waren es Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, welche die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaftsbewegung und schließlich die sozialdemokratische Partei entstehen ließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Entstehung von Politische Parteien und Vereinen
- Organisation
- Das Fünfparteisystem
- Arbeitervereinigung
- Demokraten
- Konstitutionelle Liberale
- Der Katholizismus → Die Pius-Vereine
- Konservativen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Organisation politischer Vereine und Parteien im deutschen Sprachraum während der Revolutionen von 1848/49. Sie untersucht, wie sich diese Organisationen in der Gesellschaft integrierten und welche Interessen sie verfolgten.
- Die Entstehung von politischen Parteien und Vereinen als Reaktion auf die Märzrevolution
- Die Organisation und Struktur der Vereine und Parteien
- Die verschiedenen Fraktionen innerhalb der politischen Organisationen, wie zum Beispiel Konservative, Liberale und Demokraten
- Die Rolle der Vereine und Parteien im Kampf gegen den Absolutismus
- Die Integration der politischen Organisationen in die Gesellschaft und ihre Einflussnahme auf politische Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Fragestellung
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Revolutionen von 1848/49, insbesondere die Dominanz des Absolutismus in Europa. Der Autor stellt die These auf, dass die Revolutionen eine neue politische Landschaft mit Parteien und Vereinen hervorbrachten, die das Interesse der Menschen an politischer Teilhabe und Einflussnahme widerspiegelten. Die Arbeit befasst sich mit der Integration dieser Organisationen in die Gesellschaft und ihren Auswirkungen auf politische Prozesse.
Entstehung von Politische Parteien und Vereinen
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von politischen Parteien und Vereinen als Reaktion auf die Märzrevolution und die Aufhebung des Verbots von Parteigründungen. Es wird erläutert, wie die Abschaffung des Absolutismus und die Einführung von Parlamenten die Forderung nach Grundrechten und einer Verfassung verstärkten. Das Kapitel beleuchtet die Bildung zahlreicher politisch interessierter Gruppen, die sich mit dem Ziel formierten, ihre Überzeugungen zu verbreiten und in den Nationalversammlungen Einfluss zu gewinnen.
Organisation
Dieses Kapitel behandelt die Organisation und Struktur der politischen Vereine. Es werden zwei Haupttypen von Organisationen hervorgehoben: die konstitutionell-liberalen Vereine und die Demokraten/Republikaner. Der Autor erklärt die Unterschiede in der Organisation und Entscheidungsfindung zwischen diesen beiden Typen. Außerdem stellt er das Fünfparteiensystem vor und geht auf die Arbeitervereinigung, die Demokraten, die Konstitutionellen Liberalen, die Pius-Vereine und die Konservativen ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Revolutionen von 1848/49 und konzentriert sich auf das entstehende Partei- und Vereinswesen. Schlüsselbegriffe sind: Absolutismus, Märzrevolution, Konstitutionalismus, Demokratie, Republik, Nationalversammlung, Konservative, Liberale, Demokraten, Arbeitervereinigung, Pius-Vereine, Selbstmobilisierung der Gesellschaft, politische Partizipation, und das Fünfparteiensystem.
Häufig gestellte Fragen
Warum entstanden 1848/49 so viele Vereine und Parteien?
Die Märzrevolution hob Verbote auf und weckte den Wunsch der Menschen, politisch mitzubestimmen und sich gegen den Absolutismus zu organisieren.
Was war das "Fünfparteisystem" in der Revolution?
Es beschreibt die Ausdifferenzierung der politischen Landschaft in fünf Hauptgruppen: Konservative, konstitutionelle Liberale, Demokraten, die katholischen Pius-Vereine und die Arbeitervereinigungen.
Welche Interessen verfolgten die Arbeitervereine?
Sie vertraten die Interessen der wachsenden Arbeiterschaft im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und legten den Grundstein für die spätere Sozialdemokratie und Gewerkschaften.
Wie unterschieden sich Liberale und Demokraten?
Konstitutionelle Liberale erstrebten meist eine konstitutionelle Monarchie mit begrenztem Wahlrecht, während Demokraten und Republikaner radikalere Reformen und ein allgemeines Wahlrecht forderten.
Welche Bedeutung hatten die Pius-Vereine?
Die Pius-Vereine waren die Basis des politischen Katholizismus. Sie organisierten die katholische Bevölkerung, um deren religiöse und gesellschaftliche Interessen in der neuen politischen Ordnung zu wahren.
- Citation du texte
- Mathias Melter (Auteur), 2020, Die Revolution(en) von 1848/49. Partei- und Vereinswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283132