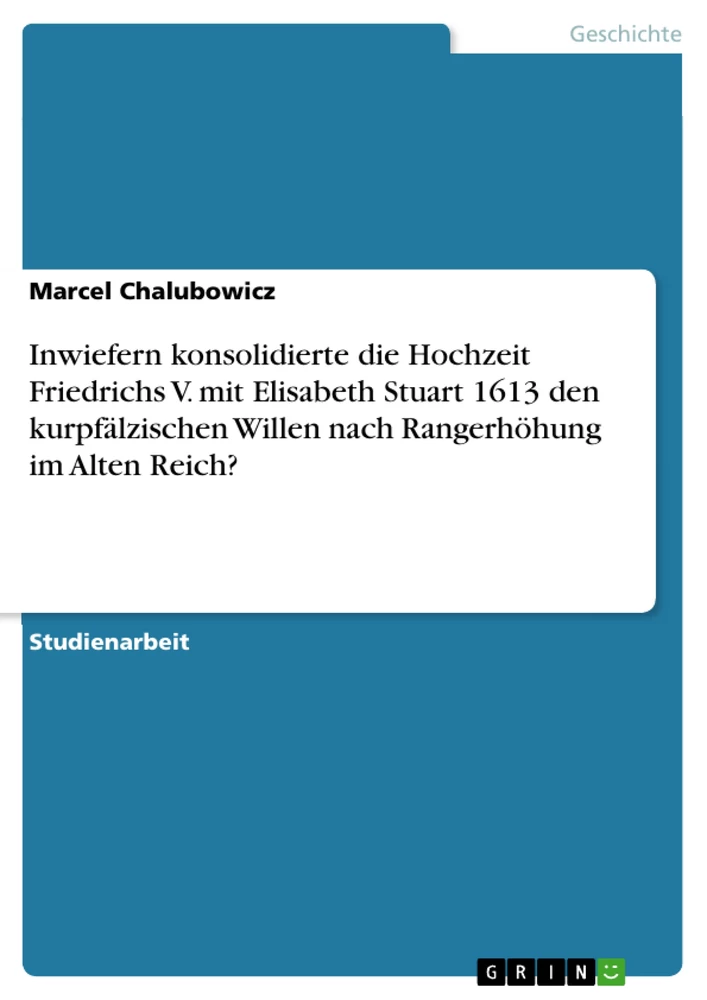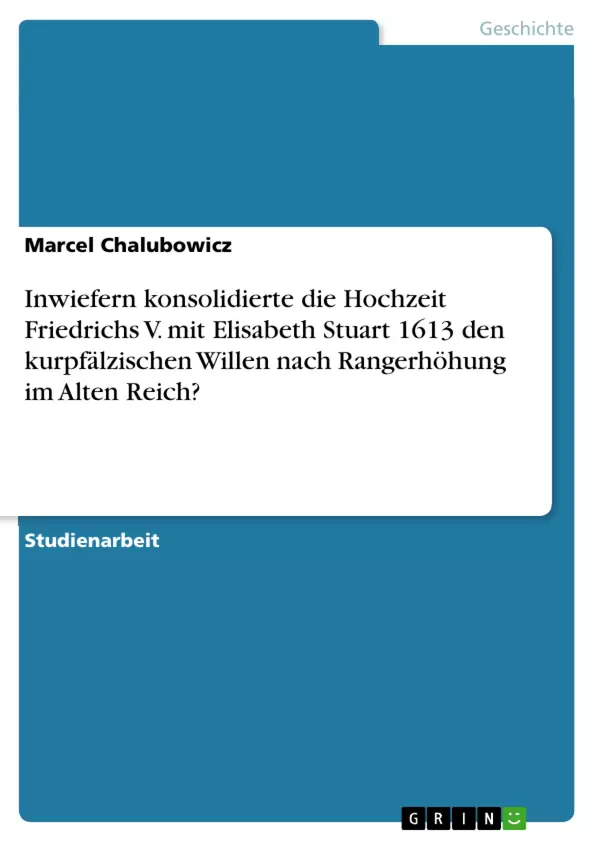Freude, Legitimation, Rangerhöhung? Die Hochzeit des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V. mit der englischen Prinzessin Elisabeth Stuart löste im 17. Jahrhundert diverse öffentliche Reaktionen aus. Dass ein Kurfürst eines kleinen Territorialstaates eine englische Prinzessin heiratete, war nicht üblich gewesen – denn es gab viele ranghöhere Anwärter für die Tochter Jakobs I. Diese Hausarbeit soll anhand ausgewählter Quellenauszüge und Forschungsliteratur beantworten, inwiefern die Hochzeit des jungen Paares den Willen nach Rangerhöhung der Kurpfalz im Alten Reich konsolidierte. Wozu führte die Vermählung, wie reagierte die Außenwelt, welche Folgen konnten möglicherweise aus der dynastischen Verbindung entstehen?
Die Arbeit führt die Lesenden anfangs in den zeitlich-politischen Rahmen ein und erklärt die Innen- sowie Außenpolitik unter Hinzunahme der Konfessionsthematik beider Bündnispartner. Welche Bedingungen mussten für dieses Ereignis geschaffen werden? Anschließend sollen Reaktionen auf die Heirat sowie die Selbstdarstellung der Pfalz ebenso den Grund wie auch den Effekt der Festlichkeit verdeutlichen. Das Fazit resümiert die Ergebnisse der Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Vorbereitungen zur Hochzeit Friedrichs V. mit Elisabeth von England
- 1.1 Der politische Weg der Kurpfalz bis zur Hochzeitsverhandlung mit England
- 1.2 England - Tor zum Protestantischen Machtblock
- 2. Die kurfürstlich-königliche Heirat
- 2.1 Hochzeitslegitimation und der Kampf gegen Rom – die Rettung der Protestanten
- 2.2 Demonstration von Kultur, Fortschritt und Stärke - ein Ausruf zur Anspannung
- 3. Fazit
- II. Quellenverzeichnis
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Hochzeit des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V. mit der englischen Prinzessin Elisabeth Stuart im Jahr 1613 und untersucht, inwiefern sie den Willen der Kurpfalz nach Rangerhöhung im Alten Reich stärkte. Sie beleuchtet die Vorbereitungen zur Heirat, die Legitimation und Selbstdarstellung der Pfalz sowie die Reaktionen der Außenwelt auf das Ereignis.
- Die Hochzeit als strategisches Bündnis und politische Machtdemonstration
- Die Rolle der Konfession im Kontext der Heirat
- Die außenpolitische Orientierung der Kurpfalz im 17. Jahrhundert
- Die Bedeutung der Kurpfalz im protestantischen Machtblock
- Die Auswirkungen der Heirat auf das Ansehen der Kurpfalz im Alten Reich
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt den Leser in die Fragestellung und den historischen Kontext der Arbeit ein. Sie beschreibt die Hochzeit Friedrichs V. mit Elisabeth Stuart und ihre Bedeutung für die Kurpfalz im Alten Reich.
1. Vorbereitungen zur Hochzeit Friedrichs V. mit Elisabeth von England
Dieses Kapitel untersucht die politischen Vorbereitungen zur Heirat und beleuchtet die strategischen Ziele der Kurpfalz. Es werden die Herausforderungen und Chancen, die mit der Hochzeit verbunden waren, analysiert.
2. Die kurfürstlich-königliche Heirat
Dieses Kapitel beleuchtet die Hochzeit selbst und ihre Bedeutung für die Legitimation und Selbstdarstellung der Kurpfalz. Die Kapitel analysieren die Bedeutung des Ereignisses für die Protestanten und die Außenwelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie dem Alten Reich, der Kurpfalz, der Hochzeit Friedrichs V. mit Elisabeth Stuart, der politischen und konfessionellen Situation im 17. Jahrhundert, der protestantischen Union, der Rangerhöhung, der Außenpolitik und der Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Hochzeit von Friedrich V. und Elisabeth Stuart im Jahr 1613 so ungewöhnlich?
Es war unüblich, dass ein Kurfürst eines relativ kleinen Territorialstaates wie der Kurpfalz eine englische Königstochter heiratete, da es ranghöhere Anwärter gab.
Welches politische Ziel verfolgte die Kurpfalz mit dieser Heirat?
Die Kurpfalz strebte nach einer Rangerhöhung im Alten Reich und wollte ihre Position innerhalb des protestantischen Machtblocks stärken.
Welche Rolle spielte die Konfession bei diesem Bündnis?
Die Hochzeit diente als strategische Allianz zur "Rettung der Protestanten" und als Kampfansage gegen den Einfluss Roms und der katholischen Mächte.
Wie inszenierte sich die Kurpfalz während der Hochzeitsfeierlichkeiten?
Die Pfalz nutzte das Ereignis zur Demonstration von Kultur, Fortschritt und Stärke, um ihren Anspruch auf eine höhere politische Bedeutung zu untermauern.
Was war die Protestantische Union im Kontext dieser Arbeit?
Die Protestantische Union war ein Bündnis protestantischer Fürsten und Städte im Heiligen Römischen Reich, in dem die Kurpfalz eine führende Rolle einnahm.
- Quote paper
- Marcel Chalubowicz (Author), 2020, Inwiefern konsolidierte die Hochzeit Friedrichs V. mit Elisabeth Stuart 1613 den kurpfälzischen Willen nach Rangerhöhung im Alten Reich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1283716