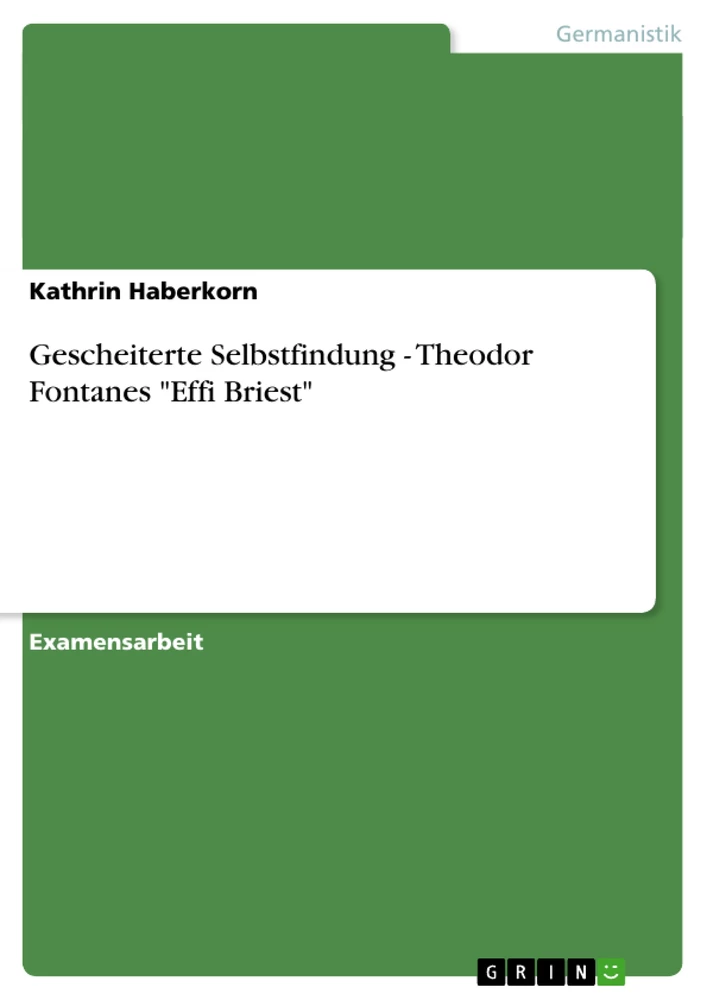Und drinnen waltet
Die züchtige Hausfrau,
Die Mutter der Kinder,
Und herrschet weise
Im häuslichen Kreise,
Und lehret die Mädchen
Und wehret den Knaben,
Und reget ohn’ Ende
Die fleißigen Hände,
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn
[…]
So beschreibt der deutsche Dichter Friedrich Schiller in seinem Gedicht Das Lied von der Glocke den Wirkungskreis der Frau. Meisterhaft wird das Ideal der Hausfrau gezeichnet, in dem sich die weiblichen Tugenden erschöpfen.
Über Jahrhunderte hinweg war die Rolle der Frau festgefahren und in Klischees verhaftet. „Ihre Minderwertigkeit, ihre Abhängigkeit [war] eine ausgemachte Sache“ , stellt Simone de Beauvoir in ihrem Werk Das andere Geschlecht fest. Schon Aristoteles ist der Ansicht, dass das Weib nur dadurch Weib ist, dass ihm bestimmte Eigenschaften fehlen und man folglich „das Wesen der Frau als etwas natürlich Mangelhaftes sehen [müsse].“ Thomas von Aquin, einer der wirkmächtigsten Philosophen und Theologen der Geschichte, schließt sich dieser Auffassung an und gibt zu bedenken, dass die Frau lediglich ein „verfehlter Mann“, „ein zufälliges Wesen“ sei.
Viele Zeitalter hindurch verharrte die Frau in absoluter Untertänigkeit unter dem Mann. Die Macht der Freiheit hat sie lange nicht empfunden, denn die menschlichen Möglichkeiten, die jedem Individuum die Chance auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung gewähren, waren ihr nicht immer gegeben. In ihrem Schicksal ‚Ehe’, das die Gesellschaft traditionsgemäß für das weibliche Geschlecht bereit hielt , stand die Frau ganz im Dienste des Mannes und der Familie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Überblick über den Wandel des Frauenbildes
- 3. Die Frauenfrage in Deutschland um die Jahrhundertwende
- 3.1. Die Frauenemanzipation und ihre ersten Verfechter
- 3.2. Die Rolle der Frau in Ehe und Familie
- 3.3. Ein Streifzug durch die deutsche Frauenbewegung
- 4. Theodor Fontane und die Frauen: Frauenbild und Frauengestalten
- II. Effi Briest und ihr Scheitern an der gesellschaftlich-adeligen Konvention
- 1. Effi Briest - Fontanes „liebenswürdigste Gestalt"
- 2. Die Verlobung: „Denn Effi wird im Grunde verkauft...“
- 3. Zwischen Anpassung und Protest: Effis Ehe mit Innstetten
- 3.1. Ich klettere [...] und schaukle mich lieber...“ – Naturkind contra Formelmensch
- 3.2. Frostige Vornehmheit und „adelige Kühle“ – Baron Geert von Innstetten
- 3.3. „Du bist ein entzückendes, liebes Geschöpf [...]“ – Das Frauenbild eines Karrieremachers
- 3.4. Innstetten als „geborene[r] Pädagog“: Der Spuk als repressives Erziehungsmittel
- 4. Vom Naturkind zum Gesellschaftsobjekt: Effis Ehebruch als Rebellion
- 5. „Ich habe keine Wahl. Ich muss.“ – Mord aus Prinzip im Duell
- 6. Effis Ende Ein stilles Glück der Resignation
- 7. Kontrastive Frauenbilder an Effis Seite
- 7.1. Die Dame der Gesellschaft: Luise von Briest
- 7.2. Die Inkarnation ursprünglicher Menschlichkeit: Roswitha
- 7.3. Emanzipiertes Künstlertum: Marietta Trippelli
- 8. Effi Briest - Ein kritischer Spiegel der Gesellschaft um 1880
- III. Emma Bovary und Anna Karenina – Effis europäische Schwestern?
- 1. Zwischen Illusion und Wirklichkeit – Emma Bovary
- 2. Zwischen Leidenschaft und Moral - Anna Karenina
- 3. Zusammenschau
- IV. Zusammenfassung
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit analysiert Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ im Kontext der Frauenfrage im 19. Jahrhundert. Sie untersucht, wie Fontane die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen an Frauen in seiner Zeit reflektiert und welche Folgen diese für die Protagonistin Effi Briest haben. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Herausforderungen der Emanzipation und die Konflikte zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlichen Konventionen.
- Die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Die Frauenfrage in Deutschland um die Jahrhundertwende
- Effis Scheitern an der gesellschaftlich-adeligen Konvention
- Effis Ehebruch als Rebellion gegen die gesellschaftlichen Normen
- Kontrastive Frauenbilder in Fontanes Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es zeichnet einen historischen Überblick über den Wandel des Frauenbildes von der traditionellen Hausfrau bis hin zu den ersten Ansätzen der Frauenemanzipation. Das Kapitel analysiert die Frauenfrage in Deutschland um die Jahrhundertwende, die sich sowohl auf die familiäre Position der Frau als auch auf ihre politischen Bestrebungen konzentriert. Es werden die wichtigsten Forderungen der Frauenbewegung und die Rolle der Frau in Ehe und Familie beleuchtet. Abschließend wird Fontanes Sicht auf die Frauen und seine Haltung zur Frauenfrage untersucht.
Das zweite Kapitel analysiert Effi Briest als Protagonistin des Romans und ihre Konflikte mit der gesellschaftlich-adeligen Konvention. Es untersucht die Verlobung Effis mit Baron Geert von Innstetten und die Herausforderungen ihrer Ehe. Das Kapitel beleuchtet Effis Ehebruch als Rebellion gegen die gesellschaftlichen Normen und die Folgen ihres Handelns. Es analysiert die Rolle des Duells und die tragische Konsequenz von Effis Entscheidung. Abschließend wird Effis Ende und ihre Resignation untersucht.
Das dritte Kapitel vergleicht Effi Briest mit den europäischen Schwestern Emma Bovary und Anna Karenina. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Protagonistinnen und ihre Konflikte mit den gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Liebe, der Leidenschaft und der Moral in den Romanen und die Folgen der Entscheidungen der Protagonistinnen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Frauenfrage, die gesellschaftliche Konvention, die Emanzipation, die Rolle der Frau in Ehe und Familie, die Liebe, die Leidenschaft, die Moral, die Rebellion, die Tragödie und die Resignation. Der Text analysiert Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“ im Kontext der Frauenfrage im 19. Jahrhundert und beleuchtet die Konflikte zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlichen Normen.
- Quote paper
- Kathrin Haberkorn (Author), 2008, Gescheiterte Selbstfindung - Theodor Fontanes "Effi Briest", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128474