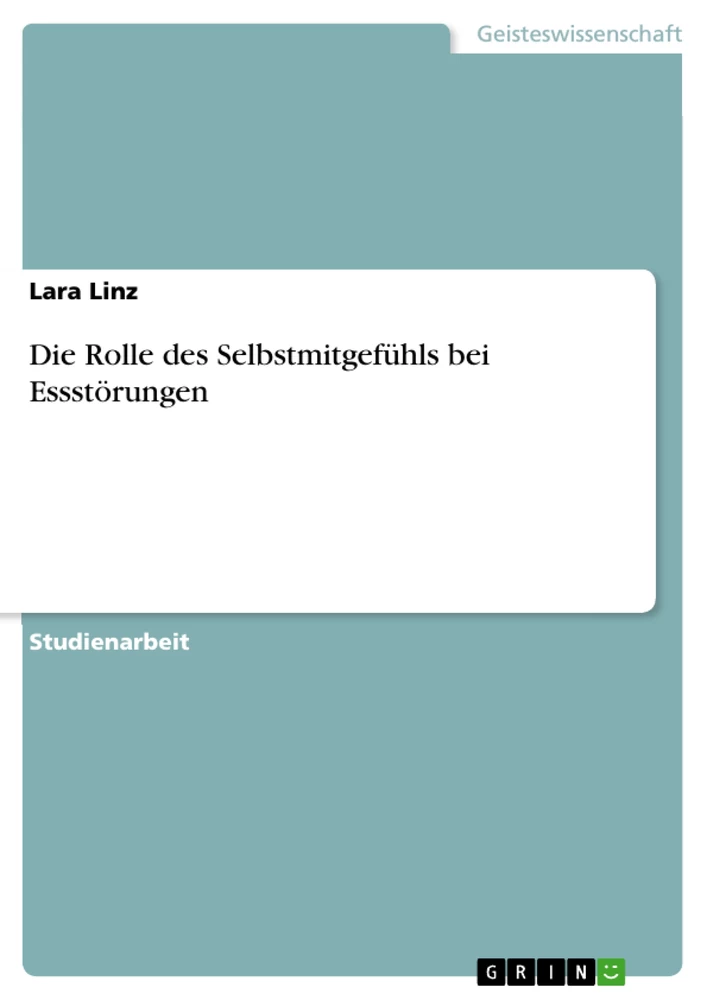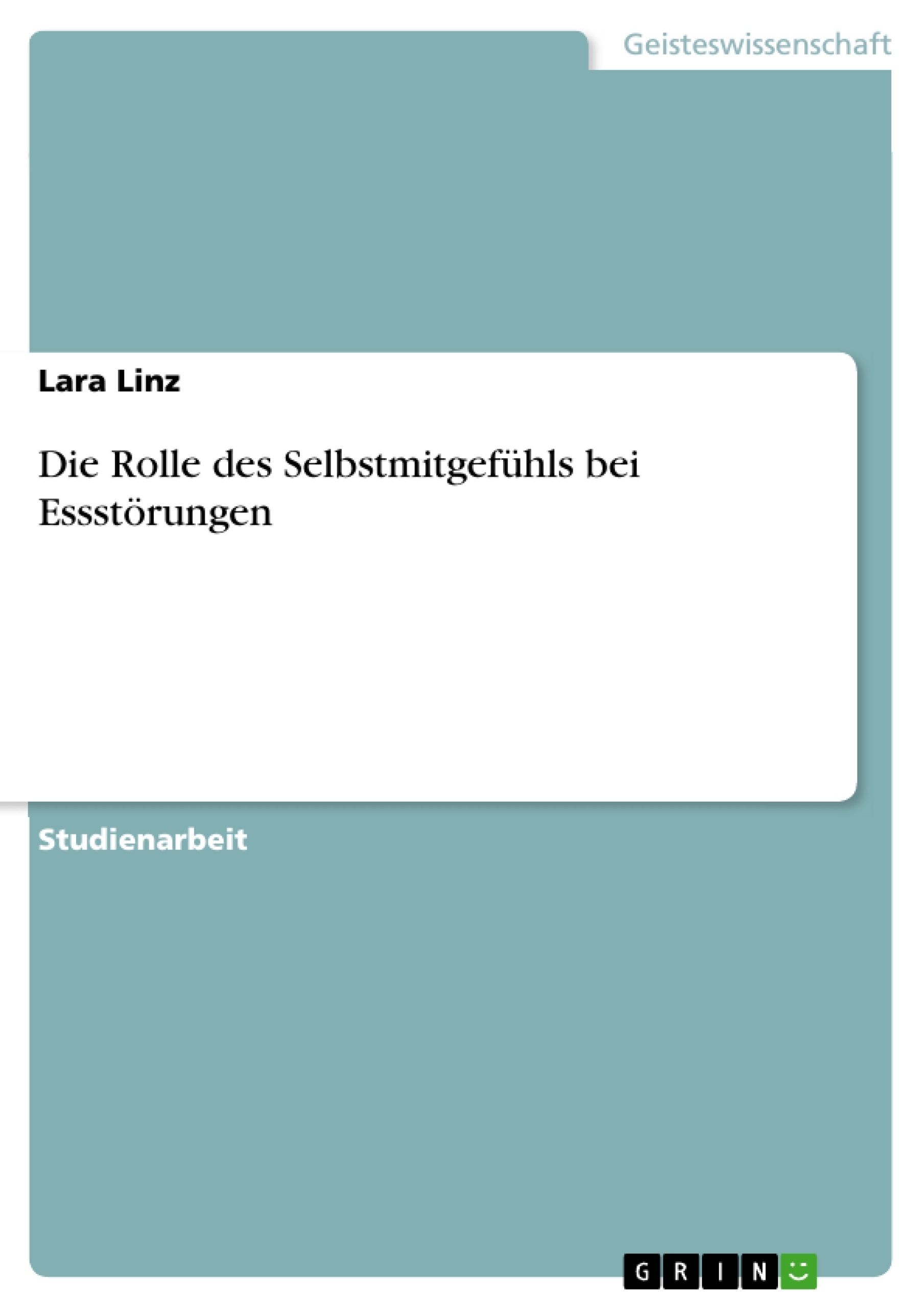Selbstmitgefühl meint eine innere, positive und emotionale Einstellung gegenüber sich selbst. Kann es als ein Schutzfaktor einer Essstörung wirken? Welchen Einfluss hat Selbstmitgefühl auf den Verlauf einer Essstörung? Können Implikationen für eine therapeutische und medizinische Behandlung auf dem aktuellen Forschungsstand abgeleitet werden?
Die Thematik ist bereits sehr gut erforscht und es finden sich viele Metaanalysen zum Thema „Selbstmitgefühl“ in verschiedenen Zusammenhängen. Besonders die Positive Psychologie und die Emotionsforschung beschäftigen sich mit den Zusammenhängen zwischen Selbstmitgefühl und dem psychischen Wohlbefinden, das durch eine Essstörung gefährdet werden kann. Diese Metaanalysen bilden die Grundlage zur theoretischen Fundierung dieser Arbeit. Des Weiteren existieren einige validierte Studien zum Einfluss des Selbstmitgefühls auf eine Essstörung. Diese werden im Kapitel 3 ausführlich erörtert. Die zunehmende Forschung auf diesem Gebiet zeigt eine hohe Relevanz für die Thematik. Außerdem sind die körperlichen Folgeschäden der Essstörung immens und reichen von Nieren- und Magen-Darm-Problemen über Veränderungen des Hormon- und Elektrolythaushalts bis zum plötzlichen Tod oder sogar Suzid. Aber auch die psychischen Folgeschäden können weitreichend sein. Zu den häufigsten komorbiden psychosomatischen Störungen gehören affektive Störungen (bipolar/depressiv) und Angststörungen, aber auch Substanzmissbrauch zeigt sich bei einer Essstörung häufig. Selbstmitgefühl kann hier ein effektives Konzept zur Prävention und Behandlung darstellen.
Auf Basis der theoretischen Grundlagen (Konzept Selbstmitgefühl, Definition und Ätiologie Essstörung) wird die Rolle von Selbstmitgefühl bei einer Essstörung erläutert. Aufbauend werden dann die Implikationen für die therapeutische und medizinische Behandlung reflektiert. Schließlich wird ein Fazit auf Basis der zuvor erlangten Erkenntnisse gezogen. Andere nicht näher bezeichnete Fütter- und Essstörungen finden aufgrund des Umfangs keine Anwendung in der Beantwortung der Forschungsfrage.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Theoretische Fundierung Selbstmitgefühl und Essstörung
- Konzept des Selbstmitgefühls
- Definition und Ätiologie Essstörung
- Analyse des Selbstmitgefühls bei Essstörungen
- Rolle des Selbstmitgefühls bei Essstörungen
- Implikationen für die therapeutische und medizinische Behandlung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Rolle des Selbstmitgefühls bei Essstörungen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss von Selbstmitgefühl auf die Entstehung, den Verlauf und die Behandlung von Essstörungen zu untersuchen.
- Konzept und Bedeutung von Selbstmitgefühl
- Definition und Ätiologie von Essstörungen
- Der Einfluss von Selbstmitgefühl auf Essstörungen
- Implikationen für die therapeutische und medizinische Behandlung
- Die Rolle von Selbstmitgefühl als Schutzfaktor und Behandlungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Es werden zudem die Relevanz und die wissenschaftlichen Grundlagen des Themas beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung von Selbstmitgefühl und Essstörungen. Hier werden die Konzepte, Definitionen und die aktuelle Forschung zu beiden Themengebieten dargelegt. Im dritten Kapitel wird die Rolle des Selbstmitgefühls bei Essstörungen analysiert und die Auswirkungen auf den Verlauf der Störung sowie die Implikationen für die therapeutische und medizinische Behandlung diskutiert.
Schlüsselwörter
Selbstmitgefühl, Essstörungen, Positive Psychologie, Emotionsforschung, Schutzfaktor, Behandlungsansatz, therapeutische Implikationen, medizinische Behandlung, Ätiologie, Konzept, Definition.
- Citation du texte
- Lara Linz (Auteur), 2022, Die Rolle des Selbstmitgefühls bei Essstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1284969