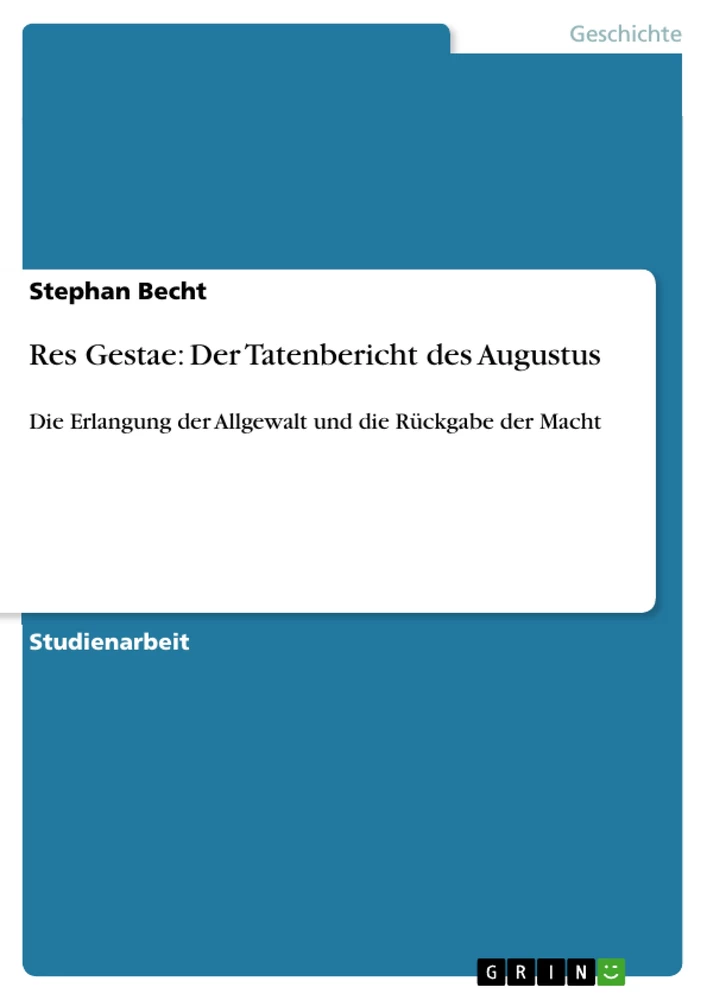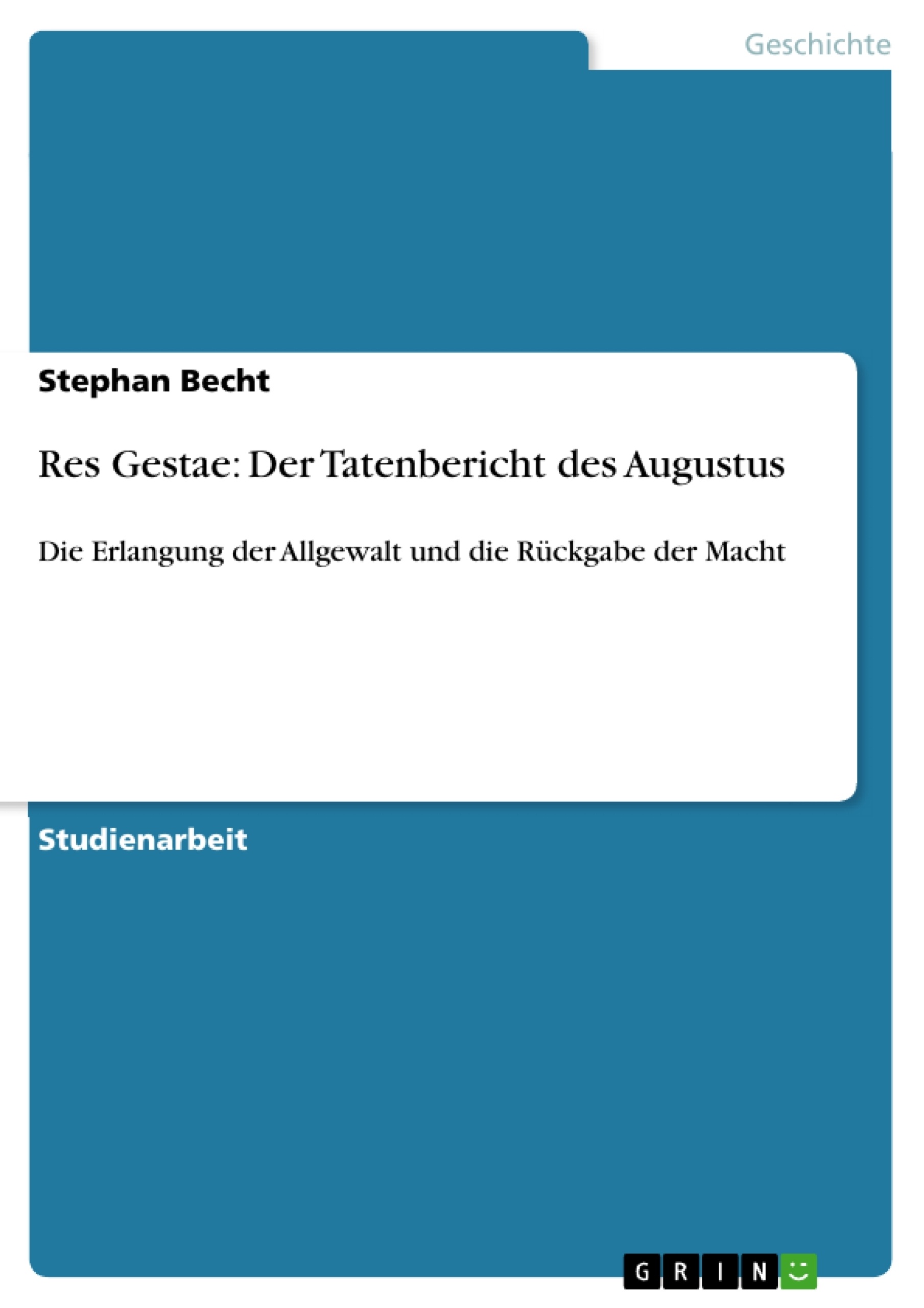Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind die Aussagen Oktavians in seinem Tatenbericht hinsichtlich seiner Stellung im Staat in den Jahren 33 - 27 v. Chr.. Der Schwerpunkt soll hierbei auf der kritischen Betrachtung seiner oft nicht eindeutigen Bemerkungen zur staatsrechtlichen Legitimation seiner Position nach der Triumviratszeit liegen. Es soll herausgestellt werden, inwieweit Oktavian versucht hat, eine mögliche illegitime Stellung durch außerstaatsrechtliche Maßnahmen zu vertuschen, um seine Macht in Rom zu festigen, und ob man Oktavians Verhalten in der Auseinandersetzung mit Marcus Antonius als Staatsstreich zu deuten hat. Von weiterem Interesse neben der Untersuchung der Machtkonsolidierung wird auch die für Oktavians Charaktereinschätzung nicht unbedeutende Wertung der Rückgabe der Macht im Jahre 27 v. Chr. sein. Da die historischen Quellen oft nicht eindeutige Stellung zu den von Oktavian beschriebenen Ereignissen beziehen, wird es außerdem notwendig sein, die Thesen der Forschungsliteratur zumindest zum Teil darzustellen und ihren Wahrheitsgehalt in Bezug auf die Angaben Oktavians abzuwägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Oktavians staatsrechtliche Stellung im Sommer 32 v. Chr.
- Beschreibung/Legitimation der Macht im Tatenbericht
- Festigung der Position durch den Gefolgschaftseid Italiens
- Der consensus universorum
- Deutung und Datierung nach Aktium
- Deutung und Datierung vor Aktium
- Festigung der Macht durch einen Staatsstreich?
- Die Rückgabe der res publica
- Überantwortung der potestas
- Rückgabe und Legitimation der Macht
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Oktavians Darstellung seiner Machtergreifung und -legitimation im Tatenbericht (Res Gestae Divi Augusti), insbesondere in den Jahren 33-27 v. Chr. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse seiner Aussagen zur staatsrechtlichen Legitimität seiner Position nach dem Zweiten Triumvirat. Es wird geprüft, ob Oktavian illegitime Handlungen verschleierte und ob sein Vorgehen gegen Marcus Antonius als Staatsstreich interpretiert werden kann. Die "Rückgabe der Macht" im Jahr 27 v. Chr. und ihre Bedeutung für die Charakterisierung Oktavians werden ebenfalls betrachtet.
- Oktavians staatsrechtliche Position nach dem Zweiten Triumvirat
- Legitimation und Rechtfertigung seiner Machtausübung
- Analyse der Darstellung im Tatenbericht hinsichtlich möglicher Verschleierungstaktiken
- Bewertung der Ereignisse im Kontext eines möglichen Staatsstreichs
- Die "Rückgabe der Macht" und ihre Bedeutung für die historische Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit analysiert Oktavians Darstellung seiner Machtübernahme im Tatenbericht, fokussiert auf die Jahre 33-27 v. Chr. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit seinen Aussagen zur Legitimation seiner Herrschaft nach dem Ende des Triumvirats. Es wird untersucht, ob Oktavian illegitime Machtausübung zu verschleiern versuchte und ob sein Vorgehen gegen Antonius als Staatsstreich gewertet werden kann. Die Rückgabe der Macht im Jahr 27 v. Chr. wird ebenfalls im Hinblick auf Oktavians Charakter und seine politische Strategie betrachtet. Die Arbeit berücksichtigt die Uneindeutigkeit der Quellen und die verschiedenen Interpretationen in der Forschungsliteratur.
Oktavians staatsrechtliche Stellung im Sommer 32 v. Chr.: Dieses Kapitel beleuchtet Oktavians rechtliche Stellung zwischen 43 und 33 v. Chr. als Triumvir. Es diskutiert die divergierenden Ansichten in der Forschung über das genaue Ende des Zweiten Triumvirats (33 oder 32 v. Chr.). Die Debatte konzentriert sich auf die Interpretation von Oktavians eigenen Angaben im Tatenbericht und auf die Frage, ob er nach dem formellen Ende des Triumvirats weiterhin triumvirale Potestas ausübte. Die verschiedenen Interpretationen und ihre Begründungen werden ausführlich dargestellt und gegeneinander abgewogen, wobei die Unsicherheit über die exakte Rechtslage Oktavians im Sommer 32 v. Chr. hervorgehoben wird.
Beschreibung/Legitimation der Macht im Tatenbericht: Dieses Kapitel analysiert Oktavians Strategien zur Legitimation seiner Macht. Es behandelt den "freiwilligen" Eid der italischen Bevölkerung im Spätsommer 32 v. Chr. als wichtiges Instrument zur Konsolidierung seiner Position und zur Herstellung einer Einheitsfront gegen Antonius und Kleopatra. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung im Tatenbericht und die Frage, inwieweit Oktavian durch diese Maßnahme eine schwache rechtliche Grundlage zu kompensieren versuchte. Die Bedeutung des Eides als plebiszitärer Akt außerhalb des formellen Staatsrechts wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Oktavian, Augustus, Tatenbericht (Res Gestae Divi Augusti), Zweites Triumvirat, Machtergreifung, Legitimation, Staatsstreich, Konsensus universorum, Rückgabe der Macht (res publica), römische Republik, Prinzipat, staatsrechtliche Stellung, Forschungsliteratur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Oktavians Machtergreifung und Legitimation im Tatenbericht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch Oktavians Darstellung seiner Machtergreifung und -legitimation in den Jahren 33-27 v. Chr., wie sie in seinem Tatenbericht (Res Gestae Divi Augusti) wiedergegeben wird. Der Fokus liegt auf der staatsrechtlichen Legitimität seiner Position nach dem Zweiten Triumvirat und der Frage, ob er illegitime Handlungen verschleierte.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Oktavians staatsrechtliche Position nach dem Zweiten Triumvirat, seine Strategien zur Legitimation seiner Macht, die Analyse seiner Darstellung im Tatenbericht auf mögliche Verschleierungstaktiken, die Bewertung der Ereignisse im Kontext eines möglichen Staatsstreichs und die Bedeutung der "Rückgabe der Macht" im Jahr 27 v. Chr. für die historische Interpretation.
Wie wird Oktavians Machtergreifung dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Oktavian seine Machtergreifung im Tatenbericht darstellt, insbesondere die Rolle des "freiwilligen" Eides der italienischen Bevölkerung und den "consensus universorum". Es wird analysiert, ob Oktavian durch diese Maßnahmen eine schwache rechtliche Grundlage zu kompensieren versuchte und inwieweit diese Darstellung die Realität widerspiegelt.
Wird die Frage eines Staatsstreichs behandelt?
Ja, die Arbeit untersucht explizit, ob Oktavians Vorgehen gegen Marcus Antonius als Staatsstreich interpretiert werden kann. Sie analysiert die Ereignisse kritisch und berücksichtigt die verschiedenen Interpretationen in der Forschungsliteratur.
Welche Bedeutung hat die "Rückgabe der Macht" im Jahr 27 v. Chr.?
Die "Rückgabe der Macht" (res publica) im Jahr 27 v. Chr. wird als wichtiger Aspekt von Oktavians politischer Strategie analysiert. Die Arbeit untersucht, wie diese Handlung zur Legitimation seiner Herrschaft beitrug und wie sie historisch interpretiert werden kann.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle ist der Tatenbericht (Res Gestae Divi Augusti) selbst. Zusätzlich wird die relevante Forschungsliteratur berücksichtigt, um verschiedene Interpretationen und Perspektiven zu beleuchten und die Uneindeutigkeit der Quellen zu adressieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Oktavians staatsrechtlicher Stellung im Sommer 32 v. Chr., Beschreibung/Legitimation der Macht im Tatenbericht (einschliesslich der Analyse des consensus universorum und des Gefolgschaftseids), der Rückgabe der res publica, einem Fazit, Quellenverzeichnis und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Oktavian, Augustus, Tatenbericht (Res Gestae Divi Augusti), Zweites Triumvirat, Machtergreifung, Legitimation, Staatsstreich, Consensus universorum, Rückgabe der Macht (res publica), römische Republik, Prinzipat, staatsrechtliche Stellung, Forschungsliteratur.
- Quote paper
- Stephan Becht (Author), 1995, Res Gestae: Der Tatenbericht des Augustus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128509