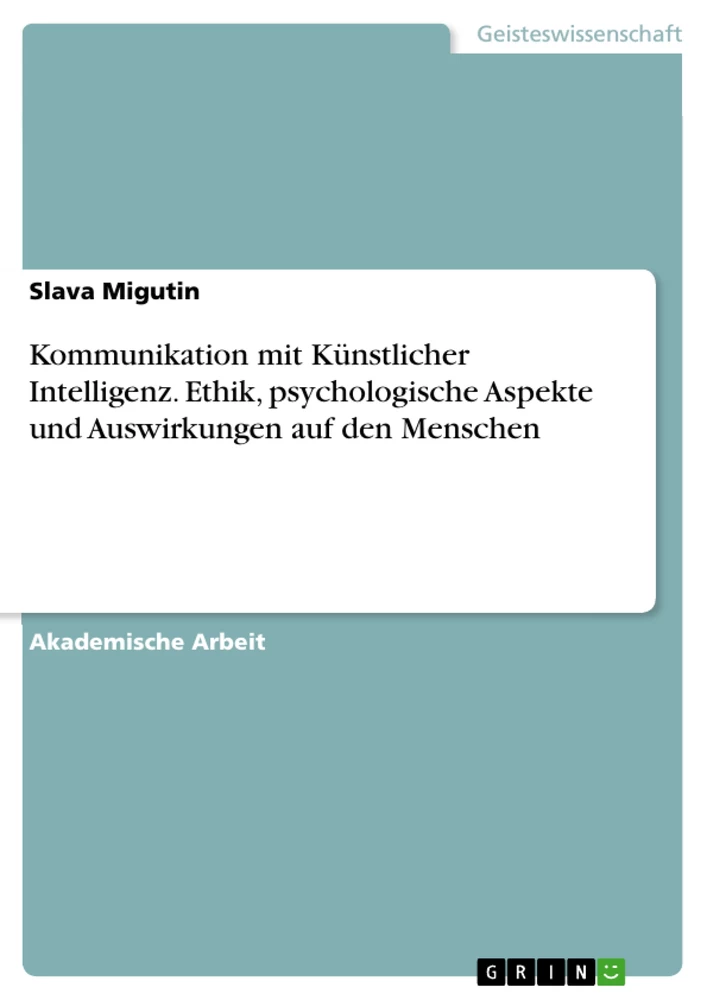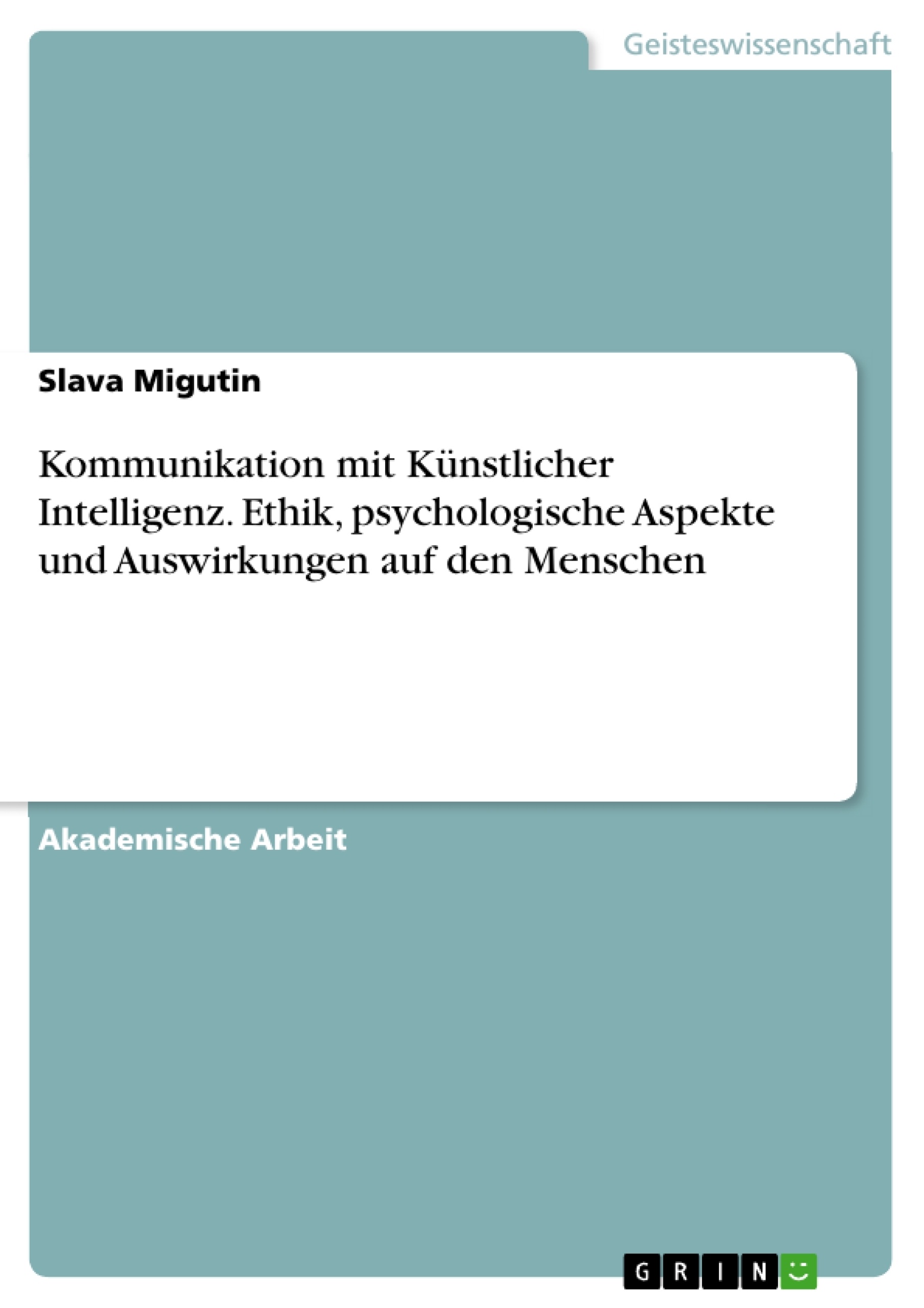Die Hausarbeit dient der Darstellung von Stärken und Schwächen sowie der Erläuterung von Chancen und Risiken, die sich durch Künstliche Intelligenz (KI) für den Menschen ergeben. Dazu wird zunächst auf die Definition und relevanten Konzepte eingegangen. Anschließend werden ethische Aspekte in Hinblick auf die menschliche Interaktion mit KI im beruflichen und sozialen Umfeld beleuchtet. In diesem Zusammenhang erhalten zwei psychologische Aspekte eine tiefere Beschreibung und die Auswirkungen von Maschinen, die ein menschenähnliches Verhalten zeigen, auf den Menschen werden erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Künstliche Intelligenz
- Relevante Konzepte
- Natural Language Processing
- Machine Perception and Sensing
- Affective Computing
- Virtual and Augmented Reality
- Cloud Computing
- Wireless Technologies
- Robotics
- BCIs and Implants
- Hauptteil
- Ethik der menschlichen Interaktion mit KI
- Im beruflichen Umfeld
- Im sozialen Umfeld
- Zwei psychologische Aspekte der menschlichen Interaktion mit KI
- Vertrauen
- Emotionales Design
- Auswirkungen von Maschinen mit menschenähnlichem Verhalten auf den Menschen
- Schlussteil
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung der Stärken und Schwächen sowie der Erläuterung von Chancen und Risiken, die sich durch Künstliche Intelligenz (KI) für den Menschen ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Definition und relevante Konzepte der KI, analysiert ethische Aspekte der Interaktion zwischen Mensch und KI im beruflichen und sozialen Umfeld und untersucht die Auswirkungen von Maschinen mit menschenähnlichem Verhalten auf den Menschen.
- Definition und Konzepte der Künstlichen Intelligenz
- Ethische Aspekte der Mensch-KI-Interaktion
- Psychologische Aspekte der Mensch-KI-Interaktion
- Auswirkungen von KI auf den Menschen
- Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Ziel der Hausarbeit vor: die Darstellung von Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz für den Menschen. Sie führt in die Definition von KI und relevante Konzepte ein.
Definition Künstliche Intelligenz
Dieses Kapitel erläutert die Definition von Künstlicher Intelligenz nach Luxton (2016) und beschreibt die Unterscheidung zwischen „Schwacher“ und „Starker“ KI.
Relevante Konzepte
Dieses Kapitel stellt sieben relevante Konzepte der Künstlichen Intelligenz vor, darunter „Natural Language Processing“, „Machine Perception and Sensing“, „Affective Computing“, „Virtual and Augmented Reality“, „Cloud Computing“, „Wireless Technologies“, „Robotics“ und „BCIs and Implants“. Jedes Konzept wird mit einem alltagsnahen Beispiel erläutert, um die Integration von KI im modernen Leben zu veranschaulichen.
Hauptteil
Der Hauptteil befasst sich mit ethischen Aspekten der Interaktion zwischen Mensch und KI und beleuchtet die Auswirkungen von KI auf den Menschen.
Ethik der menschlichen Interaktion mit KI
Dieses Kapitel erörtert ethische Aspekte der Mensch-KI-Interaktion im beruflichen und sozialen Umfeld anhand des Beispiels des Psychothrillers „Das Joshua-Profil“ von Sebastian Fitzek. Es werden kritische Kernpunkte in Hinblick auf die Ethik der Interaktion mit KI, wie die Wahrung von Menschenrechten, Datensicherheit und Transparenz, aufgezeigt.
Zwei psychologische Aspekte der menschlichen Interaktion mit KI
Dieses Kapitel beleuchtet zwei psychologische Aspekte der Mensch-KI-Interaktion: Vertrauen und emotionales Design. Es wird betont, dass Maschinen nicht nur technisch funktionieren müssen, sondern auch auf emotionaler Ebene akzeptabel sein sollten.
Auswirkungen von Maschinen mit menschenähnlichem Verhalten auf den Menschen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Maschinen, die ein menschenähnliches Verhalten zeigen, auf den Menschen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Künstliche Intelligenz, Mensch-KI-Interaktion, Ethik, Vertrauen, emotionales Design, Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen, "Schwache" KI, "Starke" KI, Predictive Policing.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „schwacher“ und „starker“ KI?
Schwache KI löst spezifische Anwendungsprobleme, während starke KI menschenähnliche intellektuelle Fähigkeiten in allen Bereichen besitzen würde.
Welche ethischen Risiken birgt KI im sozialen Umfeld?
Risiken umfassen den Verlust von Privatsphäre, Datensicherheitsmängel und die Gefahr von Manipulation durch Algorithmen.
Was versteht man unter „Affective Computing“?
Systeme, die menschliche Emotionen erkennen, interpretieren und darauf reagieren können, um die Interaktion natürlicher zu gestalten.
Warum ist Vertrauen in der Mensch-KI-Interaktion so wichtig?
Damit KI-Systeme (z. B. in der Medizin oder beim autonomen Fahren) akzeptiert werden, müssen Nutzer sich auf deren Zuverlässigkeit verlassen können.
Was sind die Auswirkungen von menschenähnlichen Maschinen?
Sie können Empathie wecken, aber auch Unbehagen auslösen (Uncanny Valley) und die Grenzen zwischen Mensch und Technik verschwimmen lassen.
Was ist „Predictive Policing“?
Der Einsatz von KI-Algorithmen zur Vorhersage von Straftaten, was ethisch wegen möglicher Vorurteile und Diskriminierung umstritten ist.
- Quote paper
- Slava Migutin (Author), 2022, Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz. Ethik, psychologische Aspekte und Auswirkungen auf den Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285417