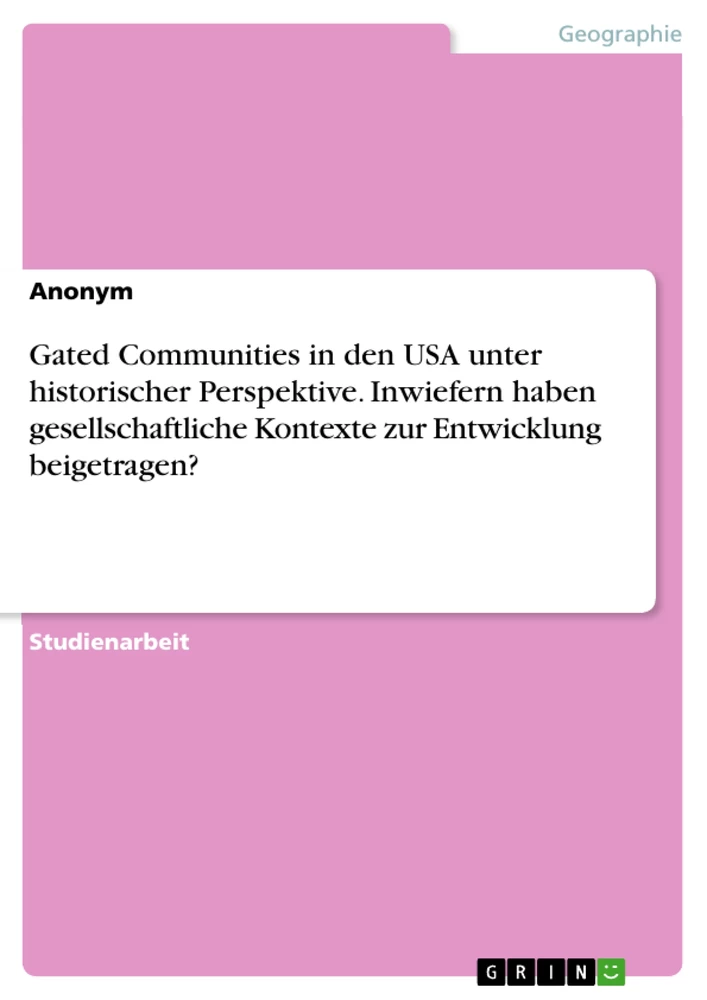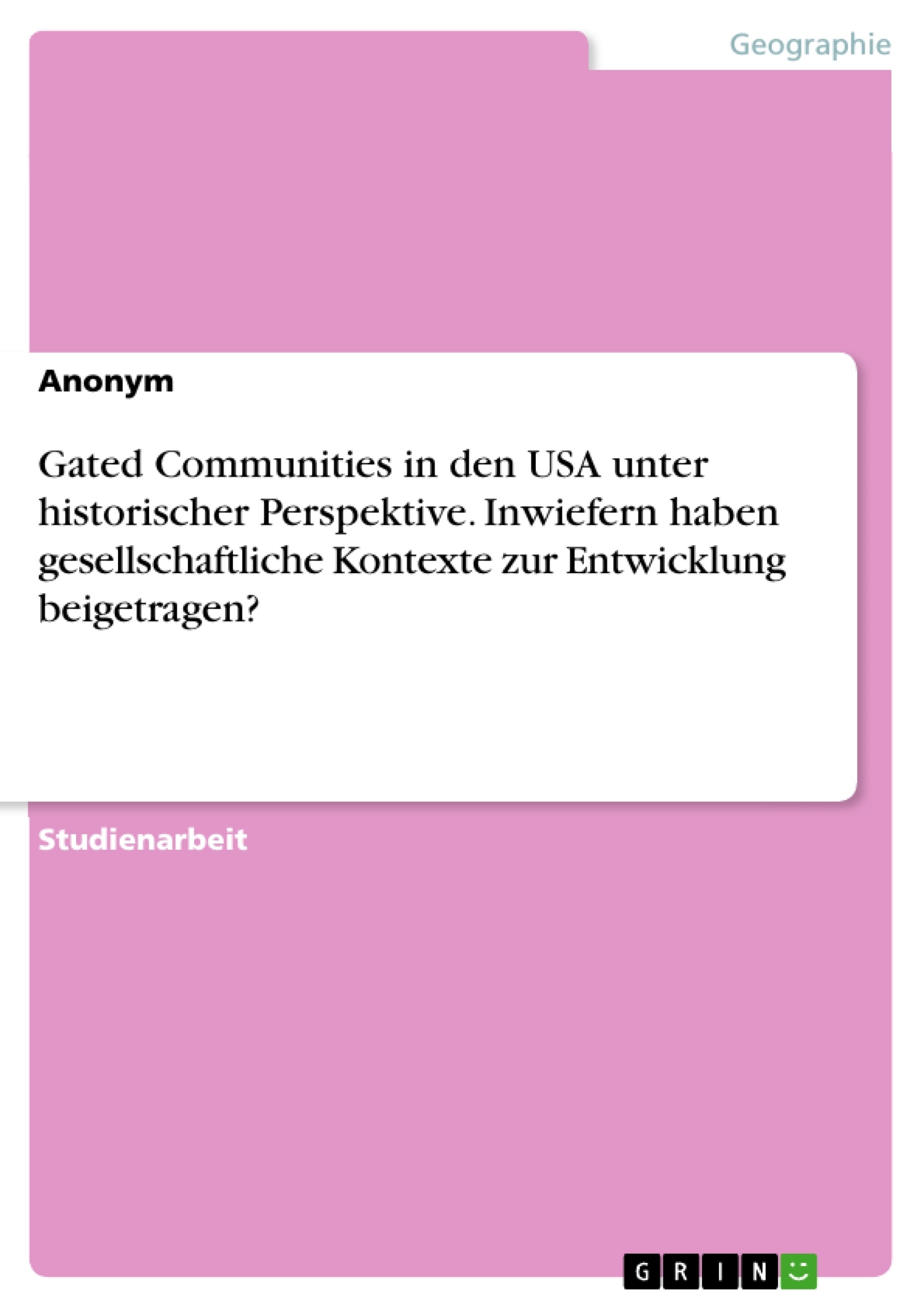Bei dieser Hausarbeit geht es nicht um eine bloße Abhandlung der Formen und Vorkommen von Gated Communities. Vielmehr soll aufgezeigt werden, wie sich Gated Communities in den USA von ihrem Ursprung aus bis heute hin entwickelt haben und welche gesellschaftlichen Veränderungen möglicherweise dazu beigetragen haben könnten. Daher widmet sich der Hauptteil der Arbeit dem historischen Aspekt geschlossener Wohnkomplexe und der Frage, inwiefern gesellschaftlichen Kontexte zur Entwicklung von Gated Communities beigetragen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklungsphasen der Gated Communities in den USA
- 2.1. Die Vorläufermodelle der Gated Communities
- 2.1.1. Die Villenkolonien
- 2.1.2. Die Gartenstadt
- 2.2. Die Anfangsphase der Gated Communities im 19. Jahrhundert
- 2.3. Der Boom ab den 60er und 70er Jahren
- 2.4. Das Anwachsen der Gated Communities bis heute
- 3. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung von Gated Communities in den USA und untersucht, wie gesellschaftliche Kontexte zu ihrer Entstehung und Verbreitung beigetragen haben. Dabei wird insbesondere der historische Aspekt dieser Lebensform beleuchtet.
- Die Vorläufermodelle von Gated Communities
- Die Anfänge von Gated Communities im 19. Jahrhundert
- Die Boomphase der Gated Communities in den 1960er und 1970er Jahren
- Die Weiterentwicklung von Gated Communities bis zur Gegenwart
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Entwicklung von Gated Communities
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in das Thema der Gated Communities ein und definiert den Begriff. Anschließend wird die Entwicklung der Gated Communities in den USA in drei große Phasen unterteilt. Das zweite Kapitel widmet sich den Vorläufermodellen der Gated Communities, darunter die Villenkolonien und die Gartenstadt. Im dritten Kapitel wird die Anfangsphase der Gated Communities im 19. Jahrhundert beleuchtet. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Boom der Gated Communities ab den 1960er und 1970er Jahren. Schließlich beschäftigt sich das fünfte Kapitel mit dem Anwachsen der Gated Communities bis heute und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Gated Communities, USA, Entwicklung, Geschichte, Stadtentwicklung, gesellschaftliche Kontexte, Vorläufermodelle, Villenkolonien, Gartenstadt, Boomphase, exklusive Wohnsiedlungen, soziale Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Gated Communities?
Gated Communities sind geschlossene Wohnkomplexe, die durch Zäune, Mauern und oft Sicherheitspersonal vom öffentlichen Raum abgetrennt sind.
Welche historischen Vorläufer gibt es für Gated Communities in den USA?
Als Vorläufer gelten die exklusiven Villenkolonien des 19. Jahrhunderts sowie Konzepte der Gartenstadt-Bewegung.
Wann kam es zum großen Boom der Gated Communities?
Ein massives Anwachsen dieser Wohnform war ab den 1960er und 1970er Jahren zu beobachten, getrieben durch den Wunsch nach Sicherheit und Exklusivität.
Welche gesellschaftlichen Faktoren begünstigten diese Entwicklung?
Soziale Unsicherheit, Segregation, die Angst vor Kriminalität und der Wunsch nach homogenen Nachbarschaften trugen maßgeblich zur Verbreitung bei.
Wie unterscheiden sich frühe Modelle von heutigen Gated Communities?
Während frühe Modelle oft nur für die absolute Elite zugänglich waren, haben sie sich heute zu einem Massenphänomen für verschiedene Schichten der Mittelschicht entwickelt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Gated Communities in den USA unter historischer Perspektive. Inwiefern haben gesellschaftliche Kontexte zur Entwicklung beigetragen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285427