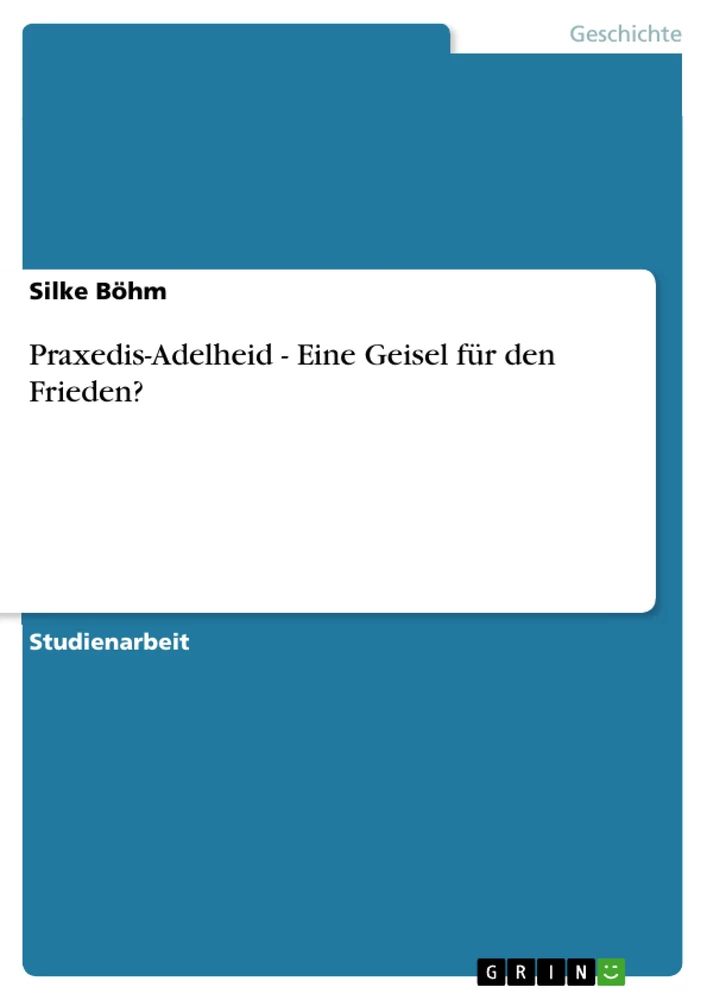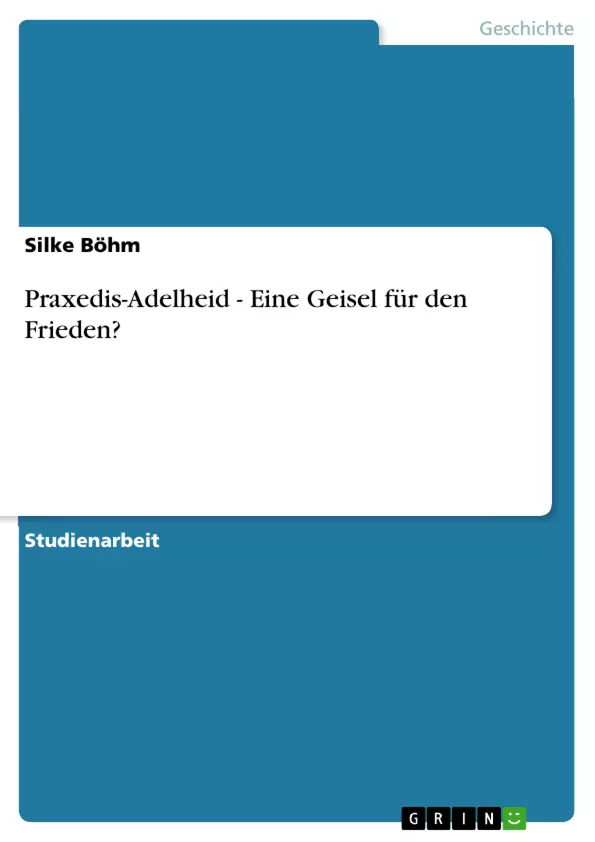Im Gegensatz zur bisherigen Forschungsmeinung vertritt Gerd Althoff den Standpunkt, dass die gegen Heinrich IV. auf der Synode von Piacenza (1095) vorgebrachten Vorwürfe seitens seiner zweiten Gemahlin Praxedis-Adelheid nicht der bloßen Verleumdung dienten und damit frei erfunden waren, sondern dass diese schwerwiegenden Anschuldigungen durchaus ernstgenommen werden müssen. Er zieht dabei die Erwägung in Betracht, dass die 1089 geschlossene und äußerst ungewöhnlich erscheinende Verbindung Heinrichs mit der Witwe des sächsischen Markgrafen Heinrich III. von Stade allein dem Zweck diente, den Frieden, den Heinrich 1088 mit den Sachsen geschlossen hatte, zu sichern, indem Praxedis-Adelheid als Geisel Heinrichs für den Erhalt des Friedens seitens der Sachsen bürgte. Althoff verweist darauf, dass es bereits seit dem 9. Jahrhundert eine große Anzahl an Quellen gäbe, die von Ereignissen berichten, in denen der Frau die Rolle einer obses pacis zukomme. Ausgehend von dieser These kommt Althoff dann zu dem Schluss, dass es wohl zu einer Geiselschändung gekommen sein müsse, da man den Berichten der einschlägigen Quellen entnehmen könne, dass die Sachsen den mit Heinrich geschlossenen Frieden verletzt hätten.
In dieser Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich Althoffs These mit den Vorkommnissen jener Zeit und mit den mittelalterlichen Gepflogenheiten vereinbaren lässt. Dabei wird zuerst auf das Verhältnis Heinrichs IV. zu den Grafen von Stade und zum Magdeburger Erzbischof eingegangen werden. Anschließend wird die Institution der Geiselschaft allgemein betrachtet und in einem weiteren Punkt auf weibliche Geiseln eingegangen werden. Abschließend werden dann noch einige mittelalterliche Beispiele zum sogenannten Geiselverfall behandelt werden.
Vgl.: Bernoldi Chronicon, hg. von Ian Stuart Robinson (MGH SS rer. Germ. N.S. 14, 2003), S. 383-540, ad a.
1088, S. 458ff.;
Annales Augustani, hg. von Georg Heinrich Pertz (MGH SS 3, 1839), S. 123-136, ad a. 1088;
Liber de unitate ecclesiae conservanda, hg. von Wilhelm Schwenkenbecher (MGH Ldl 2, 1892), S. 173-284,
II, c. 25.
Vgl.: Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte: Protokoll Nr. 395 über die Arbeitstagung auf der
Insel Reichenau vom 4.-7. April 2006. Thema: „Heinrich IV.“. Konstanz 2006, S. 85.
Vgl.: Ebd.
Vgl.: Ebd.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Grafen von Stade
- Zum Verhältnis zum Magdeburger Erzbischof
- Zur Institution der Geiselschaft
- Frauen als Geisel
- Beispiele zum Geiselverfall
- Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die These von Gerd Althoff, dass die Ehe Heinrichs IV. mit Praxedis-Adelheid im Jahr 1089 dem Zweck diente, den Frieden mit den Sachsen zu sichern, indem Praxedis-Adelheid als Geisel für den Erhalt des Friedens bürgte. Die Arbeit analysiert die historischen Hintergründe, die Institution der Geiselschaft und die Rolle von Frauen als Geiseln im Mittelalter, um die Plausibilität von Althoffs These zu bewerten.
- Das Verhältnis Heinrichs IV. zu den Grafen von Stade und zum Magdeburger Erzbischof
- Die Institution der Geiselschaft im Mittelalter
- Die Rolle von Frauen als Geiseln
- Beispiele für Geiselverfall im Mittelalter
- Die Bedeutung von Praxedis-Adelheid als Geisel für den Frieden
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Heinrich IV. und den Grafen von Stade, insbesondere die Rolle von Heinrich III. von Stade und seinem Nachfolger Luder-Udo III. im Kontext der sächsischen Opposition gegen den König. Es wird untersucht, ob die Grafen von Stade tatsächlich eine antikönigliche Politik verfolgten und wie ihr Verhältnis zu Heinrich IV. im Laufe der Zeit geprägt war.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Institution der Geiselschaft im Mittelalter. Es werden die verschiedenen Formen der Geiselschaft, ihre rechtliche Grundlage und ihre Bedeutung im politischen Kontext der Zeit erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle von Frauen als Geiseln im Mittelalter. Es werden Beispiele für weibliche Geiseln und ihre Funktion im politischen System der Zeit vorgestellt.
Das vierte Kapitel behandelt den Geiselverfall, d.h. die Verletzung von Geiselverträgen und die Folgen für die beteiligten Parteien. Es werden Beispiele für Geiselverfall aus dem Mittelalter vorgestellt und die Gründe für diese Verstöße analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Heinrich IV., Praxedis-Adelheid, Grafen von Stade, Magdeburger Erzbischof, Geiselschaft, Frauen als Geiseln, Geiselverfall, Friedenssicherung, Mittelalter, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Praxedis-Adelheid?
Sie war die zweite Gemahlin Kaiser Heinrichs IV. und spielte eine zentrale Rolle in den politischen Konflikten des ausgehenden 11. Jahrhunderts.
Was besagt Gerd Althoffs These der "obses pacis"?
Althoff vermutet, dass die Ehe zwischen Heinrich IV. und Praxedis-Adelheid primär dazu diente, den Frieden mit den Sachsen zu sichern, wobei die Frau als eine Art lebende Geisel (obses pacis) fungierte.
Warum erhob Praxedis-Adelheid schwere Vorwürfe gegen Heinrich IV.?
Auf der Synode von Piacenza klagte sie ihn wegen sexueller Misshandlungen und Demütigungen an, was laut Althoff eine Folge des "Geiselverfalls" nach dem Bruch des Friedens durch die Sachsen gewesen sein könnte.
War es im Mittelalter üblich, Frauen als Geiseln einzusetzen?
Ja, historische Quellen belegen, dass Frauen aus adligen Familien häufig zur Absicherung von Verträgen und Friedensschlüssen als Geiseln gestellt wurden.
Was versteht man unter "Geiselverfall"?
Wenn die Partei, die die Geisel gestellt hat, den Vertrag bricht, verfällt der Schutzstatus der Geisel, was im Mittelalter oft zu Schändung oder Tötung der Geisel führte.
- Quote paper
- Silke Böhm (Author), 2008, Praxedis-Adelheid - Eine Geisel für den Frieden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128634