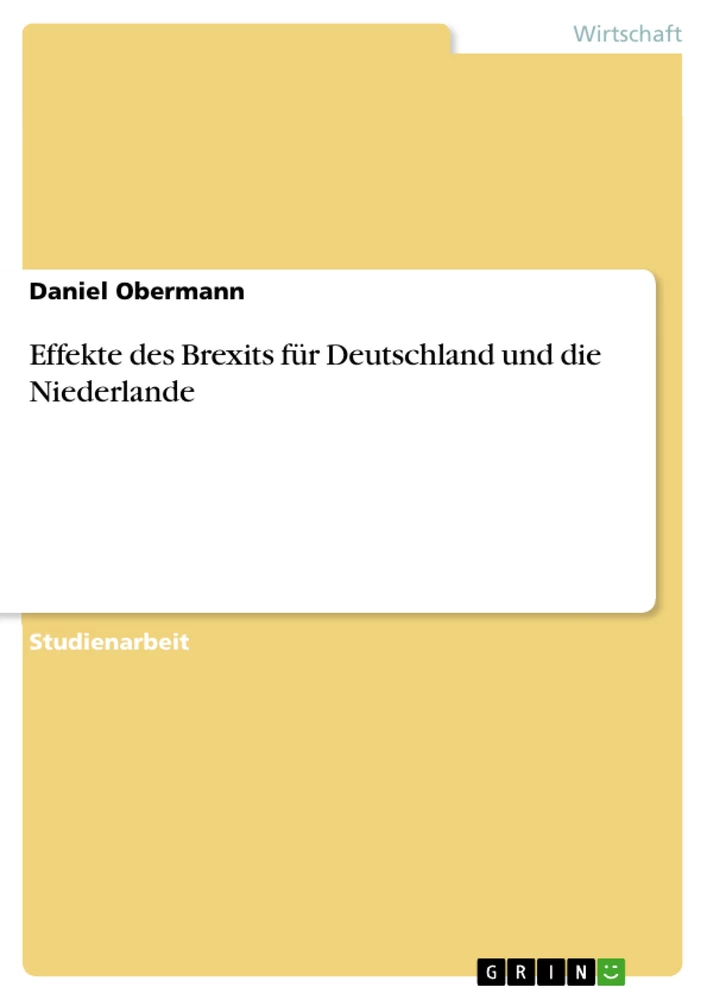Der BREXIT ist ein Novum. Noch nie hat ein EU-Mitglied die Europäische Union freiwillig verlassen. Mit Großbritannien verlässt einer der größten Player die Europäische Union. Das hat für die verbleibenden Mitglieder nachhaltige Folgen. Für Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, hat das positive und negative Effekte. Aber auch die Niederlande sind vom Entscheid Großbritanniens betroffen. Die Arbeit definiert mögliche zukünftige Szenarien, wie die Wirtschaftsbeziehungen der Zukunft aussehen können. Folgend werden die Effekte des BREXITS für Deutschland und die Niederlande aufgezeigt und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Zolltheorie
- 3 Zukünftige Wirtschaftsbeziehungen
- 4 Effekte des Brexits
- 4.1 Effekte für Deutschland
- 4.2 Effekte für die Niederlande
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen des Brexits auf die deutschen und niederländischen Volkswirtschaften. Das Ziel ist es, verschiedene Szenarien für die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu analysieren und die damit verbundenen Folgen für Deutschland und die Niederlande zu identifizieren.
- Analyse der Zolltheorie und ihrer Auswirkungen auf den internationalen Handel
- Untersuchung verschiedener Modelle für die zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU
- Bewertung der potenziellen Effekte des Brexits auf die deutsche Wirtschaft, insbesondere auf den Exportsektor
- Bewertung der potenziellen Effekte des Brexits auf die niederländische Wirtschaft, insbesondere auf den Finanzsektor
- Zusammenfassende Analyse der Auswirkungen des Brexits auf Deutschland und die Niederlande
Zusammenfassung der Kapitel
Die Seminararbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung und der Aufbau der Arbeit dargestellt werden. Kapitel 2 befasst sich mit der Zolltheorie und erläutert die Bedeutung und die Auswirkungen von Zöllen. Kapitel 3 analysiert verschiedene Modelle bereits existierender wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der EU und anderen Ländern. In Kapitel 4 werden die potenziellen Auswirkungen des Brexits auf Deutschland und die Niederlande differenziert betrachtet. Die Seminararbeit schließt mit einem Fazit, in welchem die Forschungsfrage nach den Effekten des Brexits für Deutschland und die Niederlande beantwortet wird.
Schlüsselwörter
Brexit, Zolltheorie, Wirtschaftsbeziehungen, EU, Deutschland, Niederlande, Handel, Export, Finanzsektor, Auswirkungen, Folgen
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die deutsche Wirtschaft?
Der Brexit führt für Deutschland sowohl zu positiven als auch negativen Effekten, insbesondere im Exportsektor, da Großbritannien einer der größten Handelspartner war.
Wie sind die Niederlande vom Brexit betroffen?
Die Niederlande spüren die Folgen besonders im Finanzsektor und im intensiven Seehandel mit dem Vereinigten Königreich.
Was besagt die Zolltheorie im Kontext des Brexits?
Die Zolltheorie analysiert, wie neue Handelsbarrieren und Zölle den internationalen Warenfluss verteuern und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Länder beeinflussen.
Welche zukünftigen Wirtschaftsmodelle werden diskutiert?
Es werden verschiedene Szenarien analysiert, die sich an bestehenden Abkommen der EU mit Drittstaaten orientieren könnten, um den Marktzugang zu regeln.
Warum ist der Brexit ein Novum in der EU-Geschichte?
Es ist das erste Mal, dass ein Mitgliedstaat die Europäische Union freiwillig verlassen hat, was weitreichende politische und ökonomische Präzedenzfälle schafft.
- Quote paper
- Daniel Obermann (Author), 2020, Effekte des Brexits für Deutschland und die Niederlande, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1286620