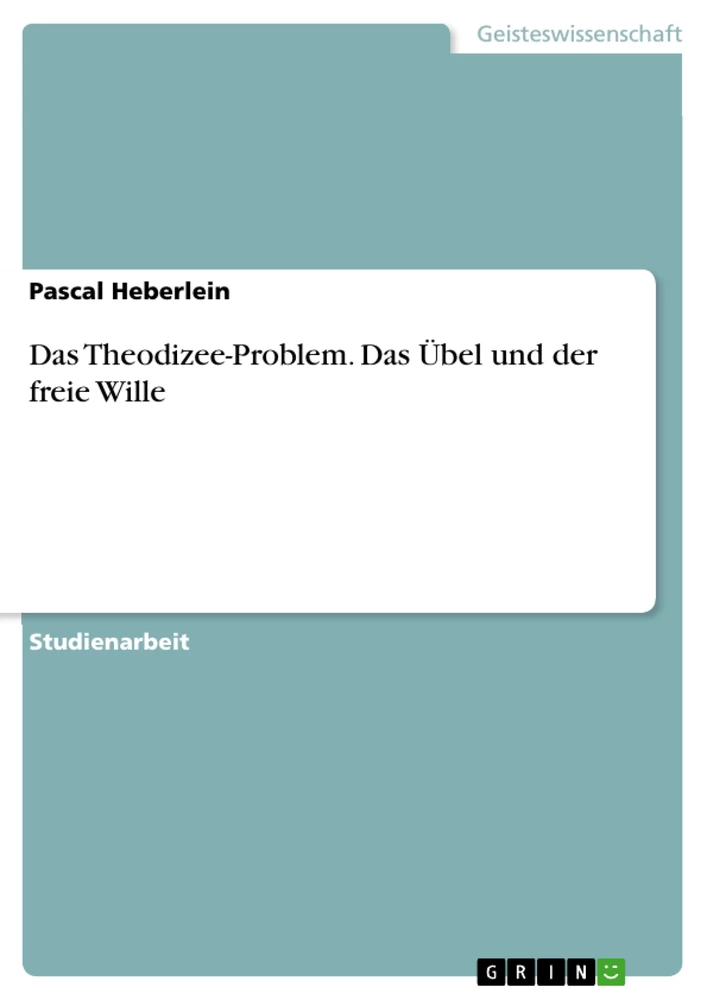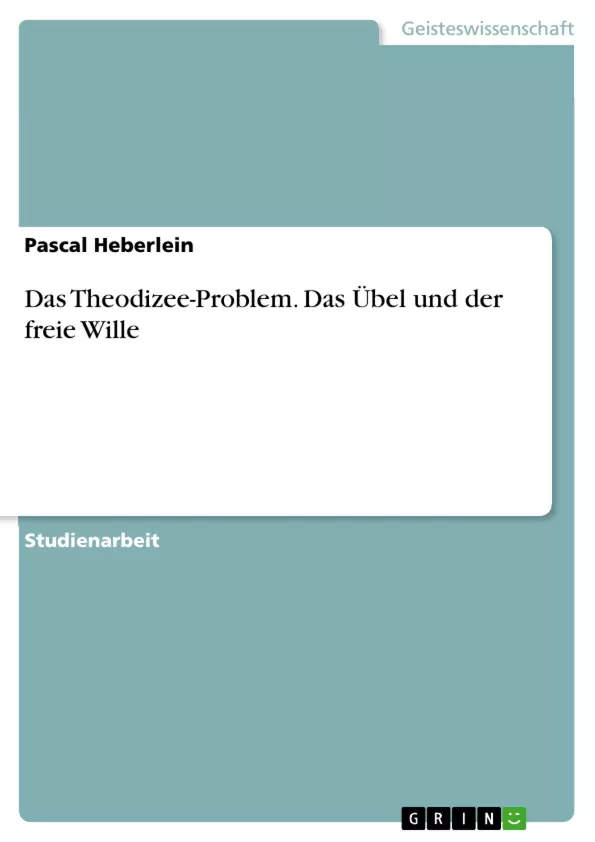Welche gerechtfertigten und vernünftigen Antworten werden vom rationalen Theismus in der Theodizee-Frage ins Feld geführt und sind sie stichhaltig? Um die Frage zu beantworten, werden zunächst die zwei weitverbreitetsten Versuche (Neuinterpretation des Übels und Modifikation der Eigenschaften Gottes) dargestellt und diskutiert. Ausführlich – und als besonderer Schwerpunkt der Arbeit – wird im dritten Kapitel auf die Verteidigung mittels der Willensfreiheit eingegangen, wobei hierfür zwei konträre Positionen diskutiert werden.
Gläubige Menschen der beiden numerisch größten theistischen Religionen (Christentum und Islam) glauben, wie viele andere auch, an ein Wesen (kurz: Gott), das im Grunde durch drei Eigenschaften charakterisiert werden kann: es ist allmächtig, allwissend und vollkommen gut. So verbreitet dieser Glaube auch sein mag, seit Jahrhunderten stürzt er viele seiner Anhängerinnen und Anhänger in einen immer wiederkehrenden Zweifel: Wie kann ein solcher Gott Leid zulassen? Oder: Wie kann es das Übel geben, wenn ein solcher Gott existiert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Möglichkeiten einer Theodizee
- Lösung durch Neuinterpretation des Übels
- Lösung durch eine Modifikation der Eigenschaften Gottes
- Verteidigung mithilfe der Willensfreiheit
- Die Position von J. L. Mackie
- Die Position von Alvin Plantinga in der Variante von Richard Gale
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Theodizee-Problem, also der Frage, wie das Vorhandensein von Leid mit der Existenz eines allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gottes vereinbar ist. Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Ansätze des rationalen Theismus zur Beantwortung dieser Frage darzustellen und zu diskutieren.
- Die verschiedenen Ansätze des rationalen Theismus zur Beantwortung des Theodizee-Problems
- Neuinterpretation des Übels
- Modifikation der Eigenschaften Gottes
- Verteidigung mithilfe der Willensfreiheit
- Die Positionen von J. L. Mackie und Alvin Plantinga
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Theodizee-Problem anhand des bekannten Arguments von Epikur vor. Es wird gezeigt, dass die Schlussfolgerung dieses Arguments, dass Gott nicht existiert, für rationale Theisten nicht akzeptabel ist. Daraus ergibt sich die Frage, welche Antworten der rationale Theismus auf das Theodizee-Problem bietet.
Kapitel 2 diskutiert zwei verbreitete Lösungsansätze: die Neuinterpretation des Übels und die Modifikation der Eigenschaften Gottes. Dabei wird gezeigt, dass das Leid zwar real ist, aber nicht unbedingt als negativ betrachtet werden muss. Es werden verschiedene Formen der Bonisierung, wie z.B. die Pädagogisierung und die Ästhetisierung, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Theodizee, Übel, Leid, Willensfreiheit, rationale Theismus, Gott, Eigenschaften Gottes, Bonisierung, Pädagogisierung, Ästhetisierung, Epikur, Mackie, Plantinga.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Theodizee-Problem?
Es ist die Frage, wie die Existenz eines allmächtigen, allwissenden und vollkommen guten Gottes mit dem Vorhandensein von Leid und Übel in der Welt vereinbar ist.
Wie wird das Übel in der Theodizee neu interpretiert?
Ein Ansatz ist die „Bonisierung“, bei der Leid als pädagogisches Mittel zur Seelenbildung oder als notwendiger Teil eines ästhetischen Gesamtplans Gottes gesehen wird.
Welche Rolle spielt die Willensfreiheit bei diesem Problem?
Die „Free Will Defense“ argumentiert, dass Gott den Menschen Freiheit geben wollte. Diese Freiheit schließt die Möglichkeit ein, sich für das Böse zu entscheiden, was Gott nicht verhindern kann, ohne die Freiheit aufzuheben.
Was sind die Positionen von Mackie und Plantinga?
J. L. Mackie kritisiert die Theodizee als logisch inkonsistent, während Alvin Plantinga versucht, die logische Vereinbarkeit von Gott und Übel durch die Willensfreiheit zu beweisen.
Was bedeutet die Modifikation der Eigenschaften Gottes?
Ein Lösungsversuch besteht darin, eine der drei Eigenschaften (Allmacht, Allwissenheit, Güte) einzuschränken, um den logischen Widerspruch zum Übel aufzulösen.
- Quote paper
- Pascal Heberlein (Author), 2022, Das Theodizee-Problem. Das Übel und der freie Wille, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1286625