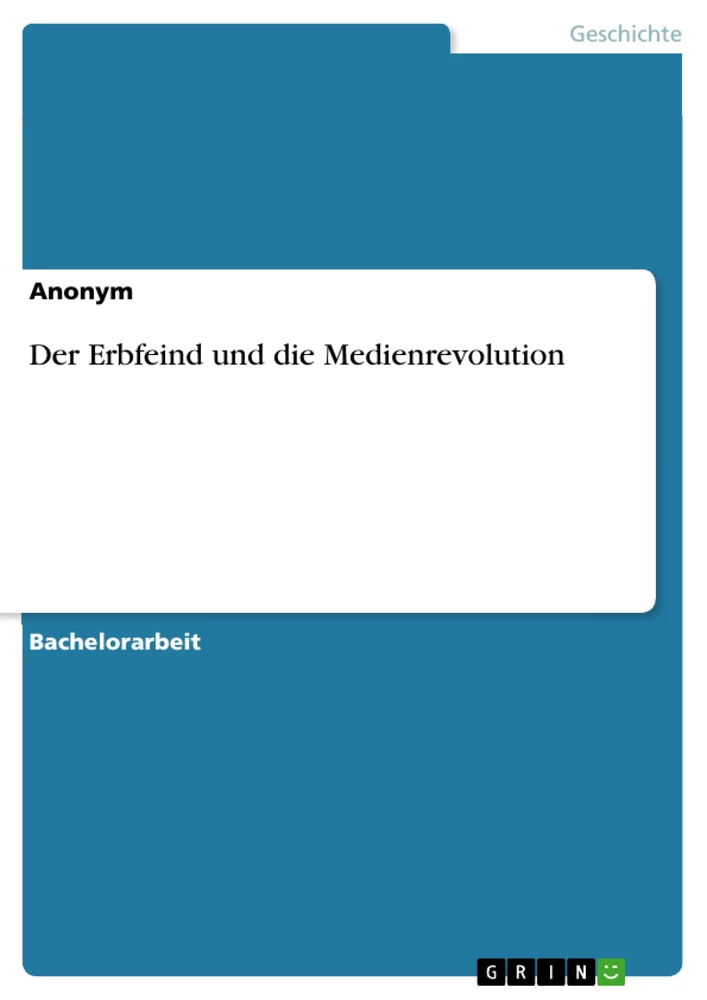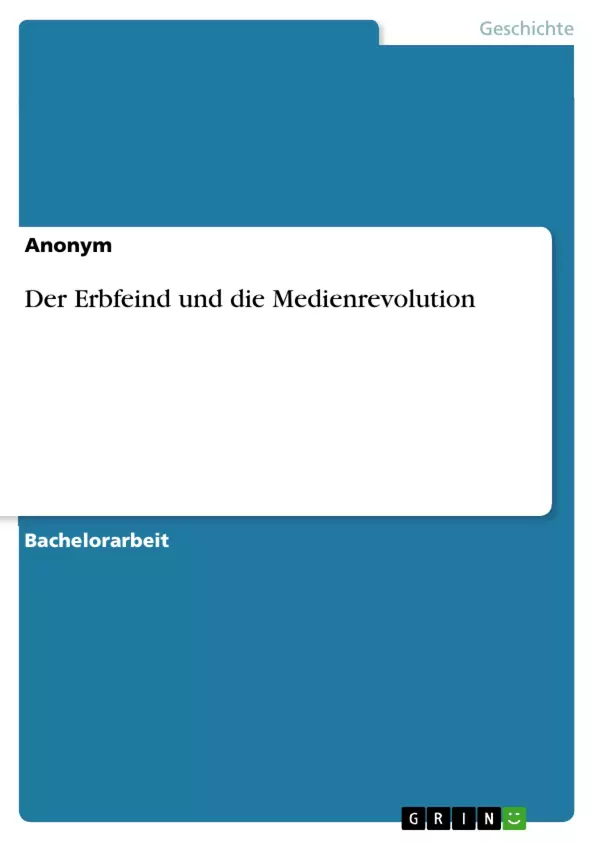Die Türkenkriege des 16. Jahrhunderts waren für diese Manifestierung maßgeblich verantwortlich und so überdauerte das Feindbild in seiner konsolidierten Form die Zeit bis ins 18. Jahrhundert. Das Thema des Erbfeinds der Christenheit war in ganz Europa bekannt gemacht worden, was dem Umstand geschuldet war, dass die Thematik der Türkengefahr im sechszehnten Jahrhundert in zahlreichen Druckerzeugnissen auffindbar war.
Die Erfindung des Buchdrucks und die heilsgeschichtliche Interpretation der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, welche als eine der herausragendsten diskursiven Ereignisse der frühen Neuzeit modelliert werden konnte, waren überaus förderlich für die Formierung einer Gemeinschaft und dem Aufkommen der „Türkengefahr. Der Europabegriff kam nun verstärkt mit der Christenheit in Zusammenhang zur Geltung, wobei er mit der apokalyptischen Dynamik der Türkengefahr verbunden wurde.
Innerhalb der Habsburger-Monarchie kristallisierten sich Auffassungen des Türkenbildes in den hohen Bildungsschichten der Adelskultur und in den niederen Bildungsschichten der Volkskultur heraus. Während der Zeit des Konfliktes waren jene Bilder jedoch eng miteinander verknüpft.
Die mentalen Vorstellungswelten, ein riesiger Informationskomplex, beinhalteten die Urteile, die man sich über die Türken bildete. Diese waren von den Kleinkriegen, Feldzügen, Schlachten, ethnologischen Überlegungen in Reiseberichten und von Diplomaten beeinflusst. Allerdings stellten diese Prägungen lediglich einen Teil dar, was Grothaus prägnant zusammenfasst: „Bilder und kollektive Vorstellungsgeflechte, die sich Völker, Kulturen, Zivilisationen voneinander machten, haben viele Quellen und Informationsebenen zur Grundlage. Sieht man von individuellen Faktoren und Ausnahmen ab, sind diese abhängig von Art, Qualität und Intensität der Beziehungen zwischen den Kulturen untereinander einerseits, von spezifischen soziokulturellen Strukturen und mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen der Zivilisationen andererseits.“
Die Erarbeitung des Türkenbilds ist demnach nicht nur abhängig von zwischenstaatlichen Beziehungen, sondern auch von der Verbindung von geistes- und kulturhistorischen Entwicklungen während der Reformation und Gegenreformation bis hin zur Zeit der Aufklärung, in welcher kosmopolitisches Denken verbreitet wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. FORSCHUNGSSTAND
- 3. HABSBURGER UND OSMANEN IM FRÜHEN 16. JAHRHUNDERT
- 4. DEFINITORISCHE GRUNDLAGEN
- 4.1. Türkengefahr
- 4.2. Türkenfurcht
- 4.3. Flugblätter
- 4.4. Wahrnehmungsmuster
- 5. DAS TÜRKENBILD DES 16. JAHRHUNDERTS
- 5.1. Bedeutung des Buchdrucks
- 5.2. Biblische Motive
- 5.3. Topoi und Stereotypen
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Konstruktion des Türkenbildes in frühen Flugblättern, die im 16. Jahrhundert während der Türkenkriege verbreitet wurden. Sie untersucht die historischen und kulturellen Bedingungen, die zur Entstehung dieses Feindbildes beigetragen haben, und analysiert die verwendeten rhetorischen Mittel und Topoi.
- Die Rolle des Buchdrucks in der Verbreitung von Türkenbildern
- Die Konstruktion der „Türkengefahr“ als Bedrohung für die christliche Welt
- Die Verwendung von biblischen Motiven und Stereotypen in der Darstellung der Türken
- Die Verbindung zwischen dem Türkenbild und den mentalen Vorstellungen der Zeit
- Die Bedeutung des Türkenbildes für die Entstehung eines europäischen Identitätsbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsstand zum Thema Türkenbild in der Frühen Neuzeit beleuchtet. Anschließend werden die historischen Rahmenbedingungen, die die Beziehungen zwischen Habsburgern und Osmanen im 16. Jahrhundert prägten, erläutert. Kapitel 4 definiert wichtige Begriffe wie „Türkengefahr“, „Türkenfurcht“ und „Flugblätter“ und untersucht die Wahrnehmungsmuster des Türkenbildes. Kapitel 5 analysiert die Entstehung und Verbreitung des Türkenbildes im 16. Jahrhundert, wobei der Fokus auf der Bedeutung des Buchdrucks, der Verwendung biblischer Motive und der Verbreitung von Topoi und Stereotypen liegt.
Schlüsselwörter
Türkenbild, Flugblätter, Frühneuzeit, Habsburger, Osmanen, Türkengefahr, Türkenfurcht, Buchdruck, Bibel, Topoi, Stereotypen, Feindbild, Wahrnehmungsmuster, Identitätsbildung, Europa, Mentalität, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept des „Erbfeinds“ im 16. Jahrhundert?
Es beschreibt die Manifestierung der Osmanen als den größten Feind der Christenheit, ein Bild, das durch die Türkenkriege geprägt wurde.
Welche Rolle spielte der Buchdruck bei der „Türkengefahr“?
Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte die massenhafte Verbreitung von Flugblättern, die das Feindbild festigten und eine europäische Gemeinschaft gegen die Bedrohung formten.
Was sind typische Stereotypen in frühen Flugblättern über Türken?
Die Darstellungen nutzten oft biblische Motive, apokalyptische Szenarien und ethnologische Vorurteile, um Angst und Abwehrbereitschaft zu schüren.
Wie unterschied sich das Türkenbild in verschiedenen Bildungsschichten?
Es gab Unterschiede zwischen der Adelskultur und der Volkskultur, jedoch waren die Bilder während der Konfliktzeiten eng miteinander verknüpft.
Welchen Einfluss hatte die Reformation auf das Türkenbild?
Die geistesgeschichtlichen Entwicklungen von Reformation und Gegenreformation prägten die religiöse Deutung der Türkenkriege maßgeblich mit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Der Erbfeind und die Medienrevolution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1286703