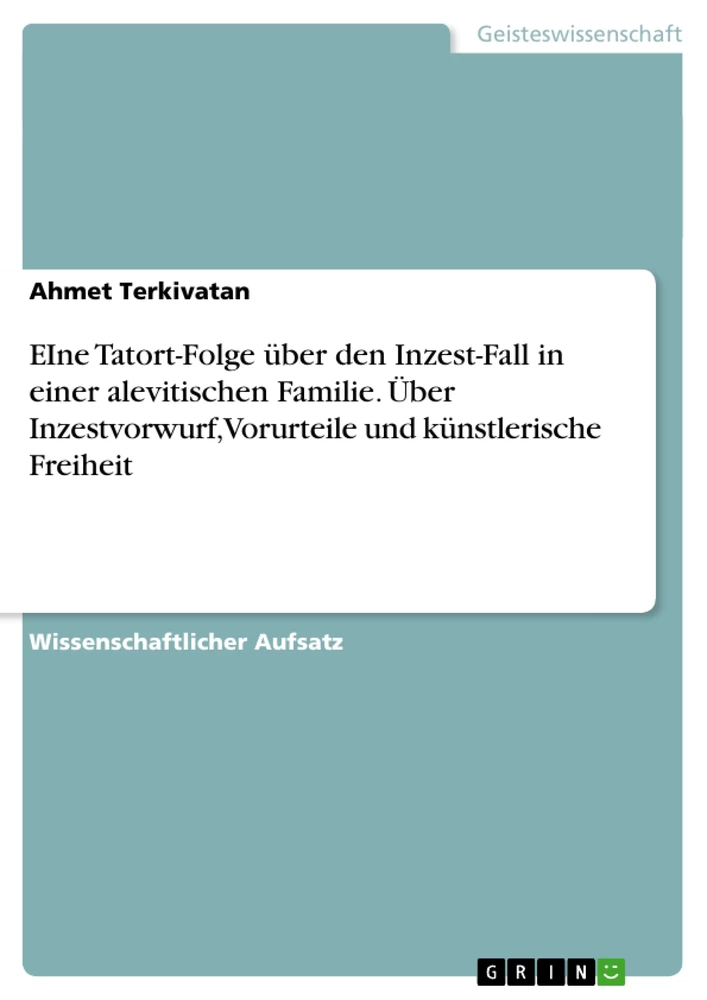Am 23.12.2007 wurde von der ARD der Tatortfilm „Wem Ehre gebührt“ ausgestrahlt. Dabei ging es um einen Inzest-Fall in einer alevitischen Familie, der einen Mord nach sich zog. Die Mitglieder der alevitischen Gemeinschaft und die Alevitische Gemeinde Deutschlands (AABF) waren hierüber zutiefst entsetzt. Über tausend Menschen versammelten sich vor dem ARD-Hauptstadtbüro. Die deutsche Öffentlichkeit war und ist nicht imstande, diese Empörung und diesen Protest nachzuvollziehen. Wie denn auch? Sie beruft sich zwar auf die Kunst- und Redefreiheit, kennt aber weder die Aleviten und das Alevitentum noch die historischen (gesellschaftlichen) Hintergründe für die Empörung über den im Film gezeigten Inzest-Fall in einer alevitischen Familie.
Freiheit und ihre Spielarten, also auch die Kunst- und Redefreiheit gehören zu den wesentlichen Elementen des Alevitentums. Der Protest der Aleviten richtete sich nicht gegen diese starken Prinzipen und Grundlagen offener Gesellschaften, sondern einzig und allein gegen die unreflektierte Darstellung des Inzest-Falles im Zusammenhang mit einer alevitischen Familie.
Der vorliegende Beitrag will aufklären. Er will die historischen Hintergründe dieses Protestes aufzeigen. Er versucht zu ergründen, wie und weshalb Menschen zu gewissen entwürdigenden Vorurteilen gelangen können.
Wer aber – bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich – gewisse entwürdigende Vorurteile (gegen wen und in welcher Form auch immer) weitertransportiert und sich dabei auf Kunst- und Redefreiheit beruft, der verklärt und handelt unverantwortungslos.
Grundlage und Maß menschlicher Freiheit in Form der Kunst- und Redefreiheit ist die Würde des Menschen. Wer für diese Freiheitsformen eintritt, der sollte dabei ebenso die Würde des Menschen beachten. Kein Mensch, keine Kultur, keine Gemeinschaft und dergleichen darf aufgrund seiner Andersartigkeit ausgegrenzt und gedemüdigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Explikation der Fragestellung, Prämissen und einiger methodologischer Grundsätze der Arbeit
- Kritische Explikation einiger die Moral der Kizilbas betreffender Vorurteile
- Explikation des Vorurteils, die Kızılbaş würden Inzest betreiben
- Urheber, Genese und Kontext dieses Vorurteils
- Kritik des die Moral der Kızılbaş betreffenden Vorurteils. Drei Argumente, die gegen M sprechen
- Erstes Argument und Erklärungsversuch
- Zweites Argument
- Drittes Argument
- Abschließende Bemerkung: Was tun?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Beitrag zielt darauf ab, das Vorurteil des Inzests innerhalb der alevitischen Gemeinschaft zu entkräften und die historischen Hintergründe des Protests gegen die Darstellung dieses Vorurteils in den Medien aufzuzeigen. Der Autor untersucht, wie und warum solche entwürdigenden Vorurteile entstehen und verbreitet werden. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse des Vorurteils und der Verteidigung der Würde der alevitischen Gemeinschaft.
- Kritik des Vorurteils über Inzest bei Aleviten
- Historische und soziale Hintergründe des Vorurteils
- Analyse der Entstehung und Verbreitung von Vorurteilen
- Verteidigung der Würde und der Menschenrechte der Aleviten
- Die Bedeutung von Kunst- und Redefreiheit im Kontext der Würde des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Die Vorbemerkung beschreibt den Anlass des Beitrags: Die Empörung der alevitischen Gemeinde über einen ARD-Tatort, der Inzest in einer alevitischen Familie darstellt. Sie unterstreicht die Unkenntnis der Öffentlichkeit über die Aleviten und deren Kultur und betont, dass der Protest nicht gegen die Kunst- und Redefreiheit gerichtet ist, sondern gegen die unwürdige und diskriminierende Darstellung. Der Autor kündigt eine Aufklärung der historischen Hintergründe an und kritisiert die unverantwortliche Verbreitung von Vorurteilen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit.
1. Explikation der Fragestellung, Prämissen und einiger methodologischer Grundsätze der Arbeit: Dieses Kapitel legt die methodologische Grundlage der Arbeit dar. Der Autor erklärt, dass er sich mit einem Vorurteil über die Moral der Kızılbaş auseinandersetzen wird. Er definiert Vorurteile als mehr als nur voreilige Urteile, sondern als Meinungen mit bestimmten Eigenschaften (positiv/negativ, etc.), die in einem bestimmten Kontext stehen. Der Autor kündigt an, die fehlende empirische und argumentative Fundierung des Vorurteils aufzuzeigen und argumentiert, dass die Verwerfung nicht allein aufgrund des Vorurteilscharakters erfolgen sollte, sondern aufgrund seiner Falschheit und Demütigung.
2. Kritische Explikation einiger die Moral der Kizilbas betreffender Vorurteile: Dieses Kapitel untersucht das spezifische Vorurteil des Inzests innerhalb der alevitischen Gemeinschaft. Es analysiert die Entstehung, den Kontext und die Urheber dieses Vorurteils. Der Autor legt den Fokus auf die historische und gesellschaftliche Dimension des Vorurteils, um seine Entstehung und Verbreitung zu erklären. Das Kapitel dient als Grundlage für die spätere Kritik und Widerlegung des Vorurteils.
3. Kritik des die Moral der Kızılbaş betreffenden Vorurteils. Drei Argumente, die gegen M sprechen: Dieses Kapitel präsentiert drei Argumente gegen das Vorurteil des Inzests bei den Aleviten. Jedes Argument wird detailliert erläutert und belegt, um die Fehlbarkeit des Vorurteils aufzuzeigen. Durch eine umfassende Auseinandersetzung mit den einzelnen Argumenten wird die Grundlage für die Schlussfolgerung geschaffen, dass das Vorurteil falsch und demütigend ist. Die Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 liefern die einzelnen Argumente, die hier zusammengefasst und in ihrem Zusammenhang dargestellt werden. Der Fokus liegt auf der umfassenden Widerlegung des Vorurteils mit stichhaltigen Argumenten.
Schlüsselwörter
Aleviten, Kızılbaş, Inzestvorwurf, Vorurteil, Moral, Demütigung, Menschenwürde, Kunstfreiheit, Redefreiheit, historische Hintergründe, kritische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Kritik des Inzestvorwurfs gegen Aleviten
Was ist das Thema des Textes?
Der Text befasst sich mit der Kritik des Vorurteils, Aleviten (auch Kızılbaş genannt) betrieben Inzest. Er untersucht die historischen Hintergründe dieses Vorurteils, analysiert seine Entstehung und Verbreitung und widerlegt es mit drei Argumenten. Auslöser war die Empörung über einen ARD-Tatort, der dieses Vorurteil darstellte.
Welche Ziele verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das Inzestvorurteil gegen Aleviten zu entkräften und die historischen Gründe für den Protest der alevitischen Gemeinde gegen dessen Darstellung in den Medien aufzuzeigen. Er untersucht die Mechanismen der Entstehung und Verbreitung solcher Vorurteile und verteidigt die Würde und die Menschenrechte der Aleviten. Es geht nicht um eine Einschränkung der Kunst- und Redefreiheit, sondern um die Bekämpfung diskriminierender Darstellungen.
Welche methodischen Grundsätze werden angewendet?
Der Autor definiert Vorurteile als Meinungen mit bestimmten Eigenschaften (positiv/negativ etc.), die in einem Kontext stehen. Er kündigt an, die fehlende empirische und argumentative Fundierung des Inzestvorwurfs aufzuzeigen und argumentiert, dass dessen Verwerfung nicht nur aufgrund seines Charakters als Vorurteil, sondern aufgrund seiner Falschheit und Demütigung erfolgen sollte. Die Arbeit basiert auf einer kritischen Analyse und der Auseinandersetzung mit historischen und sozialen Hintergründen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Eine Vorbemerkung, die den Anlass des Beitrags (der ARD-Tatort) erklärt; die Explikation der Fragestellung und der methodischen Vorgehensweise; eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inzestvorurteil, inklusive der Analyse seiner Entstehung und des Kontextes; und schließlich die Widerlegung des Vorurteils mit drei Argumenten. Abschließend gibt es eine Bemerkung mit Überlegungen zum weiteren Vorgehen.
Welche Argumente werden gegen das Inzestvorurteil vorgebracht?
Der Text präsentiert drei detailliert erläuterte Argumente gegen das Inzestvorurteil. Diese Argumente werden im Detail in den entsprechenden Kapiteln dargelegt und zielen darauf ab, die Falschheit und Demütigung, die von diesem Vorurteil ausgeht, aufzuzeigen. Die spezifischen Argumente werden im Text selbst detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Aleviten, Kızılbaş, Inzestvorwurf, Vorurteil, Moral, Demütigung, Menschenwürde, Kunstfreiheit, Redefreiheit, historische Hintergründe, kritische Analyse.
Welche Bedeutung hat die Kunst- und Redefreiheit im Kontext des Textes?
Der Text betont, dass der Protest gegen die Darstellung des Inzestvorurteils im Tatort nicht gegen die Kunst- und Redefreiheit gerichtet ist. Vielmehr geht es um die Bekämpfung von unwürdigen und diskriminierenden Darstellungen, die die Würde der Aleviten verletzen. Die Meinungsfreiheit darf nicht als Deckmantel für die Verbreitung von Vorurteilen und die Verunglimpfung von Minderheiten missbraucht werden.
Wie wird die alevitische Gemeinschaft in diesem Text dargestellt?
Der Text zeigt Empathie und Solidarität mit der alevitischen Gemeinschaft. Er verteidigt ihre Würde und Menschenrechte und kritisiert die unwürdige und diskriminierende Darstellung in den Medien. Der Fokus liegt auf der Aufklärung und der Widerlegung von Vorurteilen.
- Quote paper
- Dr. phil. Ahmet Terkivatan (Author), 2003, Eine Tatort-Folge über den Inzest-Fall in einer alevitischen Familie. Über Inzestvorwurf, Vorurteile und künstlerische Freiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128772