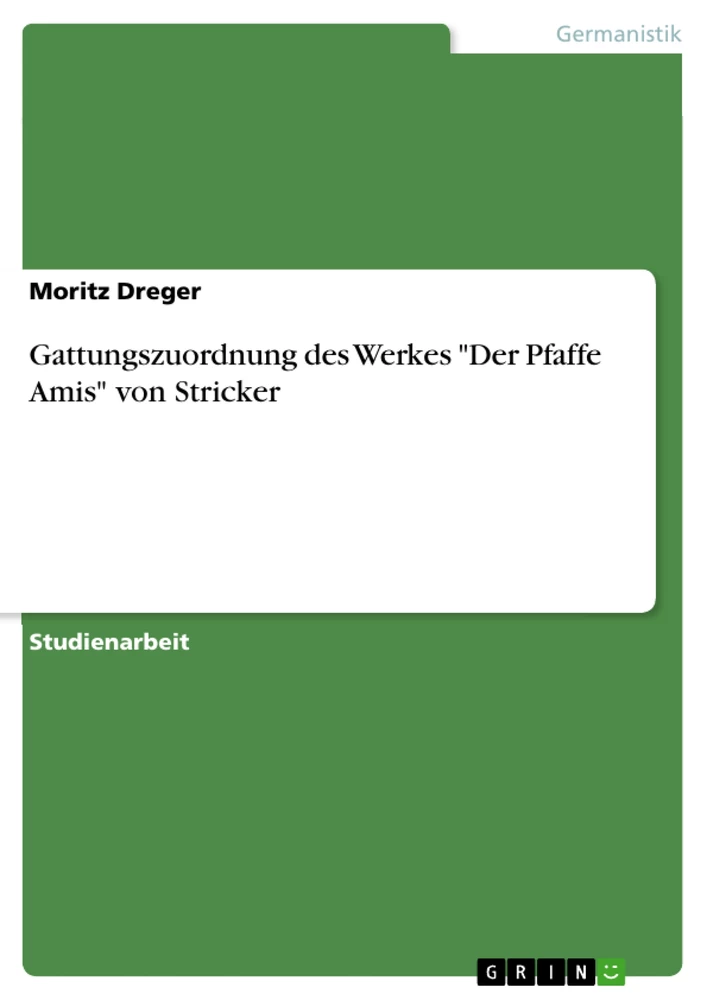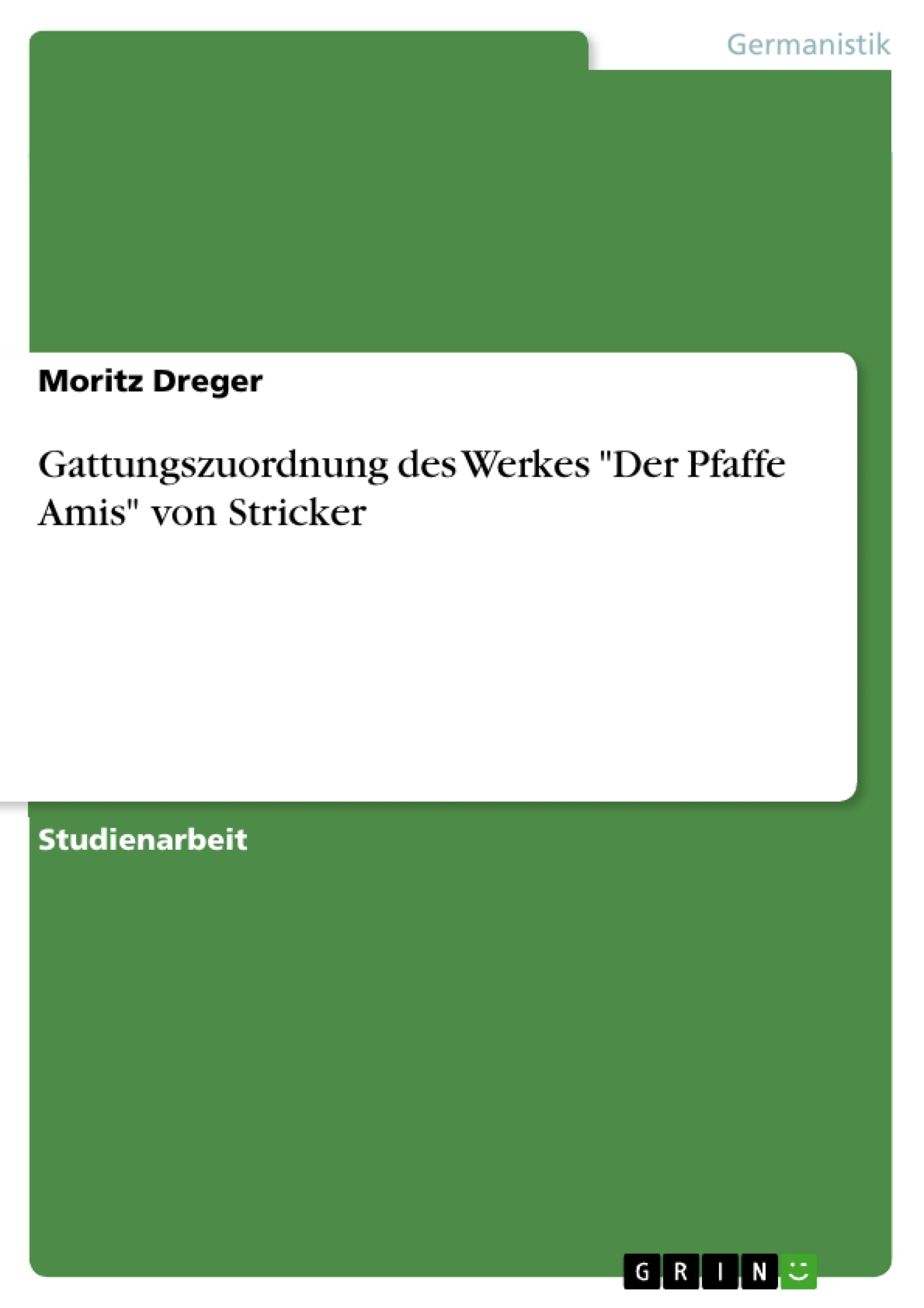In dieser Hausarbeit wird die Gattung des Werkes 'Der Pfaffe Amis' von Stricker diskutiert und erörtert. Es werden mögliche Gattungen vorgestellt und jeweils in einen Bezug zum Werk von Stricker gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchung der Gattungszuordnung des Werkes
- Schwank
- Narrendichtung
- Höfischer Roman
- Artusroman
- Komischer Roman
- Spielmannsepos
- Legendenroman
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gattungszuordnung des mittelhochdeutschen Werkes "Der Pfaffe Amis" vom Stricker. Sie analysiert die verschiedenen gattungsspezifischen Merkmale, die im Werk zu finden sind, um zu klären, ob es sich um ein Werk einer bestimmten Gattung handelt oder ob es sich um einen Sonderfall handelt, der Elemente aus verschiedenen Gattungen vereint.
- Untersuchung der gattungsspezifischen Merkmale des Werkes
- Analyse der Figuren und ihrer Handlungen im Kontext der jeweiligen Gattung
- Bewertung der Übereinstimmung des Werkes mit den jeweiligen Gattungsmerkmalen
- Diskussion der möglichen Gattungszuordnung des Werkes
- Beurteilung der Bedeutung des Werkes im gattungsgeschichtlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk "Der Pfaffe Amis" vom Stricker im Kontext der gattungsgeschichtlichen Entwicklung des 13. Jahrhunderts vor. Sie diskutiert die Schwierigkeit, das Werk eindeutig einer Gattung zuzuordnen, da es Merkmale verschiedener Gattungen aufweist. Die Einleitung führt die wichtigsten Gattungsformen ein, die in der Arbeit genauer untersucht werden, und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit.
Untersuchung der Gattungszuordnung des Werkes
Schwank
Dieses Kapitel untersucht die Merkmale des Schwanks in "Der Pfaffe Amis". Es analysiert die Episoden des Werkes hinsichtlich ihrer typischen Schwankmerkmale wie Überlistung, Komik und Belehrung. Die Kapitel analysiert die Episoden des Werkes hinsichtlich ihrer typischen Schwankmerkmale wie Überlistung, Komik und Belehrung.
Narrendichtung
Dieses Kapitel behandelt die Gattung der Narrendichtung im Kontext von "Der Pfaffe Amis". Es analysiert die Rolle des Pfaffen Amis als Narr und seine charakteristischen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Narrenfiguren aus der Narrendichtung.
Schlüsselwörter
Der Pfaffe Amis, Gattungszuordnung, Schwank, Narrendichtung, höfischer Roman, Artusroman, komischer Roman, Spielmannsepos, Legendenroman, Mittelhochdeutsch, Spätmittelalter, Gattungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Gattung gehört „Der Pfaffe Amis“ an?
Das Werk lässt sich nicht eindeutig zuordnen. Es enthält Elemente des Schwanks, der Narrendichtung, des komischen Romans und zeigt sogar Parallelen zum höfischen Roman und Legendenroman.
Wer war der Autor des Werkes?
Der Verfasser ist „Der Stricker“, ein bedeutender mittelhochdeutscher Dichter des 13. Jahrhunderts, der als Wegbereiter der kurzepischen Gattung des Schwanks gilt.
Was ist der Inhalt von „Der Pfaffe Amis“?
Das Werk erzählt in mehreren Episoden von einem listigen Priester, der durch verschiedene Betrügereien und schlagfertige Antworten zu Reichtum kommt und seine Gegner überlistet.
Inwiefern ist das Werk ein Schwank?
Es nutzt typische Schwankelemente wie die Überlistung (List), die Komik der Situation und eine oft amoralische, aber lehrreiche Auflösung der Konflikte.
Welche Rolle spielt die Narrendichtung in diesem Kontext?
Amis agiert oft wie eine Narrenfigur, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Er nutzt die Dummheit und Gier anderer aus, um deren Fehlverhalten zu entlarven.
- Quote paper
- Moritz Dreger (Author), 2020, Gattungszuordnung des Werkes "Der Pfaffe Amis" von Stricker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1287928