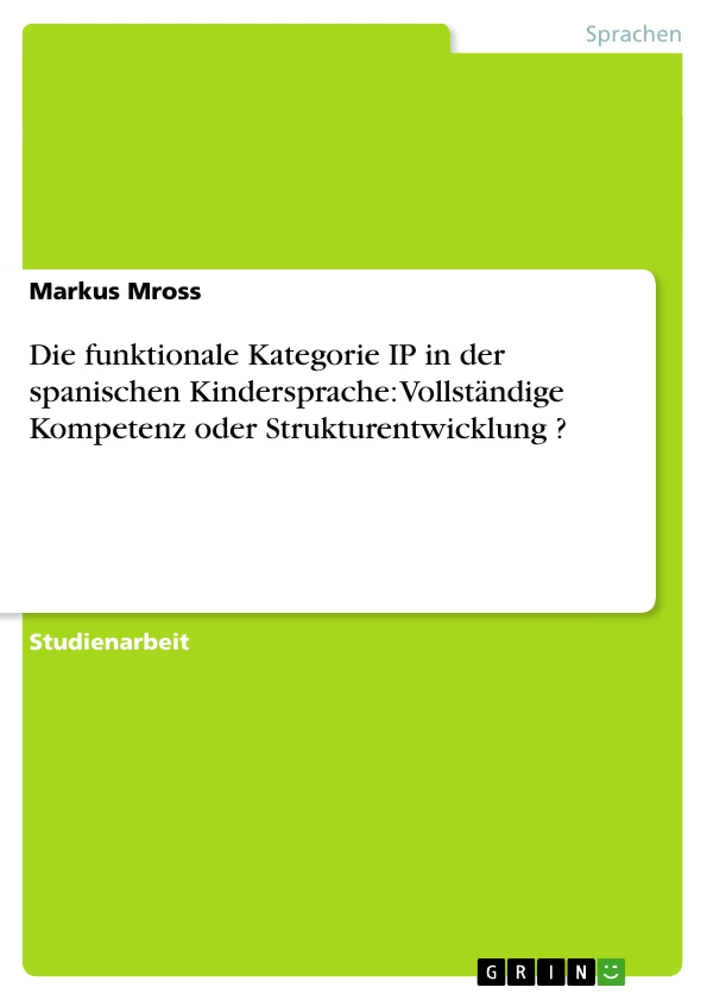Einleitung
Ich werde zunächst die konkurrierenden Erklärungsansätze der "Structure Building Hypothesis" und der "Full Competence Hypothesis" gegenüberstellen und die Argumente analysieren, auf welche sich beide Theorien stützen. Hier soll insbesondere auf die unterschiedlichen Ausgangspositionen beider Hypothesen eingegangen werden. Guilfoyle & Noonans (1992) Strukturbildungshypothese stützt sich grundsätzlich auf das Prinzip der biologischen Reifung kognitiver Mechanismen. Einer Annahme der "Structure Building Hypothesis" zufolge werden Parameterwerte durch "Trigger" im sprachlichen Input des Kindes ausgelöst. Dadurch wird die Entwicklung einer vollen sprachlichen Kompetenz unterstützt. Poeppel & Wexlers (1993) "Full Competence Hypothesis" geht von einer prinzipiell voll entwickelten sprachlichen Kompetenz des Kindes aus. Die Idee einer biologischen Reifung von kognitiven Mechanismen wird grundsätzlich abgelehnt. Durch die Gegenüberstellung beider Ansätze sollen sowohl die Vor- wie auch die Nach- teile der zwei Theorien hervorgehoben werden. Dieser erste Schritt soll bereits einige empirische Grundlagen zur Bewertung beider Theorien als Erklärungsansätze für den kindlichen Erstspracherwerb liefern. Desweiteren soll Chomskys (1989) "Functional Parameterization Hypothesis", wonach sich Parametrisierung ausschließlich auf funktionale Kategorien beschränkt, berücksichtig werden. So soll die Analyse des kindlichen Erstspracherwerbes durch die "Structure Building Hypothesis" und die "Full Competence Hypothesis" mittels einer Überprüfung an sprachlichen Daten des Spanischen dargestellt und nachvollziehbar gemacht werden. Bei dieser Darstellung soll die funktionale Kategorie IP im Vordergrund stehen. Ich werde bei der Analyse von sprachlichen Daten des Spanischen auf den Erwerb der funktionalen Kategorie IP sowie den Erwerb von damit verbundenen grammatischen Prozessen eingehen. So soll der Erwerb von grammatischen Prozessen wie NP-Bewegung und Kongruenzmarkierung durch das Hervortreten von IP-Systemen in der kindlichen Grammatik erklärt werden. Von speziellem Interesse sollen die Erklärungsansätze der "Structure Building Hypothesis" und der "Full Competence Hypothesis" für den Erwerb der funktionalen Kategorie IP sein. Anhand dieses weiteren Schrittes hoffe ich, zusätzliche empirische Argumente zur Bewertung beider Hypothesen als Erklärungsansätze für den kindlichen Erstspracherwerb liefern zu können...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundzüge der ausgewählten Positionen
- Guilfoyle & Noonan (1992)
- Poeppel & Wexler (1993)
- Diskussion der Ansätze
- Lernbarkeitsprobleme der „Structure Building Hypothesis“ und der „,Full Competence Hypothesis“
- Lernbarkeitsprobleme der „Structure Building Hypothesis“
- Borer & Wexlers (1987) „Triggering Problem“
- Roeper & Weissenborns (1990) „Unique Trigger Solution“
- Das „Pendulum Problem“ und „Parameter-Resetting“
- Lernbarkeitsprobleme der „Full Competence Hypothesis“
- Die frühe Verfügbarkeit einer vollen erwachsenen Kompetenz
- Beobachtbare Erwerbssequenzen während der „Zweiwortstufe“
- Das Setzen von Parametern
- Lernbarkeitsprobleme der „Structure Building Hypothesis“
- Die funktionale Kategorie IP in der spanischen Kindersprache
- Mahlau (1994)
- Die Position der Subjekte und die Kongruenz
- Die Position der Objekte
- Larrañaga
- Der Nominativ
- Der Akkusativ
- Der präpositionale Kasus
- Fernández Martínez (1994)
- Das Erlernen des Verballexems ohne morphologische Variation
- Das Erlernen der morphosyntaktischen Variationen des Verbes
- Mahlau (1994)
- Eine erste Evaluation der „Structure Building Hypothe-sis“ und der „,Full Competence Hypothesis“
- Eine Analyse des kindlichen Erstspracherwerbes durch die „Structure Building Hypothesis“ und die „Full Com-petence Hypothesis“
- Die Aufzeichnung M (2;01,337)
- Eine Analyse der Aufzeichnung M (2;01,337) durch die „Structure Building Hypothesis“
- Eine Analyse der Aufzeichnung M (2;01,337) durch die „,Full Competence Hypothesis“
- Die Aufzeichnung M (1;11,14)
- Eine Analyse der Aufzeichnung M (1;11,14) durch die „Struture Building Hypothesis“
- Eine Analyse der Aufzeichnung M (1;11,14) durch die „Full Competence Hypothesis“
- Die Aufzeichnung M (2;01,337)
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Analyse des kindlichen Erstspracherwerbs im Spanischen. Ziel ist es, die „Full Competence Hypothesis“ von Poeppel & Wexler (1993) und die „Structure Building Hypothesis“ von Guilfoyle & Noonan (1992) als Erklärungsansätze für den Spracherwerb zu untersuchen und ihre Erklärungskraft zu vergleichen. Dazu werden die Hypothesen auf ihre Lernbarkeitsprobleme hin analysiert und anschließend anhand von empirischen Daten aus der spanischen Kindersprache überprüft.
- Lernbarkeitsprobleme der „Full Competence Hypothesis“ und der „Structure Building Hypothesis“
- Die funktionale Kategorie IP in der spanischen Kindersprache
- Evaluation der Hypothesen anhand von empirischen Daten
- Analyse des kindlichen Erstspracherwerbs durch die „Structure Building Hypothesis“ und die „Full Competence Hypothesis“
- Vergleich der Erklärungskraft beider Hypothesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des kindlichen Erstspracherwerbs und die beiden zu untersuchenden Hypothesen, „Full Competence Hypothesis“ und „Structure Building Hypothesis“, ein. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die Methodik, die zur Analyse verwendet wird.
- Grundzüge der ausgewählten Positionen: In diesem Kapitel werden die beiden Theorien der „Full Competence Hypothesis“ und der „Structure Building Hypothesis“ vorgestellt und ihre grundlegenden Annahmen sowie Kernpunkte erläutert.
- Diskussion der Ansätze: Dieses Kapitel untersucht die Lernbarkeitsprobleme, die mit den beiden Hypothesen verbunden sind. Es werden verschiedene Argumente und Theorien zur Erklärung der Schwierigkeiten beim Erwerb der grammatikalischen Strukturen behandelt.
- Die funktionale Kategorie IP in der spanischen Kindersprache: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der funktionalen Kategorie IP in der spanischen Kindersprache. Es werden die Ergebnisse verschiedener Studien zu den Positionen der Subjekte und Objekte sowie zur Kongruenz und Kasusmarkierung diskutiert.
- Eine erste Evaluation der „Structure Building Hypothesis“ und der „,Full Competence Hypothesis“: Dieses Kapitel bietet eine erste Evaluation der beiden Hypothesen auf Basis der bisherigen Diskussion der Lernbarkeitsprobleme und der empirischen Daten aus der spanischen Kindersprache.
- Eine Analyse des kindlichen Erstspracherwerbes durch die „Structure Building Hypothesis“ und die „Full Com-petence Hypothesis“: Dieses Kapitel analysiert zwei konkrete Aufzeichnungen von Kindern im Alter von 2;01,337 und 1;11,14 Jahren. Es wird untersucht, wie die „Structure Building Hypothesis“ und die „Full Competence Hypothesis“ die beobachteten sprachlichen Fähigkeiten der Kinder erklären können.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Erklärungskraft der „Structure Building Hypothesis“ und der „Full Competence Hypothesis“ für den kindlichen Erstspracherwerb im Spanischen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen "Full Competence Hypothesis", "Structure Building Hypothesis", kindlicher Erstspracherwerb, IP (inflektierende Phrase), spanische Kindersprache, Lernbarkeitsprobleme, morphologische Variation, Kongruenz, Kasusmarkierung, empirische Daten, Analyse von Sprachdaten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Full Competence Hypothesis“?
Diese Theorie von Poeppel & Wexler geht davon aus, dass Kinder von Beginn an über eine prinzipiell voll entwickelte sprachliche Kompetenz verfügen.
Was besagt die „Structure Building Hypothesis“?
Laut Guilfoyle & Noonan reifen kognitive Mechanismen biologisch; sprachliche Strukturen werden erst nach und nach durch „Trigger“ im Input aufgebaut.
Welche Rolle spielt die Kategorie IP in der spanischen Kindersprache?
Die inflektierende Phrase (IP) ist zentral für den Erwerb von Grammatikprozessen wie NP-Bewegung, Kongruenzmarkierung und Kasus (Nominativ/Akkusativ).
Was ist das „Triggering Problem“?
Ein Lernbarkeitsproblem der Strukturbildungshypothese, das fragt, wie genau sprachliche Reize die Entwicklung neuer grammatischer Parameter auslösen.
Wie wurden die Hypothesen empirisch geprüft?
Durch die Analyse von Sprachdaten spanischer Kinder in verschiedenen Altersstufen (z.B. 1;11 und 2;01 Jahre).
- Lernbarkeitsprobleme der „Structure Building Hypothesis“ und der „,Full Competence Hypothesis“
- Citation du texte
- Markus Mross (Auteur), 1999, Die funktionale Kategorie IP in der spanischen Kindersprache: Vollständige Kompetenz oder Strukturentwicklung ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12882