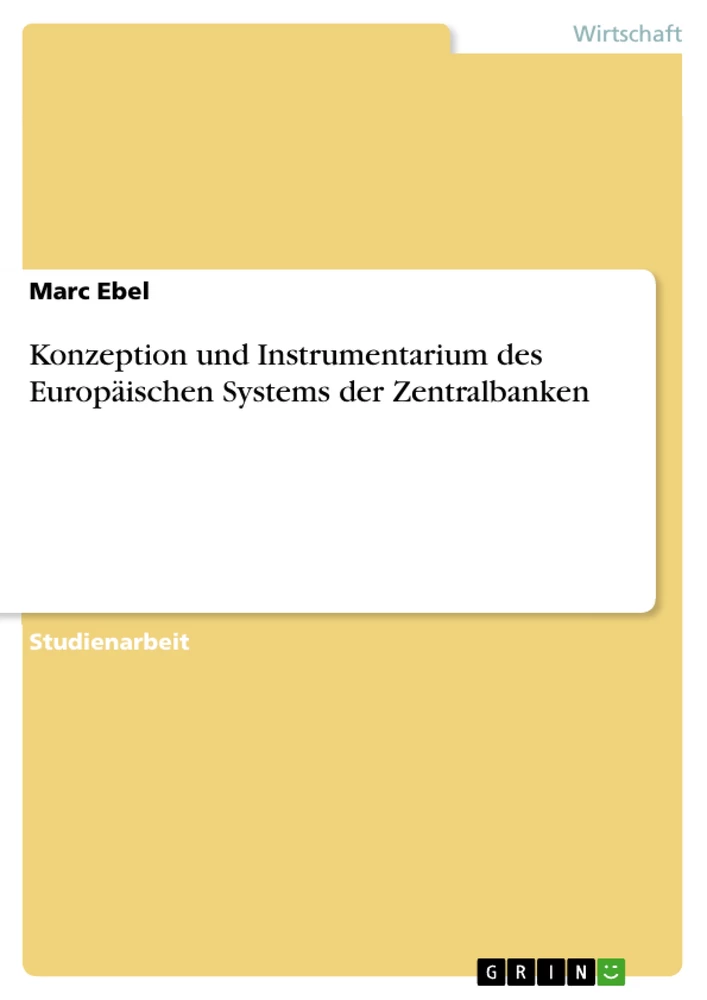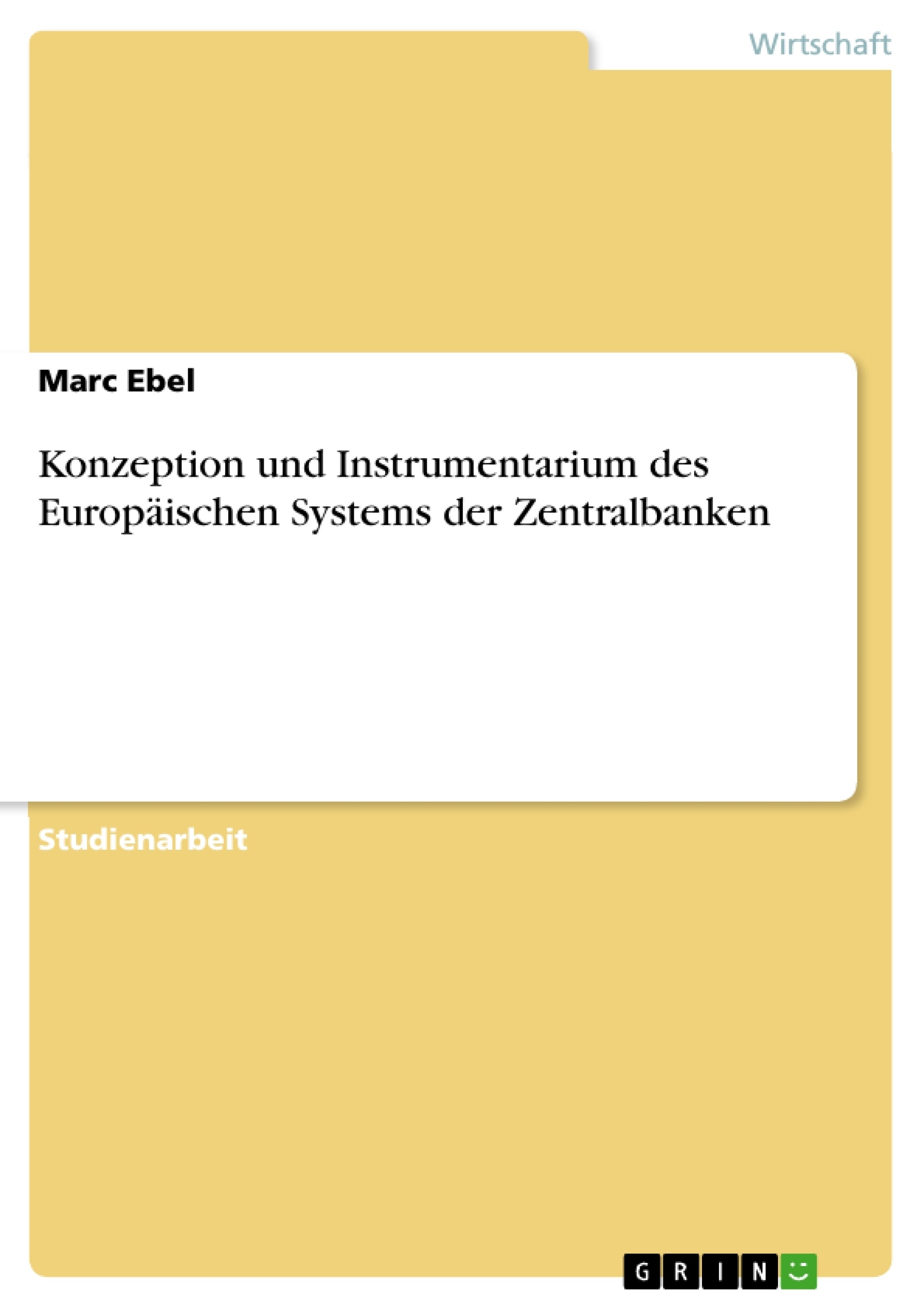Am 1. Januar 1999 wurden die Wechselkurse der Landeswährungen der an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) teilnehmenden Ländern gegenüber dem Euro festgelegt. Damit wurde die dritte und letzte Stufe der EWWU eingeleitet. Diese dritte Stufe stellt die Umstellung der nationalen Währungen auf eine neue, gemeinsame europäische Währung, den EURO dar.
Jedoch nicht alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) nehmen an dieser dritten Stufe der europäischen Währungsunion teil, wie auf dem Europäischen Gipfel in Brüssel Anfang Mai 1998 entschieden wurde. So verfehlte Griechenland die im Vertrag von Maastricht niedergelegten Bedingungen für den Beitritt (Konvergenzkriterien), Dänemark und Großbritannien hatten von ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht, der Währungsunion nicht beizutreten und Schweden hat sich vorbehalten, erst zu einem späteren Zeitpunkt an dem Europäischen Währungssystem teilzunehmen1. Demnach nehmen an der Europäischen Währungsunion die folgenden Staaten teil: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Organisation des Europäischen Systems der Zentralbanken
- Konzeption der Geldpolitischen Strategie des ESZB
- Instrumentarium des ESZB
- Offenmarktpolitik
- Ständige Fazilitäten
- Mindestreservepolitik
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Konzeption und dem Instrumentarium des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Der Fokus liegt darauf, die Organisation des ESZB, seine geldpolitische Strategie und die dafür verfügbaren Instrumente zu erläutern.
- Organisation des ESZB und seine föderale Struktur
- Die geldpolitische Strategie des ESZB
- Das Instrumentarium des ESZB, insbesondere Offenmarktpolitik, ständige Fazilitäten und Mindestreservepolitik
- Die Unabhängigkeit des ESZB und seine Veröffentlichungspflicht
- Die Orientierung des ESZB an der Deutschen Bundesbank
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einführung erläutert den Hintergrund und die Relevanz der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), insbesondere die Einführung des Euro und die Rolle des ESZB.
- Organisation des Europäischen Systems der Zentralbanken: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur des ESZB, bestehend aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der teilnehmenden Länder. Der Abschnitt beleuchtet die Entscheidungsstrukturen innerhalb des ESZB, insbesondere die Rolle des Direktoriums und des EZB-Rates.
- Konzeption der Geldpolitischen Strategie des ESZB: Dieses Kapitel erläutert die grundlegende Strategie des ESZB in Bezug auf die Geldpolitik. Es untersucht die Ziele und die Mechanismen, die zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden.
- Instrumentarium des ESZB: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Instrumenten, die das ESZB zur Steuerung der Geldpolitik einsetzt. Diese umfassen Offenmarktpolitik, ständige Fazilitäten und Mindestreservepolitik.
Schlüsselwörter
Wichtige Schlüsselwörter der Seminararbeit sind: Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Offenmarktpolitik, ständige Fazilitäten, Mindestreservepolitik, Währungsunion, Euro, Deutsche Bundesbank, Unabhängigkeit, Veröffentlichungspflicht.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah am 1. Januar 1999 in der europäischen Währungsunion?
An diesem Datum wurden die Wechselkurse der Landeswährungen gegenüber dem Euro festgelegt und die dritte Stufe der EWWU eingeleitet.
Welche Länder nahmen zu Beginn nicht an der Währungsunion teil?
Griechenland verfehlte zunächst die Konvergenzkriterien, während Dänemark und Großbritannien von ihrer Opt-out-Möglichkeit Gebrauch machten. Schweden behielt sich einen späteren Beitritt vor.
Aus welchen Teilen besteht das ESZB?
Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) besteht aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten.
Was sind die wichtigsten geldpolitischen Instrumente des ESZB?
Die Hauptinstrumente sind die Offenmarktpolitik, die ständigen Fazilitäten und die Mindestreservepolitik.
Wie ist die Struktur des ESZB organisiert?
Das ESZB hat eine föderale Struktur, wobei die Entscheidungen maßgeblich durch das Direktorium und den EZB-Rat getroffen werden.
Welche Rolle spielt die Unabhängigkeit für das ESZB?
Die Unabhängigkeit ist zentral für die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, wobei das ESZB gleichzeitig einer Veröffentlichungspflicht unterliegt.
- Arbeit zitieren
- Marc Ebel (Autor:in), 1999, Konzeption und Instrumentarium des Europäischen Systems der Zentralbanken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12886