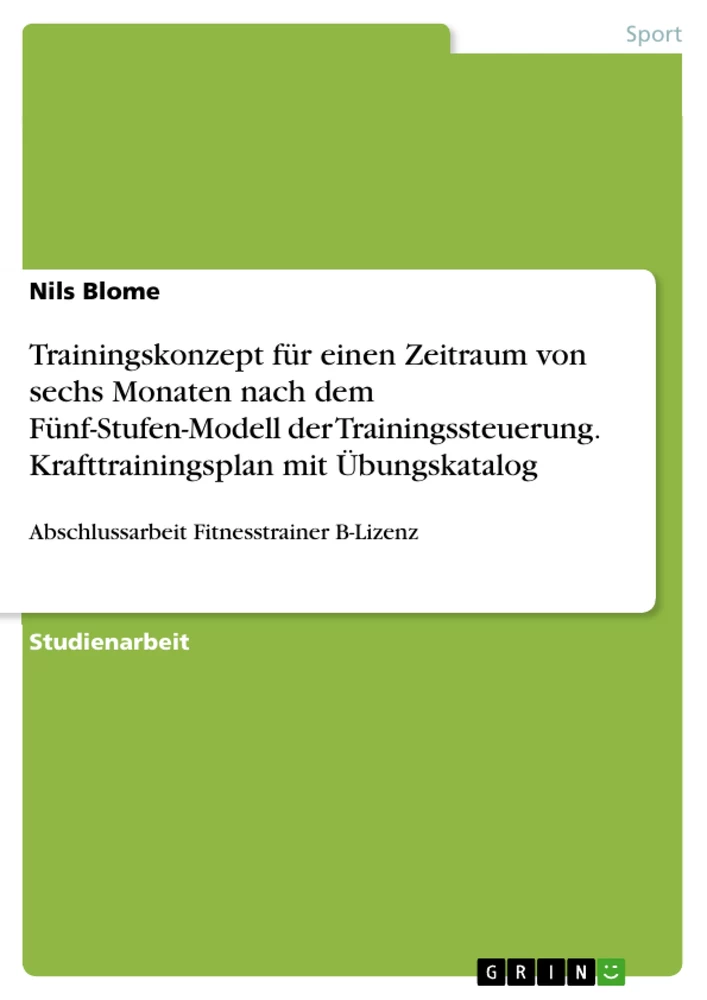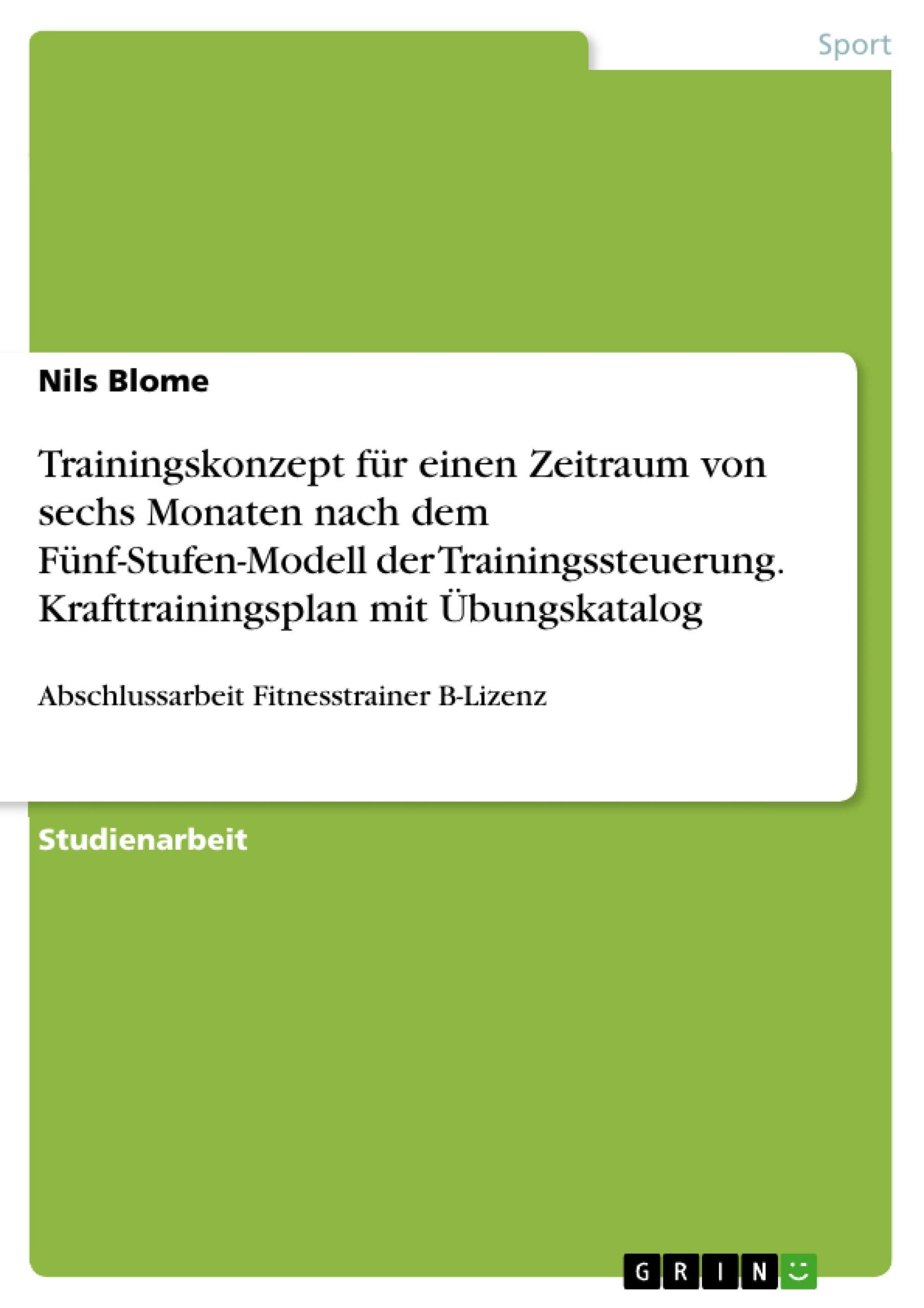Ein Trainingskonzept für den Zeitraum von sechs Monaten, nach den Grundsätzen des Fünf-Stufen-Modells der Trainingssteuerung. Erstellter Krafttrainingsplan mit dazugehörigem Übungskatalog für einen frei gewählten Kunden. In der ersten Stufe der Trainingsteuerung werden mittels eines Eingangsgesprächs und Eingangstest wichtige Eckdaten über den Kunden ermittelt, welche Auskunft über dessen Ist-Zustand geben. Dadurch kann der aktuelle Gesundheits- und Fitnesszustand festgestellt werden.
Anhand dieser Eckdaten können anschließend in der zweiten Stufe die Prognose, Ziele und Motive des Kunden formuliert werden. In der dritten Stufe, der Trainingsteuerung, wird die Trainingsplanung durchgeführt. An dieser Stelle wird unter anderem über geeignete Trainingsmethoden bzw. Trainingsübungen entschieden, sowie auch die zeitliche Planung der Zyklen, die sogenannte Periodisierung.
Die vierte Stufe der Trainingsteuerung ist die Durchführung selbst. Der Kunde/ die Kundin wird hierbei vom Trainer/in in die Geräte eingewiesen - hierbei haben Trainer eine kontrollierende Funktion. Nach der Durchführung der Übungen kann vom Kunden ein Feedback entgegengenommen werden.
Der letzte Schritt der Trainingssteuerung ist die Analyse bzw. der Re-Test. In der Analyse wird das Trainingsprogramm vom Trainer/in bewertet. Durch den Re-Test und die dazu gehörende Dokumentation kann der Trainingserfolg verdeutlicht werden.
Der abgeschlossene Trainingszyklus wird somit ins Auge gefasst und es lassen sich Rückschlüsse für die weitere Trainingsplanung ziehen. Die Ergebnisse können auch rückwirkend Einfluss auf die Prognose und Trainingsplanung haben. Das heißt, dass Zielsetzung und Trainingsplan entsprechend aktualisiert und dem neuen Leistungsstand angepasst werden. Durch die schriftliche Dokumentation ist es dem Kunden jederzeit möglich, seinen Fortschritt einsehen zu können. Dadurch können Motivation und Bindung des Kunden an das Fitnessstudio gesteigert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Diagnose
- 1.1 Anamnese
- 1.1.1 Allgemeine Daten
- 1.1.2 Wichtige Eckdaten des Kunden
- 1.1.3 Biometrische Tests
- 1.1.4 Körperabmessungen
- 1.2 Trainingsplanung
- 1.1 Anamnese
- 2 Trainingssteuerung
- 2.1 Eingangstest durch ILB-Methode
- 2.2 Makrozyklus
- 2.2.1 Erläuterung der Trainingszyklen
- 2.3 Erläuterung zum gewählten Trainingssystem
- 2.4 Mesozyklus 1 Trainingsplan
- 2.5 Mesozyklus 2 Trainingsplan
- 2.6 Grundlagen des Aufwärmens im Fitnesssport
- 3 Trainingsdurchführung
- 3.1 Grundlegendes zu Atmung und Bewegungstempo
- 3.2 Dehn- und Aufwärmübungen
- 3.2.1 Dehnübung für die Brustmuskulatur
- 3.2.2 Dehnübung für die Rückenmuskulatur
- 3.2.3 Dehnübung für die Bein- und Gesäßmuskulatur
- 3.2.4 Dehnübung für die Bauchmuskulatur
- 3.3 Übungsdetails
- 3.3.1 Brustpresse an der Maschine, sitzend
- 3.3.2 Butterfly an der Maschine, sitzend
- 3.3.3 Latzug breiter Griff, Seilzug
- 3.3.4 Rudern Eng, Seilzug
- 3.3.5 Beinpresse 45°, sitzend
- 3.3.6 Beinbeugen an der Maschine, sitzend
- 3.3.7 Rückenstrecken an der Maschine
- 3.3.8 Normale Crunches, Hände seitlich am Kopf
- 3.4 Grundlagen des Abwärmens im Fitnesssport
- 4 Re-Test
- 4.1 Analyse
- 4.1.1 Wichtige Eckdaten des Kunden (Analyse)
- 4.1.2 Körperabmessungen (Analyse)
- 4.1.3 Re-Test Übungen
- 4.1 Analyse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abschlussarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Trainingsprogramm für einen Kunden im Fitnesssport zu erstellen, welches sich an den Prinzipien des Fünf-Stufen-Modells der Trainingssteuerung orientiert. Das Programm umfasst die Diagnose des Ausgangszustands des Kunden, die Formulierung von Zielen und Motiven, die Planung und Durchführung des Trainings sowie die Analyse des Trainingserfolgs.
- Individuelle Trainingsplanung im Fitnesssport
- Anwendung des Fünf-Stufen-Modells der Trainingssteuerung
- Diagnose des Ausgangszustands des Kunden
- Zielsetzung und Motivation
- Trainingsplanung und -durchführung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Diagnose des Kunden und beinhaltet die Erhebung von Anamnesedaten wie allgemeine Informationen, wichtige Eckdaten, biometrische Tests und Körperabmessungen. Das zweite Kapitel behandelt die Trainingssteuerung und erläutert die ILB-Methode als Eingangstest, den Makrozyklus mit seinen Trainingszyklen sowie das gewählte Trainingssystem. Weiterhin werden die Trainingspläne für Mesozyklus 1 und 2 vorgestellt sowie Grundlagen des Aufwärmens im Fitnesssport dargelegt.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Trainingsdurchführung. Es werden die Grundprinzipien von Atmung und Bewegungstempo sowie verschiedene Dehn- und Aufwärmübungen vorgestellt. Des Weiteren werden Übungseinheiten mit ausführlichen Details zu Übungen wie Brustpresse, Butterfly, Latzug, Rudern, Beinpresse, Beinbeugen, Rückenstrecken und Crunches erläutert. Abschließend werden Grundlagen des Abwärmens im Fitnesssport behandelt.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Re-Test und der Analyse der Trainingserfolge. Es werden die wichtigen Eckdaten des Kunden und Körperabmessungen nach dem Re-Test analysiert sowie die Ergebnisse der Re-Test-Übungen dargestellt.
Schlüsselwörter
Trainingsplanung, Fitnesssport, Fünf-Stufen-Modell, Trainingssteuerung, Diagnose, Anamnese, Biometrische Tests, Körperabmessungen, ILB-Methode, Makrozyklus, Mesozyklus, Aufwärmen, Abwärmen, Trainingsübungen, Analyse, Re-Test.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Fünf-Stufen-Modell der Trainingssteuerung?
Es ist ein systematischer Prozess im Fitnesssport, bestehend aus: 1. Diagnose, 2. Zielsetzung, 3. Trainingsplanung, 4. Durchführung und 5. Analyse/Re-Test.
Wozu dient der Re-Test im Krafttraining?
Der Re-Test ermöglicht es, den Trainingserfolg objektiv zu dokumentieren. Die Ergebnisse dienen als Basis für die Aktualisierung des Trainingsplans und steigern die Motivation des Kunden durch sichtbare Fortschritte.
Was versteht man unter der ILB-Methode?
Die ILB-Methode (Individuelles-Leistungsbild-Methode) dient als Eingangstest zur Ermittlung der optimalen Trainingsintensität, ohne den Kunden maximal zu belasten, was besonders für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet ist.
Was ist der Unterschied zwischen Makro- und Mesozyklus?
Ein Makrozyklus beschreibt die langfristige Planung (z. B. 6 Monate), während ein Mesozyklus ein mittelfristiger Unterabschnitt (z. B. 4-8 Wochen) ist, der sich auf ein bestimmtes Trainingsziel wie Kraftausdauer oder Muskelaufbau konzentriert.
Welche Rolle spielt das Aufwärmen und Abwärmen?
Das Aufwärmen bereitet den Körper physiologisch auf die Belastung vor und senkt das Verletzungsrisiko. Das Abwärmen (Cool-down) leitet die Regenerationsphase ein und hilft beim Abbau von Stoffwechselprodukten.
- Citar trabajo
- Nils Blome (Autor), 2021, Trainingskonzept für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Fünf-Stufen-Modell der Trainingssteuerung. Krafttrainingsplan mit Übungskatalog, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1288912