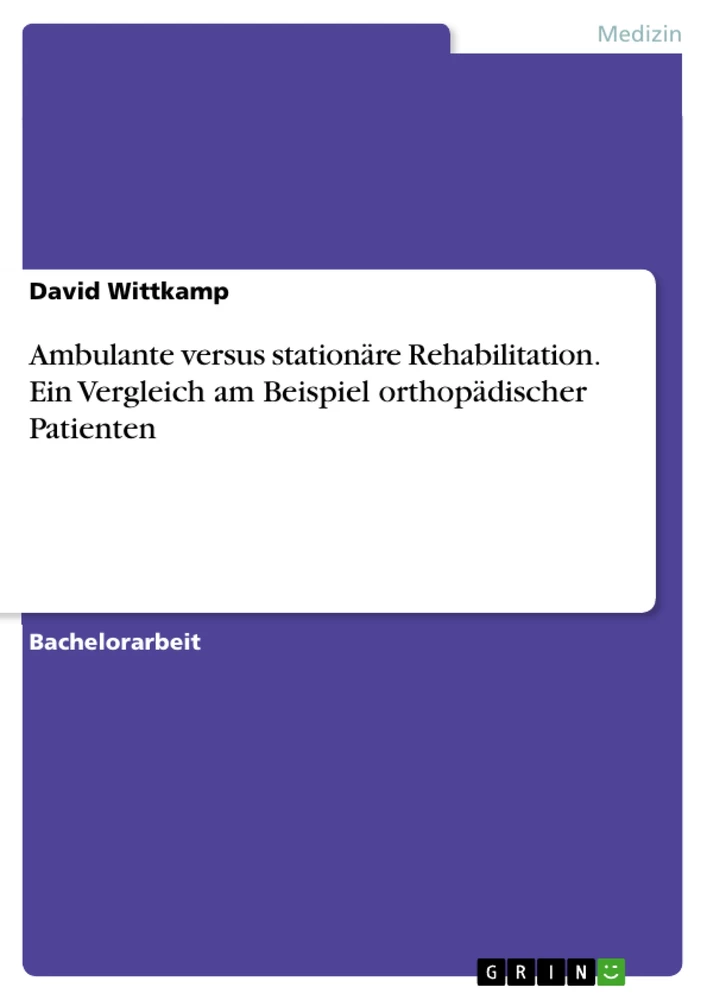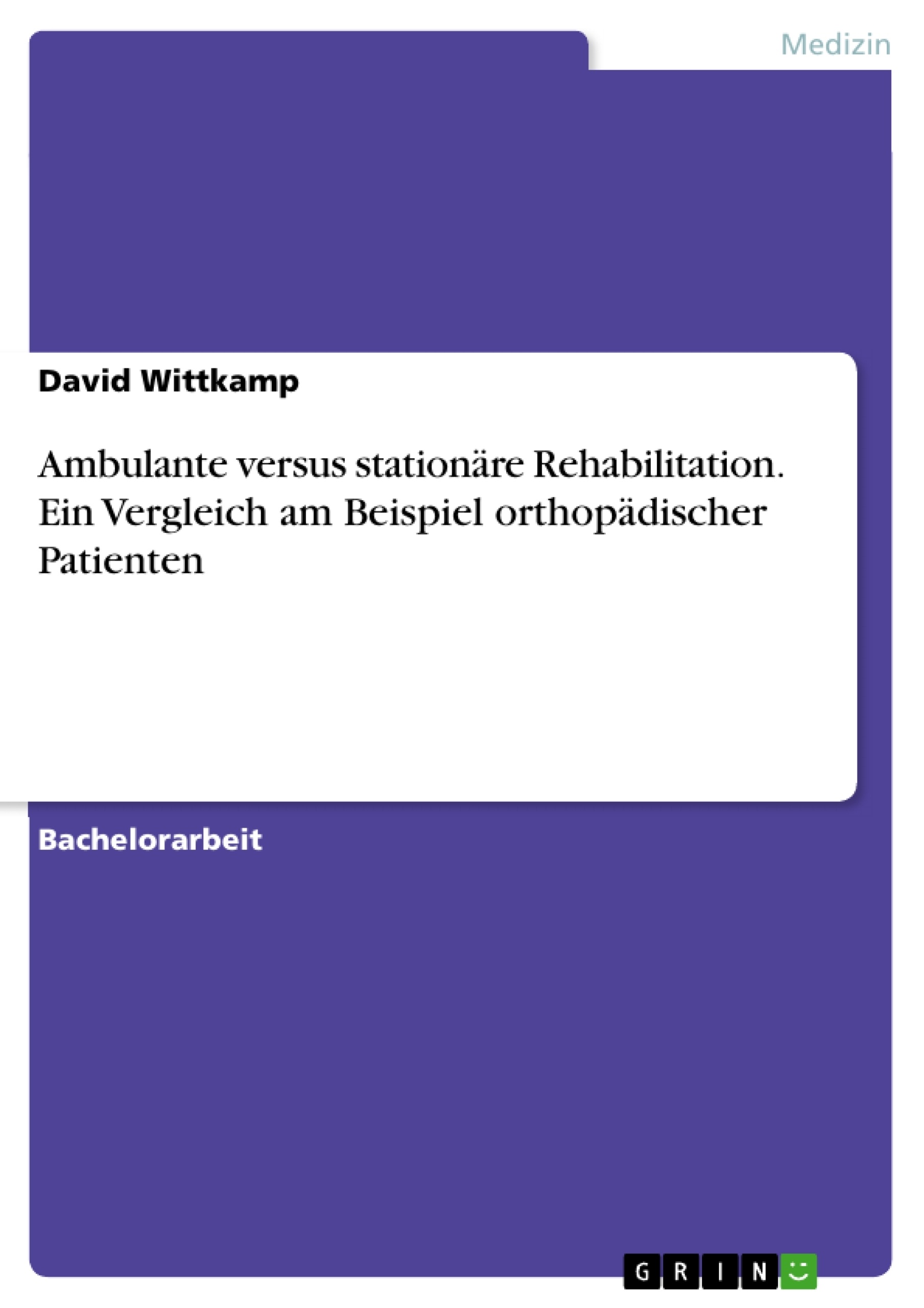Der Fokus dieser Arbeit liegt speziell auf der ambulanten und stationären Rehabilitation von orthopädischen Patienten. Etwa 37% aller Rehabilitationsmaßnahmen werden in der BRD im Bereich der Orthopädie durchgeführt. Damit liegen die Zahlen in diesem Bereich der Rehabilitation am höchsten, womit sich der Untersuchungsansatz in der Orthopädie anbietet. Um diese Untersuchung durchzuführen, werden verschiedene Studien gesichtet und analysiert.
Die Methodik zur Recherche und zur Bewertung der Studien werden ausführlich dargestellt. Zuvor wird eine Definition des Begriffs Rehabilitation erläutert und es wird einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen und die statistischen Kennzahlen der Rehabilitation in Deutschland gegeben. Abschließend werden in einer Diskussion die aus den Studien ermittelten Ergebnisse auf Grundlage gesellschaftlicher, ökonomischer und pflegerischer Kriterien bewertet und in einem abschließenden Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas und Problemdarstellung
- Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- Rehabilitation in Deutschland
- Definition des Begriffs Rehabilitation
- Rechtliche Grundlagen der Rehabilitation in Deutschland
- Statistische Kennzahlen der Rehabilitation in Deutschland
- Methodik
- Literaturrecherche
- Bewertung der Studien
- Ergebnisdarstellung
- Ergebnisdarstellung der Literaturrecherche
- Gesamtbewertung der Studien
- Ergebnisse des Vergleichs anhand ausgewählter Kriterien
- Zusammenfassung
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Vergleich ambulanter und stationärer Rehabilitation am Beispiel orthopädischer Patienten. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Rehaformen anhand wissenschaftlicher Studien zu untersuchen und zu analysieren. Die Arbeit soll einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation der Rehabilitation in Deutschland bieten und die Entwicklungen in den letzten Jahren beleuchten.
- Relevanz der Rehabilitation im Gesundheitswesen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Rehabilitation
- Vergleich der Effektivität von ambulanter und stationärer Rehabilitation
- Kostenaspekte der Rehabilitation
- Der Trend "ambulant vor stationär"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Rehabilitation im Gesundheitswesen dar und erläutert die Herausforderungen, die mit der steigenden Zahl von Patienten und dem Kostendruck verbunden sind. Der Trend "ambulant vor stationär" wird als wichtiger Aspekt der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Rehabilitation hervorgehoben.
- Rehabilitation in Deutschland: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Rehabilitation und stellt die rechtlichen Grundlagen in Deutschland dar. Darüber hinaus werden statistische Kennzahlen der Rehabilitation in Deutschland vorgestellt.
- Methodik: In diesem Kapitel werden die Vorgehensweise und die Methoden der Literaturrecherche sowie die Bewertung der Studien beschrieben.
- Ergebnisdarstellung: Hier werden die Ergebnisse der Literaturrecherche präsentiert und anhand ausgewählter Kriterien analysiert.
Schlüsselwörter
Orthopädische Patienten, Rehabilitation, ambulanter Reha, stationärer Reha, Gesundheitswesen, Kostendruck, Trend "ambulant vor stationär", Rechtliche Rahmenbedingungen, Effektivität, wissenschaftliche Studien, Literaturrecherche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Reha?
Bei der stationären Reha wohnt der Patient in der Klinik, während er bei der ambulanten Reha zu Hause lebt und nur für die Anwendungen die Einrichtung besucht.
Warum steht die Orthopädie im Fokus der Untersuchung?
Etwa 37 % aller Rehabilitationsmaßnahmen in Deutschland entfallen auf den Bereich der Orthopädie, was ihn zum größten Teilbereich macht.
Was bedeutet der Trend "ambulant vor stationär"?
Es ist das gesundheitspolitische Ziel, ambulante Maßnahmen zu bevorzugen, um Kosten zu senken und Patienten in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen.
Ist ambulante Reha genauso effektiv wie stationäre?
Die Arbeit analysiert verschiedene Studien, um die Effektivität beider Formen speziell für orthopädische Patienten wissenschaftlich zu vergleichen.
Welche Rolle spielen ökonomische Kriterien?
Der Kostendruck im Gesundheitswesen ist ein wesentlicher Treiber für die Diskussion um die effizienteste Form der Rehabilitation.
- Arbeit zitieren
- David Wittkamp (Autor:in), 2016, Ambulante versus stationäre Rehabilitation. Ein Vergleich am Beispiel orthopädischer Patienten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1289176