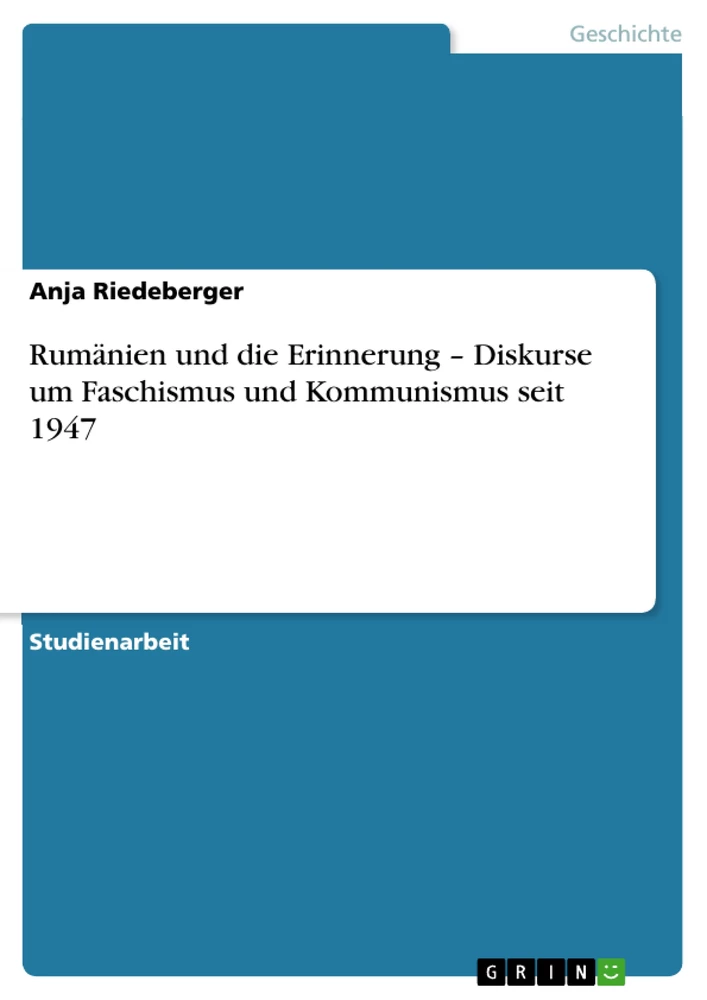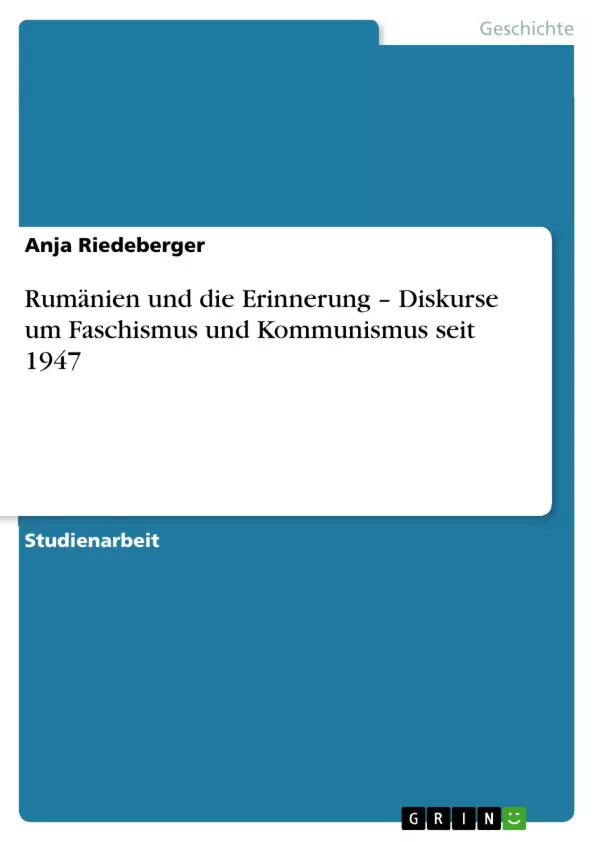Die Europäische Union ist nach Helmut König „eine ökonomische und administrative Einheit bei einem auffälligen und viel beklagten Mangel an Identifikation und Solidarität“. Politisch sind die Einigungsprozesse unübersehbar: seit den Römischen Verträgen hat die Zahl der Mitgliedsstaaten stetig zugenommen bis zur letzten Erweiterung im Jahr 2007. Doch die lange Geschichte des Scheiterns, die das Verfassungs- bzw. Grundlagenvertrag-Projekt nun schon hinter sich hat macht deutlich, dass der politisch-institutionellen Einigung eine andere vorausgehen oder zumindest mit dieser einhergehen muss: das Zusammenwachsen als gefühlte Gemeinschaft. Ohne das die Bevölkerungen der europäischen Nationalstaaten sich auch als zusammengehörig empfinden, wird die politische Einigung schnell an ihre Grenzen gelangen. Nicht umsonst bemühen sich die Vertreter der europäischen Institutionen in Brüssel, das Projekt Europa beliebter zu machen: Imagekampagnen sollen die Attraktivität des europäischen Gedankens steigern, Konferenzen zum Thema sollen neue Konzepte entwickeln, und neu konzipierte Schulbücher sollen schon bei den Kleinsten das Entstehen einer europäisch bestimmten Identität fördern. Verfolgt man europapolitische Reden oder liest in Publikationen zum Thema „Europäische Identität“, wird dort der Zusammenhang Europas mit dem Terminus der Kultur- und Wertegemeinschaft begründet. Die Staaten Europas bekennen sich gemeinsam zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und zu freiheitlichen, pluralistischen Verfassungen. Diese Haltung würde, so die Argumentation, in der gemeinsamen Geschichte wurzeln: die griechische Antike, die christlichen Königreiche des Mittelalters, die Renaissance und die Aufklärung bis hin zum Nationalismus des 19. Jahrhunderts, der zur Gründung der Nationalstaaten führte, sind von gesamteuropäischer Bedeutung und Wirkung gewesen. Neben dieser positiven Bestimmung des Kerns der europäischen Zusammengehörigkeit stellt sich aber auch die Frage, wo Trennlinien verlaufen. Mögen auch die Ereignisse der letzten Jahrhunderte Auswirkungen auf ganz Europa gehabt haben – nicht alle haben sie gleich erlebt. Welche Rolle spielen unterschiedliche Erinnerungen und Interpretationen des Vergangenen für die Integration Europas? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kollektive Erinnerung und „erinnerungskulturelle Trennlinien“
- Bedeutung der kollektiven Identität für Europa
- Europas Spaltung durch „erinnerungskulturelle Trennlinien“
- Politikgeschichte Rumäniens 1916 bis 2008
- Von 1916 bis 1944
- Der Holocaust in Rumänien
- Von 1945 bis 1989
- Von 1990 bis 2008
- Die Diskurse um den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus
- Im Kommunismus
- Nach 1989
- Die Diskurse um den Kommunismus
- Die verzögerte Aufarbeitung
- Die Neudeutung der Postkommunisten
- „Widerstand durch Kultur“
- Der bewaffnete Widerstand
- Erfolge der Aufarbeitung
- Ausblick – Demontierung oder Zementierung der erinnerungskulturellen Trennlinien in Rumänien?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess der Erinnerungskultur in Rumänien im Kontext seiner sozialen und politischen Bedingungen, insbesondere während des Faschismus und des Kommunismus. Sie analysiert Formen der Verdrängung, Verklärung und Mythisierung, aber auch Bemühungen um Aufarbeitung und Opferanerkennung. Die Bedeutung eines einheitlichen europäischen Geschichtsverständnisses wird im Hinblick auf die "erinnerungskulturellen Trennlinien" beleuchtet.
- Das Konzept der „erinnerungskulturellen Trennlinien“ und deren Einfluss auf die europäische Integration
- Die historische Entwicklung Rumäniens im 20. Jahrhundert und die damit verbundenen Erfahrungen von Faschismus und Kommunismus
- Die unterschiedlichen Diskurse um Faschismus und Kommunismus in Rumänien und deren Akteure
- Die Herausforderungen bei der Aufarbeitung der Vergangenheit und der Gestaltung einer gemeinsamen Erinnerungskultur
- Die Frage nach der Vereinbarkeit der rumänischen Erinnerungskultur mit dem angestrebten europäischen Geschichtsdiskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung kollektiver Identität für die europäische Integration heraus und führt das Konzept der „erinnerungskulturellen Trennlinien“ ein, die durch unterschiedliche Erinnerungen an das 20. Jahrhundert entstehen. Sie begründet die Wahl Rumäniens als Fallbeispiel aufgrund seiner mehrfachen politischen Systemwechsel und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Darstellung des Erinnerns an Faschismus und Kommunismus in Rumänien, unter Berücksichtigung von Verdrängung, Verklärung und Aufarbeitungsprozessen.
Kollektive Erinnerung und „erinnerungskulturelle Trennlinien“: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung kollektiver Identität für Europa und analysiert, wie unterschiedliche Erinnerungen und Interpretationen historischer Ereignisse zu „erinnerungskulturellen Trennlinien“ führen, die die europäische Integration behindern können. Es wird betont, dass Erinnerung kein natürlicher Prozess, sondern ein sozial konstruiertes Phänomen ist, das von der jeweiligen Gegenwart beeinflusst wird.
Politikgeschichte Rumäniens 1916 bis 2008: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die politische Entwicklung Rumäniens vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Er skizziert die wichtigsten politischen Ereignisse, Regimewechsel und die damit verbundenen gesellschaftlichen Umwälzungen, um den Kontext für die folgenden Kapitel über die Diskurse um Faschismus und Kommunismus zu schaffen. Die Kapitelteile behandeln die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, den Holocaust in Rumänien, die kommunistische Ära und die Entwicklung nach 1989.
Die Diskurse um den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus: Dieses Kapitel analysiert die öffentlichen Diskurse um den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus in Rumänien, sowohl während der kommunistischen Ära als auch nach 1989. Es beleuchtet unterschiedliche Interpretationsansätze und die damit verbundenen politischen und ideologischen Interessen. Es untersucht, wie die Erinnerung an den Faschismus instrumentalisiert und zur Legitimation politischer Ziele eingesetzt wurde.
Die Diskurse um den Kommunismus: Der Abschnitt befasst sich mit den Diskursen um den Kommunismus in Rumänien. Er untersucht die verzögerte Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit, die Neudeutungen durch postkommunistische Akteure, den „Widerstand durch Kultur“, den bewaffneten Widerstand sowie Erfolge bei der Aufarbeitung und Anerkennung von Opfern. Die Analyse fokussiert auf die verschiedenen Interpretationsmuster und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Folgen.
Schlüsselwörter
Rumänien, Erinnerungskultur, Faschismus, Kommunismus, kollektive Identität, europäische Integration, Geschichtsdiskurs, Aufarbeitung der Vergangenheit, Verdrängung, Verklärung, „erinnerungskulturelle Trennlinien“, Opferanerkennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erinnerungskultur in Rumänien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Erinnerungskultur in Rumänien, insbesondere im Kontext des Faschismus und des Kommunismus. Sie analysiert, wie diese Epochen erinnert und interpretiert werden, einschließlich der Mechanismen der Verdrängung, Verklärung und Mythisierung, sowie der Bemühungen um Aufarbeitung und Opferanerkennung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss dieser unterschiedlichen Erinnerungen auf die europäische Integration.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der „erinnerungskulturellen Trennlinien“ und deren Auswirkungen auf die europäische Integration. Sie analysiert die historische Entwicklung Rumäniens im 20. Jahrhundert, die Diskurse um Faschismus und Kommunismus, die Herausforderungen bei der Aufarbeitung der Vergangenheit und die Frage nach der Vereinbarkeit der rumänischen Erinnerungskultur mit einem einheitlichen europäischen Geschichtsverständnis.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Der Fokus liegt auf der politischen Entwicklung Rumäniens vom Ersten Weltkrieg (1916) bis 2008. Die Analyse umfasst die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, den Holocaust in Rumänien, die kommunistische Ära und die Entwicklung nach dem Fall des Kommunismus.
Wie werden die Diskurse um Faschismus und Kommunismus behandelt?
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Diskurse und Interpretationsansätze bezüglich des Faschismus und Kommunismus in Rumänien, sowohl während als auch nach der kommunistischen Ära. Untersucht werden die Instrumentalisierung der Erinnerung an diese Epochen und deren Einfluss auf politische Ziele. Besondere Aufmerksamkeit gilt der verzögerten Aufarbeitung des Kommunismus, der Rolle des „Widerstands durch Kultur“ und des bewaffneten Widerstands sowie der Anerkennung von Opfern.
Welche Rolle spielt die kollektive Identität?
Die Arbeit betont die Bedeutung kollektiver Identität für die europäische Integration und untersucht, wie unterschiedliche Erinnerungen an historische Ereignisse zu „erinnerungskulturellen Trennlinien“ führen können, welche die Integration behindern. Erinnerung wird als sozial konstruiertes Phänomen verstanden, das von der jeweiligen Gegenwart beeinflusst wird.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, ob die „erinnerungskulturellen Trennlinien“ in Rumänien eher demontiert oder zementiert werden. Sie hinterfragt die Vereinbarkeit der rumänischen Erinnerungskultur mit dem angestrebten europäischen Geschichtsdiskurs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu kollektiver Erinnerung und „erinnerungskulturellen Trennlinien“, ein Kapitel zur Politikgeschichte Rumäniens (1916-2008), Kapitel zu den Diskursen um den Zweiten Weltkrieg/Faschismus und den Kommunismus, sowie einen Ausblick. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der entsprechenden Thematik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rumänien, Erinnerungskultur, Faschismus, Kommunismus, kollektive Identität, europäische Integration, Geschichtsdiskurs, Aufarbeitung der Vergangenheit, Verdrängung, Verklärung, „erinnerungskulturelle Trennlinien“, Opferanerkennung.
- Arbeit zitieren
- Anja Riedeberger (Autor:in), 2008, Rumänien und die Erinnerung – Diskurse um Faschismus und Kommunismus seit 1947, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128932