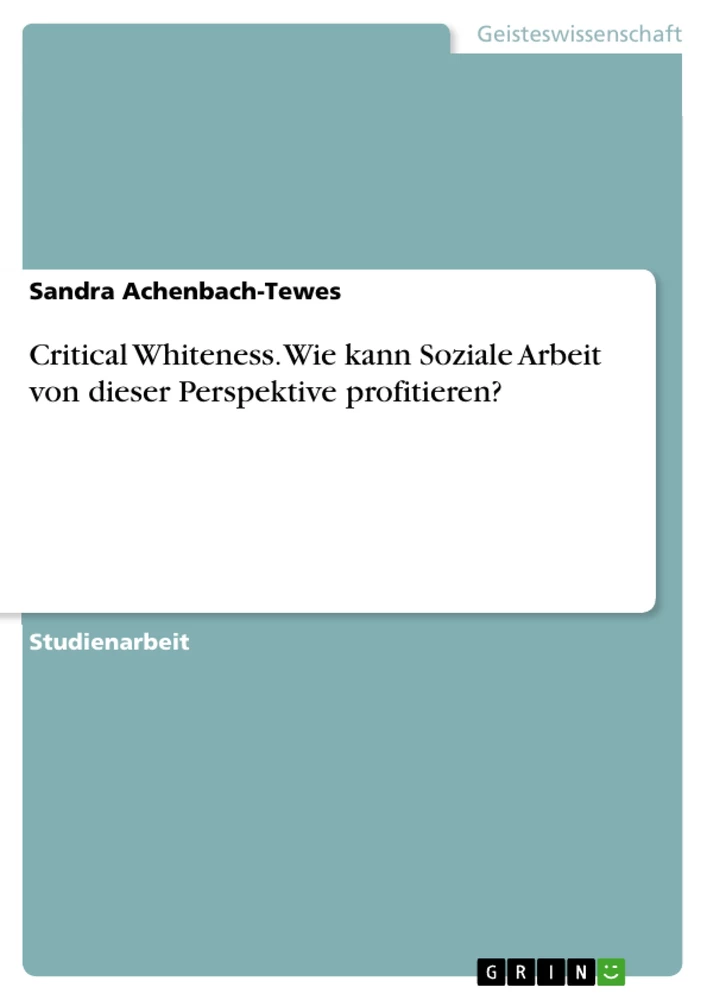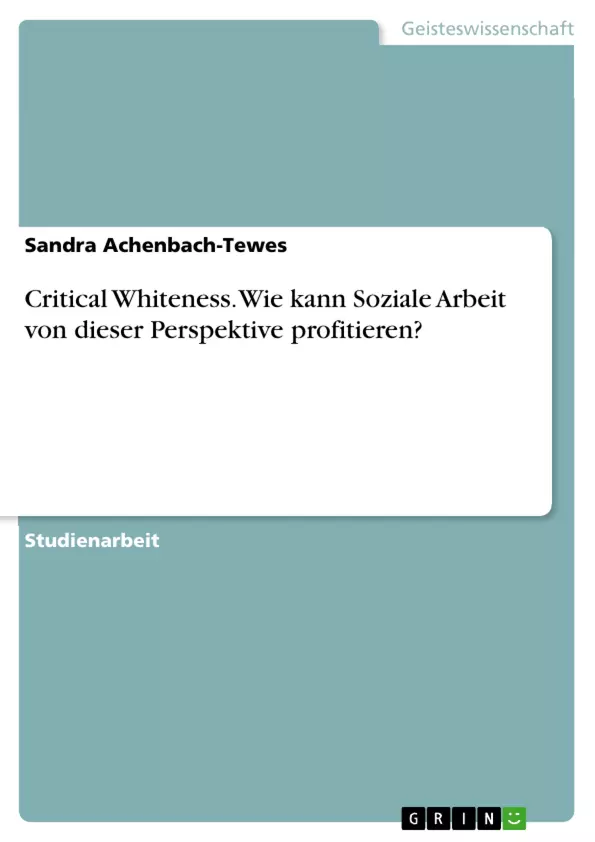Wie kann Soziale Arbeit von der Perspektive von Critical Whiteness profitieren? Diese Frage soll im Folgenden beantwortet werden. Da das Thema Rassismus und Critical Whiteness als hochkomplex bezeichnet werden kann, ist hier nur ein begrenzter Einblick in die Thematik möglich.
Zunächst soll durch die Begriffsbestimmungen von Diskriminierung, Rassismus und Critical Whiteness eine Grundlage für den Gebrauch dieser Begriffe in der vorliegenden Arbeit geschaffen werden. Im weiteren Verlauf wird für das Verständnis der Critical-Whiteness-Perspektive auf die historische Entwicklung des Rassismus eingegangen, sowie die Position von Critical Whiteness dargestellt. Ausgehend von den dargelegten Kapiteln wird eine Betrachtung von Rassismus und Critical Whiteness in Bezug auf die Soziale Arbeit und das aktuelle Bestreben zur Bekämpfung von Rassismus der Politik vorgenommen. Entscheidend für die Beantwortung der Frage ist ebenfalls die Betrachtung der Rolle als Fachkraft für Soziale Arbeit, auf die ebenfalls eingegangen wird. Im abschließenden Fazit erfolgt eine Zusammenfassung dieser Arbeit und die Beantwortung der gestellten Eingangsfrage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Historie des Rassismus
- Critical Whiteness
- Rassismus und Critical Whiteness ein Auftrag an die Soziale Arbeit?
- Die Rolle der Sozialarbeitenden selbst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Soziale Arbeit von der Perspektive von critical whiteness profitieren kann. Sie beleuchtet die Themen Rassismus und Critical Whiteness und deren Relevanz für die Soziale Arbeit im Kontext der aktuellen Bestrebungen zur Bekämpfung von Rassismus. Die Arbeit beleuchtet zudem die Rolle von Sozialarbeitenden im Umgang mit diesen Themen.
- Begriffsbestimmungen von Diskriminierung, Rassismus und Critical Whiteness
- Historische Entwicklung des Rassismus
- Die Perspektive von Critical Whiteness
- Rassismus und Critical Whiteness in Bezug auf die Soziale Arbeit
- Die Rolle von Sozialarbeitenden im Umgang mit Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Fragestellung vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Komplexität der Themen Rassismus und Critical Whiteness hervor.
- Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Diskriminierung, Rassismus und Critical Whiteness und beleuchtet die Unterschiede zwischen ihnen. Es dient als Grundlage für die weitere Diskussion.
- Historie des Rassismus: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Rassismus, beginnend im Mittelalter und verfolgt ihn bis in die Gegenwart. Es zeigt, wie Rassismus über Jahrhunderte hinweg vererbt und gelebt wurde und sich bis heute in unterschiedlichen Formen manifestiert.
- Critical Whiteness: Dieses Kapitel stellt die Perspektive von Critical Whiteness vor und beschreibt ihre Entstehung sowie ihre Relevanz für die Auseinandersetzung mit Rassismus. Es beleuchtet die Kritik an der Rolle von Weißen in der historischen Entwicklung und Gegenwart.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Rassismus, Diskriminierung, Critical Whiteness, Soziale Arbeit, Rolle von Sozialarbeitenden und historischer Entwicklung des Rassismus. Sie beleuchtet die Bedeutung von Critical Whiteness als Instrument zur Dekonstruktion von rassistischen Strukturen und Machtverhältnissen.
- Citation du texte
- Sandra Achenbach-Tewes (Auteur), 2022, Critical Whiteness. Wie kann Soziale Arbeit von dieser Perspektive profitieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1289742