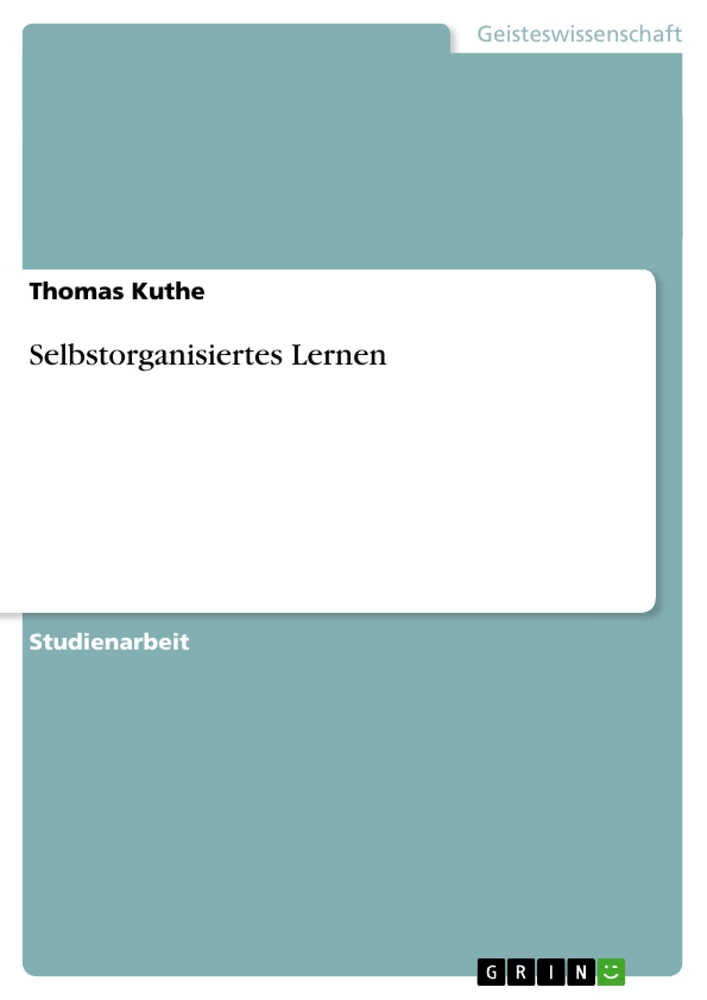1. Geschichtlicher Hintergrund
Gegenwart: Hochkonjunktur der Schlagwörter „Selbstorganisation, Selbststeuerung oder Selbstentwicklung“
Aber stehen sie tatsächlich für umwälzende neue Ideen oder Konzepte, oder werden hier nur neue Synonyme benutzt…?
…so neu sind diese Gedanken tatsächlich nicht!
Ideale der Antike:
- Mensch setzt sich handelnd und lernend unter der Nutzung seiner Vernunft ganzheitlich und selbstreflektiert mit der Wirklichkeit auseinander (Vertreter: Plato, Aristoteles)
Ideale der Renaissance:
- freie Persönlichkeitsentfaltung durch Bildung und Erziehung;
Ideale der Neuzeit:
- Gestaltung der Lebensbedingungen im „Neuhumanismus“ des 18 und 19. Jhds. Beschreibung des Entwicklungsideals als „Wirken, Tun und Schaffen mit klarem Bewusstsein und freier Selbstbestimmung (Vertreter: u.a. Fröbel, Schiller, Goethe)
Fazit:
Prägung der heutigen Kultur- und Bildungsideale durch diese historischen Vorbilder
Folglich: Bezugnahme der o.g. Schlagwörter auf das Ideal einer selbstbestimmten und möglichst freien Entwicklung eines jeden Individuums in der Gesellschaft
diese Konzepte sind demzufolge nicht grundlegend neu, dennoch haben die „alten“ Kleider einen „neuen, zeitgemäßen“ Schnitt bekommen (Greif, 1996, S. 21 ff.)
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtlicher Hintergrund
- Definitionen
- Selbstorganisiertes Lernen
- Selbstorganisation
- Lernen
- Selbstorganisiertes Lernen
- Entwicklungsstufen des Lernens
- Vergleiche zwischen selbstorganisierten Lernen und traditionellen Lernmethoden
- Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Lernen
- Unternehmen
- Mitarbeiter
- Lernstoff
- Anforderungen an Selbstlernmedien
- Die Notwendigkeit
- Methoden
- Heuristische Regel
- Leittextmethode
- Entstehung
- Ziel
- Grundprinzip
- Kritik
- Minimale Leittexte
- Unterschied zur Leittextmethode
- Standardgliederung
- Fazit
- Lernberater
- Weitere wichtige Methoden des selbstorganisierten Lernen
- Kritik am selbstorganisierten Lernen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des selbstorganisierten Lernens und beleuchtet dessen historischen Hintergrund, Definitionen, Entwicklungsstufen, Vergleiche zu traditionellen Lernmethoden sowie Rahmenbedingungen und Anforderungen. Darüber hinaus werden verschiedene Methoden des selbstorganisierten Lernens vorgestellt und kritisch betrachtet.
- Geschichtlicher Hintergrund und Bezug zu den Idealen der Antike, Renaissance und Neuzeit
- Definitionen und Abgrenzung von Selbstorganisation und Lernen im Kontext des selbstorganisierten Lernens
- Entwicklungsstufen des Lernens und Vergleich zu traditionellen Lernmethoden
- Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Lernen im Unternehmen, bei den Mitarbeitern und im Bezug auf den Lernstoff
- Methoden des selbstorganisierten Lernens, wie die Leittextmethode, Minimale Leittexte, und Lernberater
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtlicher Hintergrund
Das Kapitel beleuchtet den historischen Ursprung des Begriffs „Selbstorganisation“ und verdeutlicht, dass die zugrunde liegenden Gedanken und Konzepte zwar nicht neu sind, aber im Laufe der Zeit eine neue Interpretation und Relevanz erlangt haben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Ideals einer selbstbestimmten Persönlichkeitsentfaltung im Kontext von Bildung und Erziehung.
Definitionen
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des selbstorganisierten Lernens und der Selbstorganisation im Allgemeinen. Die wichtigsten Bereiche der Selbstbestimmung im Lernprozess, wie die Wahl der Lernaufgaben, die Gestaltung der Aufgabenbearbeitung und die Art des Feedbacks werden erläutert. Darüber hinaus wird der Begriff des Lernens in Bezug auf die Selbstorganisation definiert.
Selbstorganisiertes Lernen
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklungsstufen des Lernens, von Frontalunterricht bis hin zum eigenaktiven selbstorganisierten Lernen. Es beleuchtet den Wandel der Rollen von Lehrenden und Lernenden und betont die Bedeutung der Eigenverantwortung im selbstorganisierten Lernen. Der Vergleich mit traditionellen Lernmethoden umfasst Vor- und Nachteile beider Ansätze und fokussiert auf die Flexibilität und Selbststeuerung des Lernprozesses im selbstorganisierten Lernen.
Rahmenbedingungen für selbstorganisiertes Lernen
Dieses Kapitel untersucht die Rahmenbedingungen für das selbstorganisierte Lernen aus der Sicht des Unternehmens, des Mitarbeiters und des Lernstoffs. Es wird deutlich, dass sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter eine aktive Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung des selbstorganisierten Lernens spielen müssen. Der Lernstoff sollte sich an kognitiven Lernzielen orientieren und den Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen.
Anforderungen an Selbstlernmedien
Dieses Kapitel definiert Anforderungen an Selbstlernmedien, die den individuellen Lernprozess unterstützen sollen. Dabei werden verschiedene Phasen des Lernprozesses (Motivation, Orientierung, Vermittlung, Wiederholung, Übung, Umsetzung und Kontrolle) und die Bedeutung einer klar strukturierten und benutzerfreundlichen Gestaltung des Lernmediums betont.
Die Notwendigkeit
Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit des selbstorganisierten Lernens im Kontext der sich verändernden Anforderungen in der Wirtschaft. Es werden die Bedeutung von lernenden Organisationen, die Globalisierung und die rasante Entwicklung neuer Organisationsstrukturen hervorgehoben.
Methoden
Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden des selbstorganisierten Lernens vor, darunter die heuristische Regel, die Leittextmethode, Minimale Leittexte und die Rolle des Lernberaters. Die einzelnen Methoden werden näher erläutert und kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Selbstorganisiertes Lernen, Selbstorganisation, Selbststeuerung, Lernen, Bildung, Erziehung, Entwicklungsstufen, Lernmethoden, Rahmenbedingungen, Unternehmen, Mitarbeiter, Lernstoff, Selbstlernmedien, Leittextmethode, Minimale Leittexte, Lernberater, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Ist selbstorganisiertes Lernen ein völlig neues Konzept?
Nein, die Wurzeln liegen bereits in den Idealen der Antike, der Renaissance und dem Neuhumanismus. Die heutigen Begriffe sind lediglich zeitgemäße Interpretationen des Strebens nach freier Persönlichkeitsentfaltung.
Was unterscheidet selbstorganisiertes Lernen von traditionellen Methoden?
Im Gegensatz zum Frontalunterricht übernimmt der Lernende die Verantwortung für die Wahl der Aufgaben, die Bearbeitung und die Selbstkontrolle. Die Rolle des Lehrenden wandelt sich zum Lernberater.
Was ist die Leittextmethode?
Die Leittextmethode ist eine Methode des selbstorganisierten Lernens, bei der schriftliche Unterlagen (Leittexte) den Lernenden durch den Prozess der Informationsbeschaffung, Planung, Durchführung und Kontrolle führen.
Welche Anforderungen werden an Selbstlernmedien gestellt?
Medien müssen den Lernprozess in Phasen wie Motivation, Orientierung und Übung unterstützen und benutzerfreundlich sowie klar strukturiert gestaltet sein.
Warum ist selbstorganisiertes Lernen für Unternehmen heute notwendig?
Globalisierung und der schnelle Wandel von Organisationsstrukturen erfordern „lernende Organisationen“, in denen Mitarbeiter flexibel und eigenverantwortlich neues Wissen erwerben können.
- Arbeit zitieren
- Thomas Kuthe (Autor:in), 2003, Selbstorganisiertes Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12898