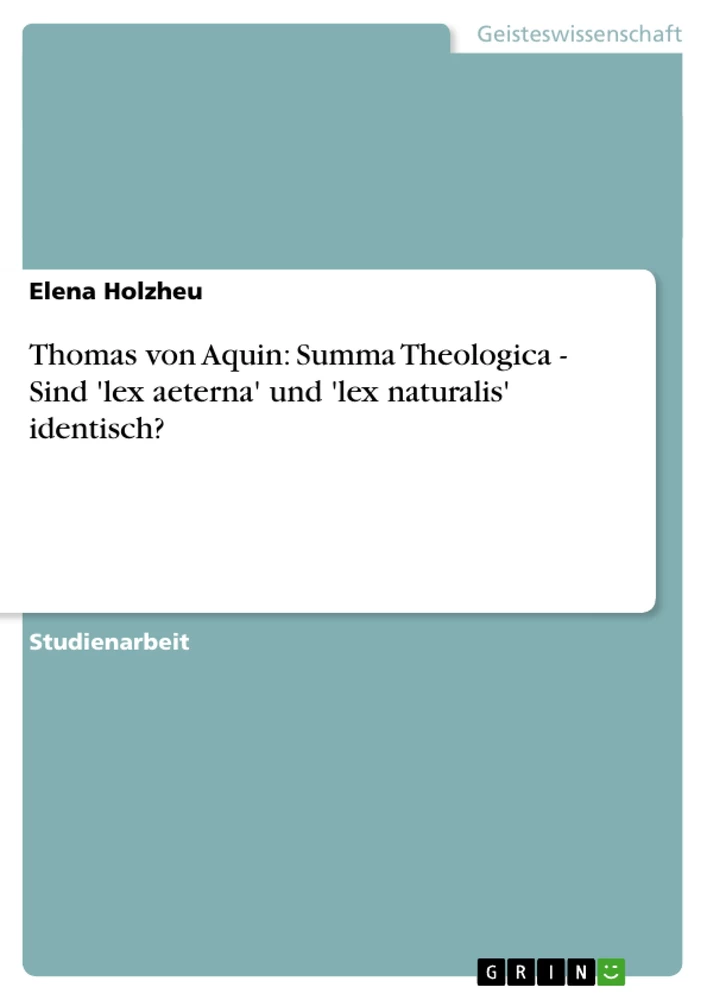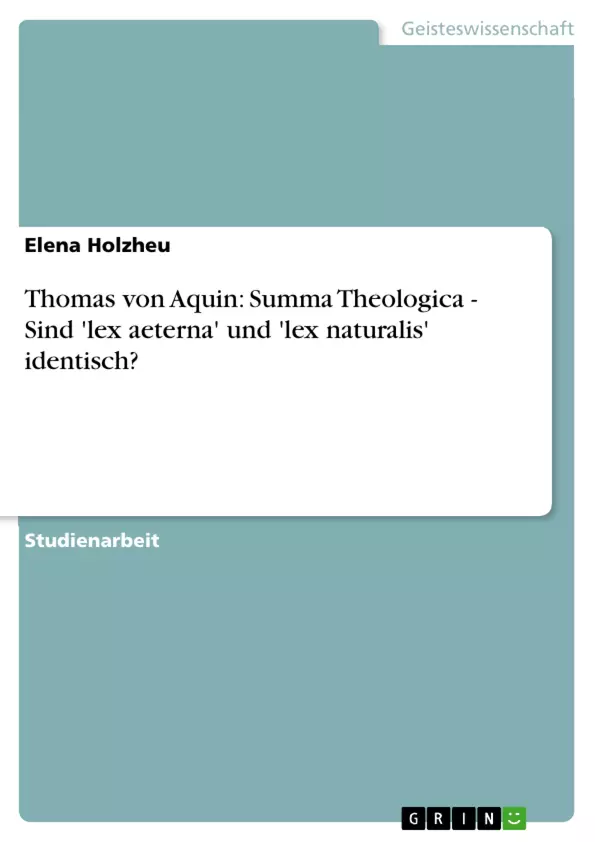In der Summa Theologica vereint Thomas von Aquin seine Offenbarungskonzeption mit
der praktischen Philosophie des Aristoteles. Er versucht zwischen christlicher Lehre und
weltlichem Recht, bzw. einer mehr und mehr von der Vernunft dominierten Welt zu vermitteln.
Sein Ziel ist es, sowohl die monarchische Ordnung als auch den Machtanspruch von Kirche und
Papst zu legitimieren. Gemäss Thomas’ Lehre gibt es, im Sinne der aristotelischen Teleologie,
ein letztes Ziel, einen Endzweck für den Menschen. Für Thomas ist dies ein geoffenbarter
Endzweck, das religiöse Heil, welches im Jenseits liegt. Gleichwohl kann der Mensch im
Diesseits als letztem weltlich erreichbaren Ziel das Gemeinwohl realisieren. Zur Erreichung
beider Ziele müssen Bedingungen seitens des Staates geschaffen werden. Sowohl
Staatsaufgaben, als auch die Rolle und Verantwortung des Monarchen lassen sich dabei letztlich
dem einen Endzweck der Seligkeit unterstellen und sind nur insoweit förderlich, als sie der
Erreichung dieses letzten Ziels dienen. Auf dem Hintergrund dieser Teleologie lässt sich auch
Thomas’ hierarchischer Rechtsbegriff verstehen. Die sogenannte Legeshierarchie soll den
göttlichen Willen im Sinne einer Kaskade in das irdische Reich transportieren resp. das Gesetz
soll, nebst der göttlichen Gnade, den Menschen ein Vehikel hin zu Gott bieten. Die Aufgabe des
Gesetzes liegt in der Herstellung einer auf das Endziel angelegten Ordnung. Das Gesetz ist auf
das menschliche Handeln gerichtet. Es werden dabei vier Stufen unterschieden: Ewiges Gesetz
(lex aeterna), natürliches Gesetz (lex naturalis), göttliches Gesetz (lex divina) und menschliches
Gesetz (lex humana).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thomas' Aristotelesrezeption
- Legeshierarchie
- Lex aeterna – Bedeutung und Funktion
- Lex naturalis – Bedeutung und Funktion
- Zum Verhältnis von lex aeterna und lex naturalis
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob die lex aeterna und die lex naturalis bei Thomas von Aquin als identisch betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert Thomas' Rezeption des aristotelischen Denkens und dessen Einfluss auf seine erkenntnistheoretische Position. Im Zentrum steht die Erläuterung der Begriffe lex aeterna und lex naturalis, ihrer Funktionen und ihres gegenseitigen Verhältnisses innerhalb der von Thomas entwickelten Legeshierarchie.
- Thomas von Aquins Aristotelesrezeption und deren Einfluss auf seine Rechtsphilosophie
- Die Bedeutung und Funktion der lex aeterna (ewiges Gesetz)
- Die Bedeutung und Funktion der lex naturalis (natürliches Gesetz)
- Das Verhältnis zwischen lex aeterna und lex naturalis
- Die hierarchische Struktur des Rechts bei Thomas von Aquin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit: die Klärung der Frage nach der Identität von lex aeterna und lex naturalis bei Thomas von Aquin. Sie skizziert den Kontext von Thomas' Werk innerhalb der Summa Theologica, in dem er christliche Lehre und weltliches Recht zu verbinden sucht, und die Rolle der Legeshierarchie in diesem Zusammenhang. Die Einleitung hebt die bestehende Debatte um die Notwendigkeit der vier Gesetzesstufen und die Unklarheiten über das Verhältnis der verschiedenen Gesetze zueinander hervor, wobei der Fokus auf den zweiten Einwand gelegt wird, der die mögliche Identität von lex aeterna und lex naturalis thematisiert.
Thomas' Aristotelesrezeption: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von Aristoteles auf Thomas von Aquins Denken, insbesondere auf seine Erkenntnistheorie. Es beschreibt die Rezeption der aristotelischen Teleologie und Erkenntnistheorie durch Thomas, mit besonderem Fokus auf die drei Erkenntnisprinzipien (intellectus agens, noeton, Intellekt) und den Erkenntnisprozess, der bei Aristoteles mit der sinnlichen Wahrnehmung beginnt und bei Thomas durch die Abstraktion (continuato) zum Erfassen des Allgemeinen führt. Der Abschnitt betont die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung als Ausgangspunkt der Erkenntnis und die daraus resultierende Verbindung des Menschen mit Gott durch die Erkenntnis erster Prinzipien.
Legeshierarchie: Dieses Kapitel erläutert Thomas' hierarchischen Rechtsbegriff, bestehend aus lex aeterna, lex naturalis, lex divina und lex humana. Es beschreibt die lex aeterna als göttliche Vernunft, die sich in der Welt und im Menschen ausdrückt, und die lex naturalis als die Bedingungen der menschlichen Existenz, die auf das Ziel der Seligkeit ausgerichtet sind. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis dieser beiden Gesetze zueinander und der Klärung der Frage, ob sie identisch sind. Der Text analysiert die jeweiligen Funktionen und Bedeutungen im Kontext der Gesamtkonzeption der Legeshierarchie.
Schlüsselwörter
Thomas von Aquin, Summa Theologica, Lex aeterna, Lex naturalis, Legeshierarchie, Aristotelesrezeption, Erkenntnistheorie, Göttliche Vernunft, Natürliches Gesetz, Teleologie, Recht, Seligkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Thomas von Aquins Legeshierarchie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob die lex aeterna und die lex naturalis bei Thomas von Aquin als identisch betrachtet werden können. Sie analysiert Thomas' Rezeption des aristotelischen Denkens und dessen Einfluss auf seine erkenntnistheoretische Position. Im Zentrum steht die Erläuterung der Begriffe lex aeterna und lex naturalis, ihrer Funktionen und ihres gegenseitigen Verhältnisses innerhalb der von Thomas entwickelten Legeshierarchie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Thomas von Aquins Aristotelesrezeption und deren Einfluss auf seine Rechtsphilosophie; die Bedeutung und Funktion der lex aeterna (ewiges Gesetz); die Bedeutung und Funktion der lex naturalis (natürliches Gesetz); das Verhältnis zwischen lex aeterna und lex naturalis; und die hierarchische Struktur des Rechts bei Thomas von Aquin.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu Thomas' Aristotelesrezeption, einem Kapitel zur Legeshierarchie und abschließenden Schlussfolgerungen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Ziel der Arbeit. Das Kapitel zu Thomas' Aristotelesrezeption analysiert den Einfluss des Aristoteles auf Thomas' Denken. Das Kapitel zur Legeshierarchie erläutert Thomas' hierarchischen Rechtsbegriff, bestehend aus lex aeterna, lex naturalis, lex divina und lex humana, mit besonderem Fokus auf das Verhältnis zwischen lex aeterna und lex naturalis.
Was ist die lex aeterna?
Die lex aeterna wird in der Arbeit als die göttliche Vernunft beschrieben, die sich in der Welt und im Menschen ausdrückt.
Was ist die lex naturalis?
Die lex naturalis wird als die Bedingungen der menschlichen Existenz beschrieben, die auf das Ziel der Seligkeit ausgerichtet sind.
Wie steht das Verhältnis zwischen lex aeterna und lex naturalis?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist die Klärung des Verhältnisses zwischen lex aeterna und lex naturalis und die Beantwortung der Frage, ob sie identisch sind. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Funktionen und Bedeutungen im Kontext der Gesamtkonzeption der Legeshierarchie um diese Frage zu beantworten.
Welche Rolle spielt Aristoteles in Thomas' Denken?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Aristoteles auf Thomas von Aquins Denken, insbesondere auf seine Erkenntnistheorie. Sie beschreibt die Rezeption der aristotelischen Teleologie und Erkenntnistheorie durch Thomas, mit besonderem Fokus auf die drei Erkenntnisprinzipien (intellectus agens, noeton, Intellekt) und den Erkenntnisprozess.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Thomas von Aquin, Summa Theologica, Lex aeterna, Lex naturalis, Legeshierarchie, Aristotelesrezeption, Erkenntnistheorie, Göttliche Vernunft, Natürliches Gesetz, Teleologie, Recht, Seligkeit.
- Quote paper
- Elena Holzheu (Author), 2009, Thomas von Aquin: Summa Theologica - Sind 'lex aeterna' und 'lex naturalis' identisch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128996