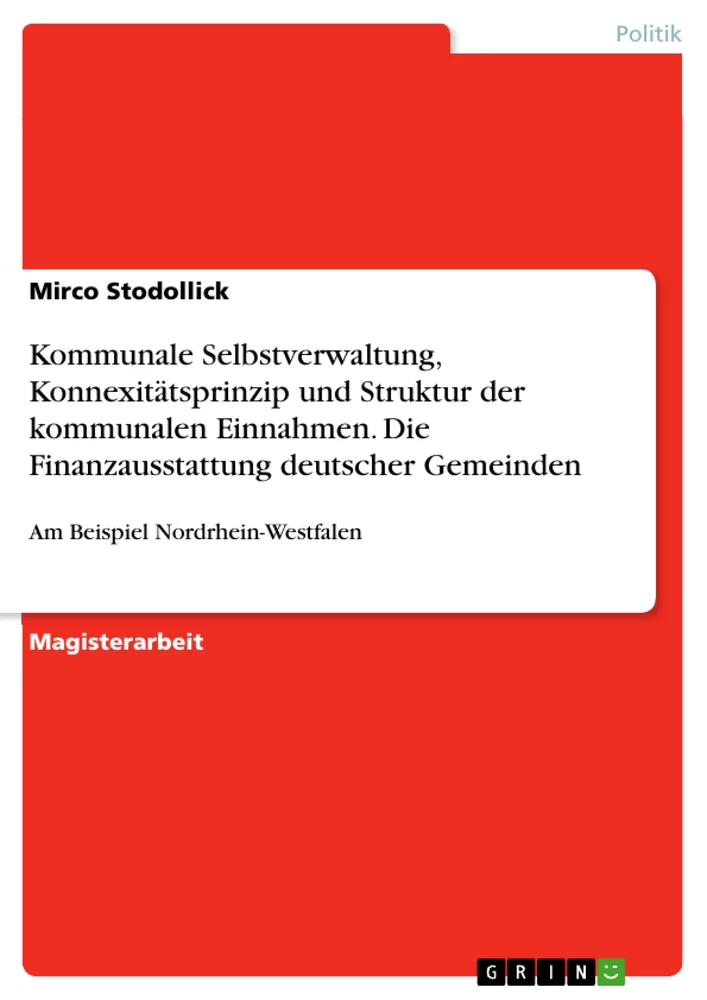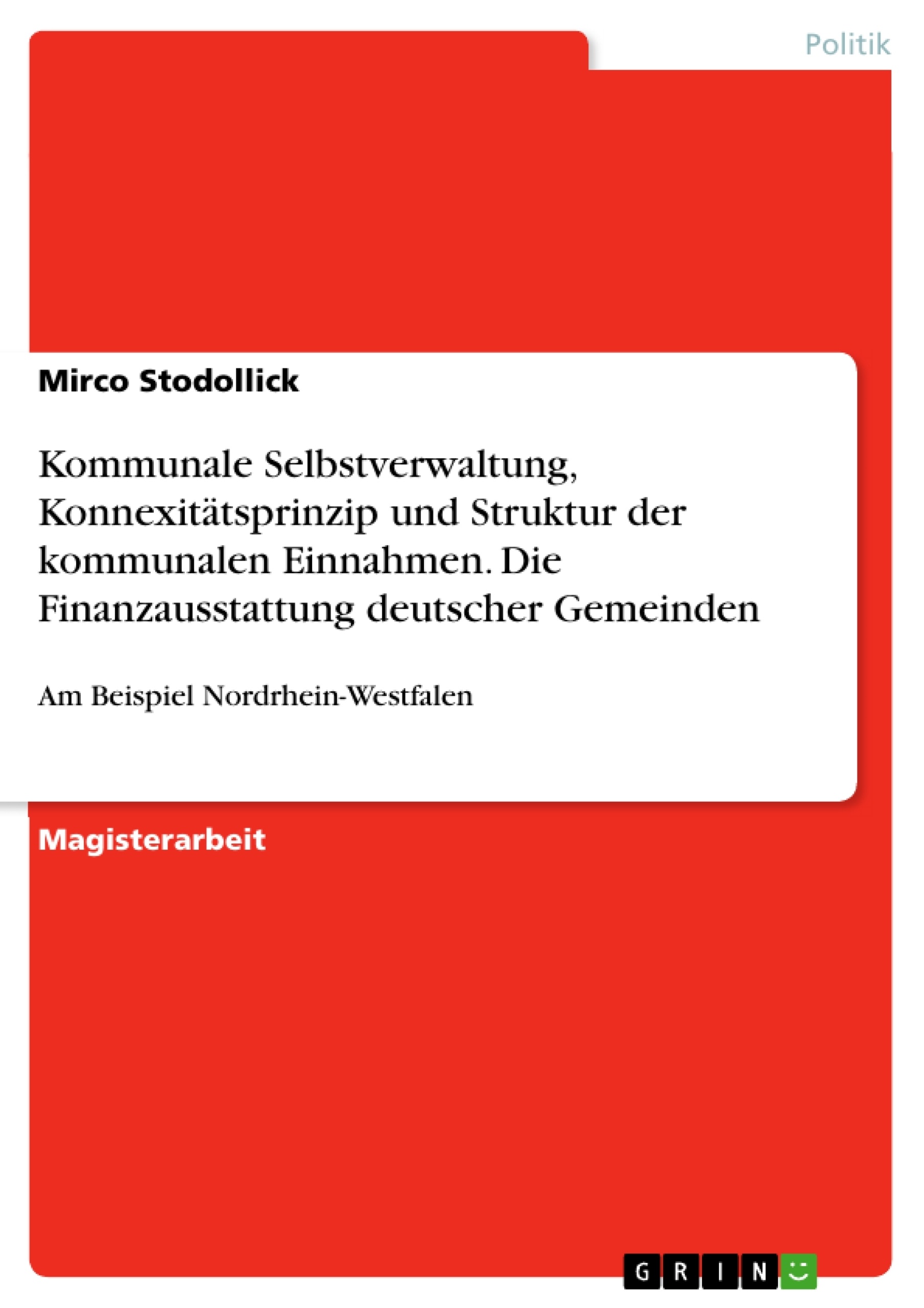Fragestellung und Vorgehensweise der Arbeit
Das erst kürzlich verabschiedete Sparpaket der Bundesregierung macht eines deutlich: Die öffentlichen Haushalte sind in einem dermaßen unbefriedigendem Zustand, daß selbst die Politik eine Konsolidierung für zwingend erforderlich hält. So wiesen die Hausha lte der Gebietskörperschaften von 1991 bis 1998 ein Finanzierungssaldo in der bedenklichen Höhe von 756 Mrd. DM auf.(1) Gegen eine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist ob der mit der
Verschuldung zusammenhängenden gravierenden Folgen bis hin zur Handlungsunfähigkeit im Grunde nichts einzuwenden. Wenn die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte von Bund und Ländern aber durch eine Kostenabwälzung auf die Kommunen betrieben wird, ist
dies mit der Intention der Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes und der Länderverfassungen nicht vereinbar, ist die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland doch wesentlicher
Träger der Durchführung von Verwaltungsaufgaben. (2)
Der zweistufige Staatsaufbau der Bundesrepublik geht einher mit einem dreistufigen Verwaltungsaufbau. Will man ein Funktionieren dieser Kombination gewährleisten, so ergibt sich schnell die Frage nach der Ausstattung der drei Verwaltungsebenen mit finanziellen Ressourcen. Aber gerade in dieser Frage offenbart das deutsche Verfassungsrecht auf Bundes- und Länderebene enormen Handlungsbedarf, haben doch die Regelungen zur Finanzierungsve rantwortung einen großen Anteil daran gehabt, daß das im Grundgesetz verbürgte Recht der Gemeinden auf eigenverantwortliche Selbstverwaltung eine zunehmende Aushöhlung von finanzieller Seite her erfährt. Kommunale Selbstverwaltung muß aber leistungsfähig sein,
damit öffentliche Aufgaben sachgerecht durchgeführt werden können. Die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die Gemeinden verursacht Kosten, die durch eine angemessene Finanzausstattung gedeckt werden müssen. Die Finanzausstattung muß dabei dem stets wachsendenden Umfang der gemeindlichen Aufgaben und den damit verknüpften Ausgaben
gerecht werden.
[...]
______
1 Vgl. BMF, Bundeshaushalt 2000, S. I C 5.
2 Vgl. Faber, in: Wassermann, S. 78; Mutius, Gutachten E, S. E 19; ders., Jura 1982, S. 32; Schmidt-Jortzig,
DÖV 1993, S. 973; Stern, in: HkWP I, S. 204; Stern, Staatsrecht I, S. 402.
Inhaltsverzeichnis
- 1 FRAGESTELLUNG UND VORGEHENSWEISE DER ARBEIT
- 1.1 Die Entwicklung der Gemeindefinanzen in NW
- 1.2 Die Gemeinden im Würgegriff von Bundes- und Landesgesetzgeber
- 1.3 Probleme der gemeindlichen Einnahmenstruktur
- 1.4 Herangehensweise an die Problematik
- 2 DIE INSTITUTIONELLE GEWÄHRLEISTUNG DER KOMMUNALEN SELBSTVERWALTUNG IN ART. 28 ABS. 2 GG
- 2.1 Die institutionelle Rechtssubjektsgarantie
- 2.2 Die objektive Rechtsinstitutionengarantie
- 2.2.1 Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
- 2.2.2 Allzuständigkeit (Universalität)
- 2.2.3 Eigenverantwortlichkeit
- 2.2.4 Gesetzesvorbehalt
- 2.2.5 Die abgeleiteten Gemeindehoheiten
- 2.3 Die subjektive Rechtsstellungsgarantie
- 3 DIE FINANZIELLE ABSICHERUNG DER OBJEKTIVEN RECHTSINSTITUTIONENGARANTIE IN DER FINANZVERFASSUNG DES GRUNDGESETZES
- 3.1 Funktion der Finanzverfassung für die kommunale Selbstverwaltung
- 3.2 Kommunalrechtsrelevante Regelungen in der Finanzverfassung
- 3.2.1 Das Konnexitätsprinzip als allgemeine Lastenverteilungsregel
- 3.2.1.1 Verwaltungsanknüpfung des Konnexitätsprinzips
- 3.2.1.2 Übertragbarkeit des Konnexitätsprinzips auf das Verhältnis Staat – Kommunen
- 3.2.1.3 Durchbrechungen des Konnexitätsprinzips
- 3.2.2 Die gemeindlichen Ertragshoheiten
- 3.2.2.1 Realsteuern
- 3.2.2.2 Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern
- 3.2.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 3.2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 3.2.2.5 Obligatorischer und fakultativer Finanzausgleich der Länder
- 3.2.2.6 Sonderlastenausgleich durch den Bund
- 3.2.3 Die Steuergesetzgebungszuständigkeit
- 4 LANDES(VERFASSUNGS-)RECHTLICHE AUSGESTALTUNG DER OBJEKTIVEN RECHTSINSTITUTIONENGARANTIE IN NW
- 4.1 Inhaltliche Zusammenhänge zwischen Landes- und Bundesverfassungsrecht
- 4.2 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
- 4.3 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
- 4.3.1 Gemeindliche Aufgabentypen
- 4.3.2 Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung / Bundesauftragsangelegenheiten
- 4.3.3 Die finanzielle Stellung der nordrhein-westfälischen Gemeinden
- 4.3.3.1 Das Recht auf die Erschließung eigener Steuerquellen
- 4.3.3.2 Verpflichtung zu einem übergemeindlichen Finanzausgleich
- 4.3.3.3 Art. 78 Abs. 3 LVerf NW als relatives Konnexitätsprinzip
- 5 DIE FINANZHOHEIT UND EINE AUFGABENADÄQUATE FINANZAUSSTATTUNG ALS ECKPFEILER GEMEINDLICHER EIGENVERANTWORTLICHKEIT
- 5.1 Die Finanzhoheit als materieller Inhalt der Selbstverwaltungsgarantie
- 5.2 Die Bestandteile der Finanzhoheit
- 5.2.1 Die Haushaltshoheit
- 5.2.2 Die Ausgabenhoheit
- 5.2.3 Die Einnahmenhoheit
- 5.3 Der Finanzausstattungsanspruch der Gemeinden
- 5.3.1 Umfang einer angemessenen Finanzausstattung
- 5.3.2 Verpflichtungsadressaten des Ausstattungsanspruchs der Gemeinden
- 6 STAATLICHE AUFGABENÜBERTRAGUNGEN, FINANZAUSSTATTUNG UND GEMEINDLICHE SELBSTVERWALTUNG - STRUKTURPROBLEME DER QUALITATIV-AUFGABENBEZOGENEN FINANZAUSSTATTUNG
- 6.1 Die Reichweite der staatlichen Befugnis zur Aufgabenübertragung
- 6.1.1 Verfassungsrechtliche Anforderungen einer Aufgabenübertragung
- 6.1.2 Aufgabenübertragung durch den Bundesgesetzgeber
- 6.1.3 Aufgabenübertragung durch den Landesgesetzgeber
- 6.2 Qualitativer Wandel von pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben
- 6.3 Aufgabenentzug durch Aufgabenüberlastung: Das Problem von Aufgabenübertragungen ohne entsprechende Kostenerstattungsregelungen
- 7 DIE AUSGESTALTUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS IM GFG NW 2000
- 7.1 Die Funktionen des kommunalen Finanzausgleichs
- 7.1.1 Stärkung der kommunalen Einnahmen
- 7.1.2 Ausgleich von Finanzkraftunterschieden
- 7.1.3 Förderung landesplanerischer Ziele in den Kommunen
- 7.2 Verfassungsrechtliche Determinanten des kommunalen Finanzausgleichs
- 7.2.1 Das Gebot der Gleichbehandlung und der Systemgerechtigkeit
- 7.2.2 Das Harmonisierungsgebot
- 7.2.3 Das Nivellierungsverbot
- 7.3 Der Verbundsatz und die Verbundmasse
- 7.4 Die Ausgleichsintensität
- 7.4.1 Zuweisungen des GFG NW
- 7.4.1.1 Schlüsselzuweisungen
- 7.4.1.2 Berechnung des Finanzbedarfs
- 7.4.1.3 Berechnung der Finanzkraft
- 7.4.2 Pauschale Zuweisungen für investive und konsumtive Maßnahmen
- 7.4.3 Sonderbedarfszuweisungen
- 7.4.4 Zweckgebundene Zuweisungen
- 7.4.5 Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes
- 7.5 Exkurs: Die Kreisumlage
- 8 DIE FINANZIELLE SITUATION NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER GEMEINDEN
- 8.1 Allgemeine Einnahmen- und Ausgabenentwicklung
- 8.2 Strukturelle Verschiebungen im Einnahmenbereich
- 8.2.1 Steuereinnahmen
- 8.2.1.1 Gewerbesteuer
- 8.2.1.2 Grundsteuer
- 8.2.1.3 Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern
- 8.2.1.4 Gemeindeanteil am Einkommensteueraufkommen
- 8.2.1.5 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen
- 8.2.2 Zuweisungen vom Land
- 8.2.2.1 Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes
- 8.2.2.2 Investitionszuweisungen des Landes
- 8.2.3 Gebühren und Beiträge
- 8.2.4 Sonstige Einnahmen
- 8.3 Strukturelle Verschiebungen im Ausgabenbereich
- 8.3.1 Personalausgaben
- 8.3.2 Sachaufwand
- 8.3.3 Sozialstaatliche Ausgaben
- 8.3.4 Zinsausgaben und Verschuldung
- 8.3.5 Sachinvestitionsausgaben
- 8.4 Zusammenfassende Darstellung der strukturellen Entwicklung der gemeindlichen Einnahmen und Ausgaben
- 9 STRUKTURPROBLEME DER QUANTITATIV-FISKALISCHEN FINANZAUSSTATTUNG
- 9.1 Strukturdefizite im Steuersystem
- 9.1.1 Die Gewerbesteuer - zunehmende Aushöhlung der eigengestaltbaren Gemeindesteuer
- 9.1.2 Die Grundsteuer - eine gute Gemeindesteuer
- 9.1.3 Der Einkommensteueranteil – kommunalspezifische Schwächen und zunehmende Unstetigkeit
- 9.1.4 Der Umsatzsteueranteil – kommunalspezifische Schwächen
- 9.1.5 Die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern - Irrelevanz aufgrund ihres geringen Aufkommens
- 9.1.6 Zusammenfassende Darstellung der strukturellen Schwächen im Steuersystem
- 9.2 Strukturdefizite im kommunalen Finanzausgleich
- 9.2.1 Finanzbedarfsermittlung
- 9.2.1.1 Methodische Anforderungen
- 9.2.1.2 Defizite bei der Finanzbedarfsermittlung im GFG NW 2000
- 9.2.2 Finanzkraftermittlung
- 9.2.2.1 Methodische Anforderungen
- 9.2.2.2 Defizite bei der Finanzkraftermittlung im GFG NW 2000
- 9.2.3 Höhe des Ausgleichsgrades im GFG NW 2000
- 10 ANSÄTZE UND HEMMNISSE EINER REFORM DES GEMEINDEFINANZSYSTEMS
- 10.1 Die Notwendigkeit einer Gemeindefinanzreform
- 10.2 Lastenverteilung
- 10.2.1 Lastenverteilungsregelung in Art. 28 GG
- 10.2.2 Neufassung des Art. 104a Abs. 3 GG
- 10.2.3 Anknüpfung des Konnexitätsprinzips an die Gesetzgebungskompetenz
- 10.2.4 Eigener Vorschlag: Aufnahme einer Quotenregelung
- 10.3 Mögliche Reformen zur Stärkung des gemeindlichen Steuersystems
- 10.3.1 Stärkung einer bestehenden Steuern: Die Grundsteuer
- 10.3.2 Revitalisierung der Gewerbesteuer
- 10.3.3 Einführung des Hebesatzrechts beim gemeindlichen Einkommensteueranteil
- 10.4 Die Möglichkeiten zur Ausgestaltung eines adäquaten Finanzausgleichs
- 10.4.1 Verbesserungen in der Finanzbedarfsermittlung
- 10.4.2 Verbesserungen bei der Finanzkraftermittlung
- 10.5 Ausblick: Die Chancen einer umfassenden Verbesserung des kommunalen Finanzierungssystems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die finanzielle Ausstattung deutscher Gemeinden, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, die Problematik der (aufgabenadäquaten) Finanzausstattung im Kontext der kommunalen Selbstverwaltung und des Konnexitätsprinzips zu analysieren.
- Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland
- Das Konnexitätsprinzip und seine Anwendung
- Die Struktur der kommunalen Einnahmen
- Finanzielle Auswirkungen staatlicher Aufgabenübertragungen
- Reformansätze für das Gemeindefinanzsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1 Fragestellung und Vorgehensweise der Arbeit: Die Arbeit untersucht die finanzielle Ausstattung deutscher Gemeinden, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Sie beleuchtet die Entwicklung der Gemeindefinanzen, den Einfluss von Bundes- und Landesgesetzgebern, die Probleme der gemeindlichen Einnahmenstruktur und skizziert die Vorgehensweise der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Gemeinden ausreichend finanziert werden, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
2 Die institutionelle Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG: Dieses Kapitel befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland, insbesondere mit Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG). Es analysiert die institutionelle Rechtssubjektsgarantie, die objektive Rechtsinstitutionengarantie (einschließlich Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, Allzuständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Gesetzesvorbehalt und abgeleiteter Gemeindehoheiten) und die subjektive Rechtsstellungsgarantie. Die Bedeutung dieser Garantien für die kommunale Autonomie wird herausgestellt.
3 Die finanzielle Absicherung der objektiven Rechtsinstitutionengarantie in der Finanzverfassung des Grundgesetzes: Dieses Kapitel behandelt die finanzielle Seite der kommunalen Selbstverwaltung. Es analysiert die Rolle der Finanzverfassung im GG, relevante Regelungen und das Konnexitätsprinzip als allgemeine Lastenverteilungsregel. Es untersucht die gemeindlichen Ertragshoheiten (Steuern, Gemeindeanteile etc.) und den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern. Der Zusammenhang zwischen finanzieller Ausstattung und kommunaler Selbstverwaltung wird deutlich gemacht.
4 Landes(Verfassungs-)rechtliche Ausgestaltung der objektiven Rechtsinstitutionengarantie in NW: Dieses Kapitel fokussiert auf die Umsetzung der verfassungsrechtlichen Garantien der kommunalen Selbstverwaltung im Landesrecht Nordrhein-Westfalens. Es untersucht die inhaltlichen Zusammenhänge zwischen Landes- und Bundesverfassungsrecht, unterscheidet zwischen freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben und beleuchtet die finanzielle Situation der Gemeinden in NRW im Detail. Der Artikel 78 Absatz 3 LVerf NW als relatives Konnexitätsprinzip wird besonders behandelt.
5 Die Finanzhoheit und eine aufgabenadäquate Finanzausstattung als Eckpfeiler gemeindlicher Eigenverantwortlichkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Finanzhoheit als materiellem Inhalt der Selbstverwaltungsgarantie. Es analysiert deren Bestandteile (Haushaltshoheit, Ausgabenhoheit, Einnahmenhoheit) und untersucht den Finanzausstattungsanspruch der Gemeinden. Der Umfang einer angemessenen Finanzausstattung und die Verpflichtungsadressaten werden ebenfalls thematisiert.
6 Staatliche Aufgabenübertragungen, Finanzausstattung und gemeindliche Selbstverwaltung - Strukturprobleme der qualitativ-aufgabenbezogenen Finanzausstattung: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen staatlicher Aufgabenübertragungen auf die kommunale Finanzausstattung. Es analysiert die Reichweite staatlicher Befugnisse, verfassungsrechtliche Anforderungen an Aufgabenübertragungen und den qualitativen Wandel pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben. Der Fokus liegt auf den Problemen, die entstehen, wenn Aufgaben übertragen werden, ohne eine angemessene Kostenerstattung zu gewährleisten.
7 Die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs im GFG NW 2000: Dieses Kapitel beschreibt den kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen, wie er im Gesetz über den Finanzausgleich (GFG NW) 2000 geregelt ist. Es analysiert die Funktionen des Finanzausgleichs, verfassungsrechtliche Determinanten (Gleichbehandlung, Harmonisierung, Nivellierungsverbot) und die verschiedenen Arten von Zuweisungen. Der Verbundsatz, die Verbundmasse und die Ausgleichsintensität werden detailliert erklärt.
Schlüsselwörter
Kommunale Selbstverwaltung, Konnexitätsprinzip, Gemeindefinanzierung, Finanzausstattung, Nordrhein-Westfalen, Aufgabenadäquanz, Steuerhoheit, Finanzausgleich, GFG NW 2000, Bundesauftragsangelegenheiten, Eigenverantwortlichkeit, Finanzhoheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kommunale Finanzausstattung in Nordrhein-Westfalen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die finanzielle Ausstattung deutscher Gemeinden, insbesondere in Nordrhein-Westfalen (NRW), im Kontext der kommunalen Selbstverwaltung und des Konnexitätsprinzips. Sie untersucht, ob die Gemeinden ausreichend finanziert sind, um ihre Aufgaben zu erfüllen, und beleuchtet die damit verbundenen Probleme.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, das Konnexitätsprinzip und seine Anwendung, die Struktur der kommunalen Einnahmen, die finanziellen Auswirkungen staatlicher Aufgabenübertragungen und Reformansätze für das Gemeindefinanzsystem. Im Detail werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen (Art. 28 Abs. 2 GG), die Finanzverfassung des Grundgesetzes, das Landesrecht NRW (insbesondere Art. 78 Abs. 3 LVerf NW), die Finanzhoheit der Gemeinden, der kommunale Finanzausgleich (GFG NW 2000) und die strukturellen Defizite im Steuersystem und Finanzausgleich untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zehn Kapitel, die von der Fragestellung und Vorgehensweise über die verfassungsrechtlichen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung bis hin zur Analyse der finanziellen Situation nordrhein-westfälischer Gemeinden und möglichen Reformansätzen reichen. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der kommunalen Finanzausstattung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im HTML-Dokument.
Was ist das Konnexitätsprinzip und welche Rolle spielt es?
Das Konnexitätsprinzip ist eine wichtige Lastenverteilungsregel, die besagt, dass derjenige, der die Aufgaben setzt, auch die Kosten dafür zu tragen hat. Die Arbeit untersucht die Anwendung dieses Prinzips auf das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und analysiert, inwieweit es die finanzielle Ausstattung der Gemeinden sicherstellt.
Wie ist die finanzielle Situation der Gemeinden in NRW?
Die Arbeit analysiert die Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Gemeinden in NRW. Sie untersucht dabei strukturelle Verschiebungen im Einnahmenbereich (Steuern, Zuweisungen, Gebühren etc.) und im Ausgabenbereich (Personalausgaben, Sachaufwand, Sozialausgaben etc.). Die Analyse zeigt die Herausforderungen für die Gemeinden auf und begründet den Bedarf an Reformen.
Welche Reformansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze zur Reform des Gemeindefinanzsystems, darunter eine Neugestaltung der Lastenverteilung, eine Stärkung des gemeindlichen Steuersystems (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil) und Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich. Es wird auch ein eigener Vorschlag zur Aufnahme einer Quotenregelung unterbreitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Kommunale Selbstverwaltung, Konnexitätsprinzip, Gemeindefinanzierung, Finanzausstattung, Nordrhein-Westfalen, Aufgabenadäquanz, Steuerhoheit, Finanzausgleich, GFG NW 2000, Bundesauftragsangelegenheiten, Eigenverantwortlichkeit, Finanzhoheit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit kommunaler Selbstverwaltung, Finanzrecht und dem Konnexitätsprinzip befassen. Sie ist aber auch für politische Entscheidungsträger, Gemeindeverwaltungen und alle Interessierten, die sich mit den Herausforderungen der kommunalen Finanzen auseinandersetzen, von Bedeutung.
Wo finde ich das detaillierte Inhaltsverzeichnis?
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit allen Unterkapiteln ist im bereitgestellten HTML-Dokument enthalten.
Welche Art von Daten wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf OCR-Daten eines Verlags und ist ausschließlich für akademische Zwecke bestimmt, um Themen strukturiert und professionell zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Mirco Stodollick (Autor:in), 2000, Kommunale Selbstverwaltung, Konnexitätsprinzip und Struktur der kommunalen Einnahmen. Die Finanzausstattung deutscher Gemeinden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290