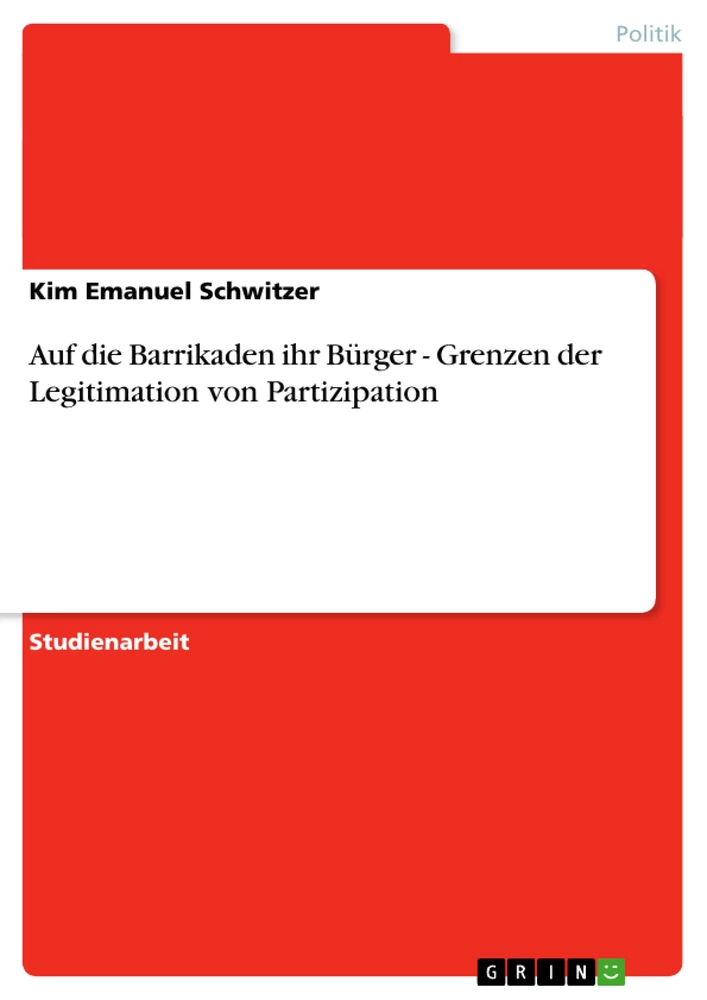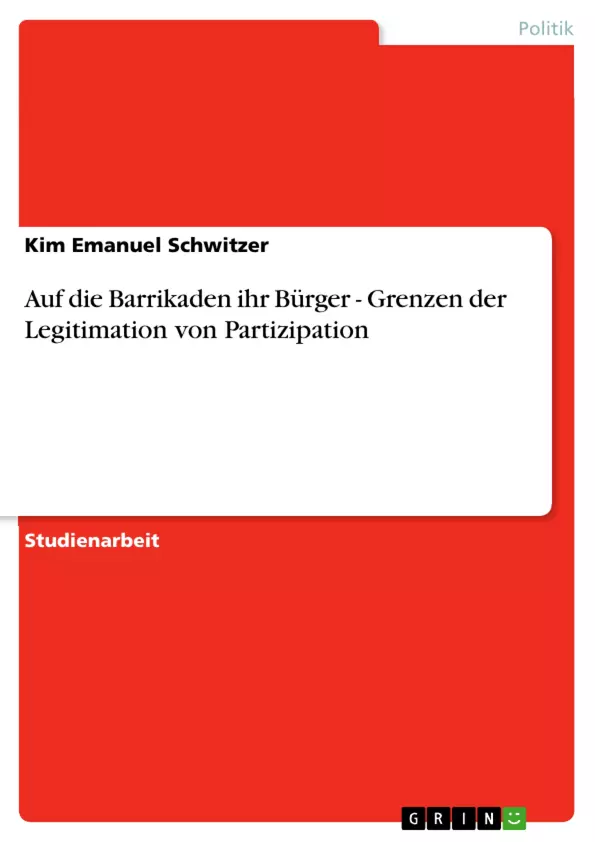Einleitung
Eingedenk der Entwicklungsstadien politischer Partizipation1 bietet sich dem Betrachter eine Vielzahl an Erscheinungsformen, die je nach zugrundeliegendem Zeitgeist und Wertvorstellungen, kontinuierlichen Wandlungen unterworfen sind. Die zunächst ausschließlich konventionellen Beteiligungsformen in Wahl und Partei, erfahren ab den späten 1960er Jahren zusehends Erweiterung. In Form leidenschaftlicher nach amerikanischem Vorbild praktizierter Protestkultur als politischer Teilhabe, mündet sie nachfolgend in eine institutionalisierte Einbindung von Initiativen in die Parteienlandschaft der 1980er Jahren. Den fortwährender Antrieb stellt eine umfassende Forderung nach der Ausweitung sozialer und politischer Beteiligungsrechte dar.
Vielfach bedingt ein sich erneuernder gesellschaftlicher Zeitgeist veränderte Positionen, die gerade bezogen auf die politischen Artikulationsformen und die hiermit einhergehenden Verortungen der Grenzbereiche von Legalität und Legitimität von Partizipation, im Spannungsfeld (Bürger-)Initiative-Politik-Jurisdiktion bisweilen diametral entgegenstehen.
Im Hinblick auf die Komplexität diese Aspektes demokratischer Teilhabe, gliedert sich diese Arbeit in fünf aufeinander aufbauende Abschnitte. So sind dies zunächst die Erläuterung von Begriffsumfeld und verfassungsrechtlicher Verankerung der Partizipation im zweiten und dritten Abschnitt, der in die Dokumentation der Grenzformen politischer Partizipation mündet.
Ein Schwerpunkt der Darstellung von Legitimationsgrenzen und liegt auf dem in den 1970er bis Mitte der 1980er Jahre vieldiskutierten Institut des zivilen Ungehorsams, sowie der Erscheinungsform der Bürgerinitiative. Über die Darstellung der divergierenden Positionen im politischen Diskurs hinaus, ist beabsichtigt grundlegende staatsrechtliche Aspekte mit dem Fokus auf die in der Verfassung niedergelegten Möglichkeiten eines Wertepluralismus erhaltenden, wie erweiternden Handelns zu veranschaulichen. Eine Würdigung der Positionen der aufgebrachten Partizipationsformen schließt diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Partizipation als Teilhabe
- 2.1. Begriffsbestimmung von Partizipation und Legitimation
- 2.2. Ursprung der Partizipation
- 2.3. Erscheinungsformen von Partizipation
- 3. Verfassungsrechtliche Grundlagen
- 3.1. Verfasste und konventionelle Formen
- 3.2. Verfasste und nichtverfasste unkonventionelle Formen
- 3.2.1. Legitimationsgrundlagen am Beispiel der Bürgerinitiative
- 4. Grenzformen politischer Partizipation
- 4.1. Politischer Protest
- 4.1.1. Ziviler Ungehorsam
- 4.1.2. Militanter Widerstand/Terrorismus
- 4.2. Weitere partizipatorische Formen
- 4.2.1. Klientelismus und Korruption
- 4.2.2. Alte Formen, neues Forum - eDemokratie
- 4.1. Politischer Protest
- 5. Rück vs. Barrikade – Verortung widerstrebender Positionen
- 6. Zusammenfassung und Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grenzen der Legitimation politischer Partizipation in Deutschland. Sie analysiert verschiedene Formen der Partizipation, von konventionellen Methoden bis hin zu unkonventionellem Protest. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Legitimität dieser Formen im Kontext des deutschen Verfassungsrechts und der gesellschaftlichen Werte.
- Begriffsbestimmung und historische Entwicklung der politischen Partizipation
- Verfassungsrechtliche Grundlagen und Legitimation verschiedener Partizipationsformen
- Grenzen der Legitimation im Spannungsfeld zwischen legalem Handeln und politischem Protest
- Analyse des zivilen Ungehorsams und der Bürgerinitiative als Beispiele unkonventioneller Partizipation
- Vergleich verschiedener Positionen im politischen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der politischen Partizipation ein und beschreibt die Entwicklung verschiedener Beteiligungsformen vom konventionellen Wahlverhalten bis hin zu unkonventionellen Protestformen. Sie hebt die Veränderung des gesellschaftlichen Zeitgeistes und die damit einhergehenden Verschiebungen im Verständnis von Legalität und Legitimität von Partizipation hervor. Die Arbeit gliedert sich in fünf Abschnitte, die sich mit der Begriffsbestimmung, den verfassungsrechtlichen Grundlagen, Grenzformen, divergierenden Positionen und einer abschließenden Würdigung auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf der Legitimation von Partizipationsformen vor dem Hintergrund des deutschen Rechtsstaates.
2. Partizipation als Teilhabe: Dieses Kapitel definiert den Begriff der politischen Partizipation als Teilhabe von Bürgern an politischen Prozessen. Es unterscheidet Partizipation von Begriffen wie Demokratisierung und Mitbestimmung und grenzt den politisch-administrativen Sektor ab. Der Ursprung und die verschiedenen Erscheinungsformen der Partizipation werden erläutert. Hier wird die Basis für die spätere Analyse der Legitimationsgrenzen gelegt, indem die verschiedenen Formen und den historischen Kontext der Partizipation erarbeitet werden.
3. Verfassungsrechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen politischer Partizipation in Deutschland. Es unterscheidet zwischen verfassten und konventionellen sowie verfassten und nichtverfassten unkonventionellen Formen der Partizipation. Besondere Aufmerksamkeit wird der Bürgerinitiative gewidmet und ihre Legitimationsgrundlagen analysiert. Dieser Abschnitt bildet das juristische Fundament für die Bewertung der Legitimität verschiedener Partizipationsformen im weiteren Verlauf der Arbeit.
4. Grenzformen politischer Partizipation: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Grenzformen politischer Partizipation, insbesondere mit politischem Protest, darunter ziviler Ungehorsam und militanter Widerstand/Terrorismus. Zusätzlich werden weitere Formen wie Klientelismus und Korruption untersucht. Im Kontext von "alten Formen im neuen Forum" wird die eDemokratie als ein Beispiel für die sich wandelnde Partizipation im digitalen Zeitalter beleuchtet. Dieser Teil der Arbeit zeigt die Spannbreite politischer Partizipation und analysiert die Herausforderungen der Legitimation, besonders in den Bereichen des extremen Protests und der Korruption.
5. Rück vs. Barrikade – Verortung widerstrebender Positionen: Dieses Kapitel analysiert unterschiedliche Positionen im Diskurs über politische Partizipation, wobei die Spannung zwischen gemäßigten und radikaleren Formen von Protest im Vordergrund steht. Es werden verschiedene Perspektiven und Argumente im Detail erörtert, um ein umfassendes Bild der Debatte zu zeichnen. Hier wird die komplexe Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Ansätzen der politischen Teilhabe erarbeitet.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Legitimation, Verfassungsrecht, Bürgerinitiative, ziviler Ungehorsam, Protest, eDemokratie, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wertepluralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Grenzen der Legitimation politischer Partizipation in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Grenzen der Legitimation politischer Partizipation in Deutschland. Sie analysiert verschiedene Formen der Partizipation, von konventionellen Methoden bis hin zu unkonventionellem Protest, mit besonderem Augenmerk auf deren Legitimität im Kontext des deutschen Verfassungsrechts und der gesellschaftlichen Werte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und historische Entwicklung politischer Partizipation, die verfassungsrechtlichen Grundlagen und Legitimation verschiedener Partizipationsformen, die Grenzen der Legitimation im Spannungsfeld zwischen legalem Handeln und politischem Protest, den zivilen Ungehorsam und die Bürgerinitiative als Beispiele unkonventioneller Partizipation sowie den Vergleich verschiedener Positionen im politischen Diskurs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel:
- Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Beschreibung der Entwicklung verschiedener Beteiligungsformen und Hervorhebung der Veränderungen im Verständnis von Legalität und Legitimität.
- Kapitel 2 (Partizipation als Teilhabe): Definition von politischer Partizipation, Unterscheidung von ähnlichen Begriffen und Erläuterung des Ursprungs und der Erscheinungsformen.
- Kapitel 3 (Verfassungsrechtliche Grundlagen): Untersuchung der verfassungsrechtlichen Grundlagen politischer Partizipation in Deutschland, Unterscheidung verschiedener Formen und Analyse der Legitimationsgrundlagen der Bürgerinitiative.
- Kapitel 4 (Grenzformen politischer Partizipation): Auseinandersetzung mit Grenzformen wie politischem Protest (ziviler Ungehorsam, militanter Widerstand/Terrorismus), Klientelismus, Korruption und eDemokratie.
- Kapitel 5 (Rück vs. Barrikade – Verortung widerstrebender Positionen): Analyse unterschiedlicher Positionen im Diskurs über politische Partizipation, insbesondere die Spannung zwischen gemäßigten und radikaleren Protestformen.
- Kapitel 6 (Zusammenfassung und Würdigung): Zusammenfassung der Ergebnisse und abschließende Bewertung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Politische Partizipation, Legitimation, Verfassungsrecht, Bürgerinitiative, ziviler Ungehorsam, Protest, eDemokratie, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wertepluralismus.
Welche konkreten Beispiele unkonventioneller Partizipation werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den zivilen Ungehorsam und die Bürgerinitiative als Beispiele unkonventioneller Partizipation. Zusätzlich werden militanter Widerstand/Terrorismus, Klientelismus und Korruption untersucht.
Wie wird die Legitimität verschiedener Partizipationsformen bewertet?
Die Bewertung der Legitimität verschiedener Partizipationsformen erfolgt vor dem Hintergrund des deutschen Verfassungsrechts und der gesellschaftlichen Werte. Die Arbeit untersucht die Spannungsfelder zwischen legalem Handeln und politischem Protest.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Grenzen der Legitimation politischer Partizipation in Deutschland zu untersuchen und ein umfassendes Bild der verschiedenen Formen und ihrer Legitimität zu zeichnen.
- Quote paper
- Kim Emanuel Schwitzer (Author), 2003, Auf die Barrikaden ihr Bürger - Grenzen der Legitimation von Partizipation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12900