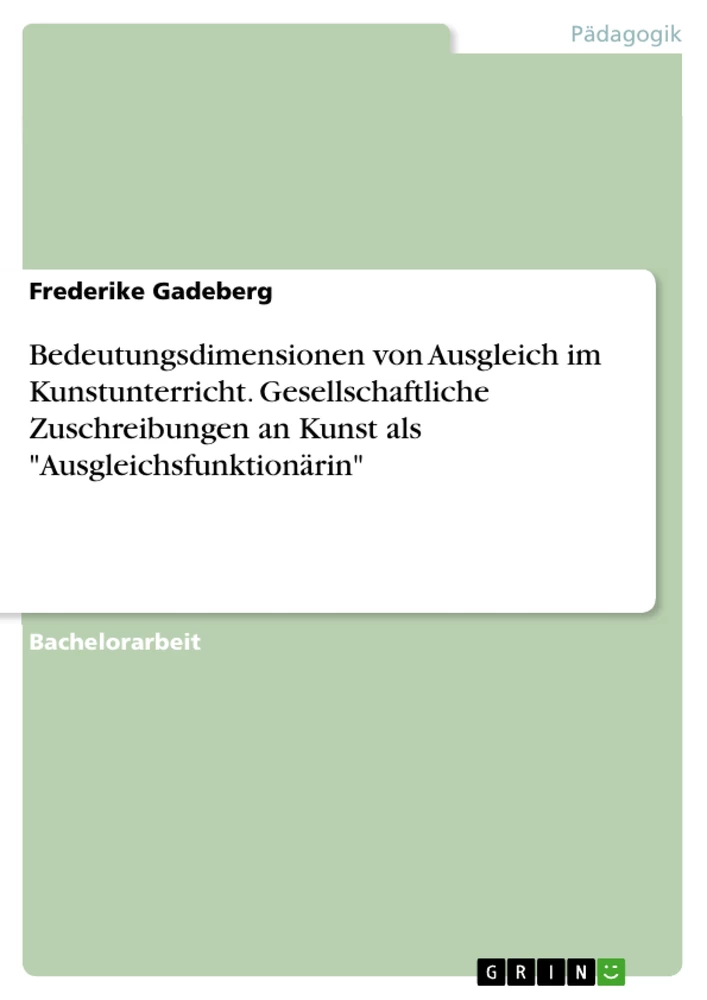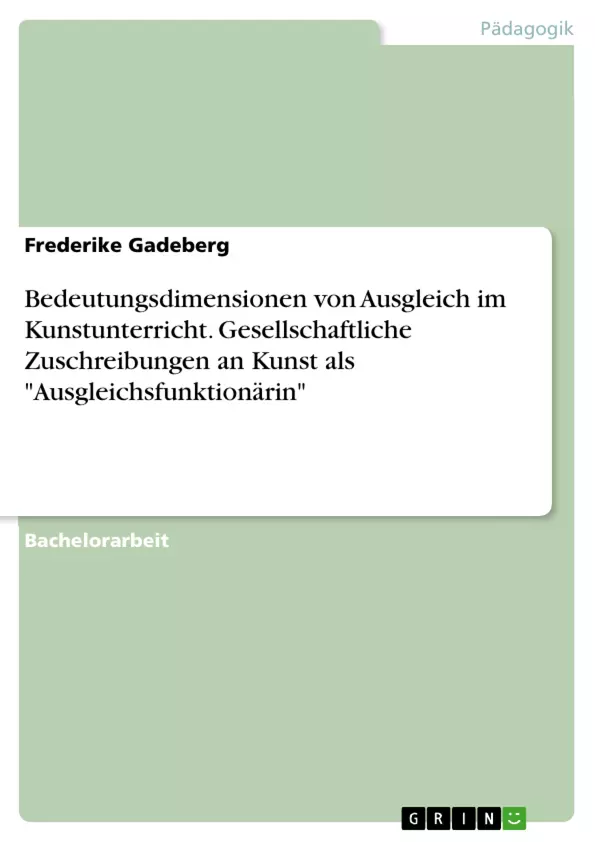Diese Arbeit zeigt anhand ausgewählter wissenschaftlicher Texte die Abbildung unterschiedlicher Zugänge zur Verbindung von Kunst und Ausgleich in gesellschaftlicher Hinsicht. Unter Berücksichtigung einer kunstpädagogisch motivierten Arbeit ist daraufhin zu fragen, ob es sich mit Kunstunterricht und dessen Konzeption in gleicher Weise verhält – Welche Bedeutungen von Ausgleich gibt es im Kunstunterricht? Daher werden die verschiedenen Positionen der ausgewählten Texte im Anschluss in Form eines Gedankenexperiments auf den Kunstunterricht angewendet. Im Kontext der Bereiche Forschung, Kunst und Pädagogik bewegt sich diese Arbeit in dem Feld kompensatorischen Kunstunterrichts, der unter anderem in zwei Ausgaben des Themenhefts "Kunst und Unterricht" explizit dargestellt wird.
Um eine alternative, vielleicht neue, Perspektive einzunehmen, wird sich hier zunächst von dem scheinbar inflationär benutzten und negativ konnotierten Begriff Kompensation distanziert und dafür der Begriff Ausgleich ins Zentrum der Untersuchung gestellt. Neben dieser selbstständigen Entwicklung eines Arbeitsbegriffes (auf der Basis sprachwissenschaftlicher Literatur nach Peter Eisenberg) bietet auch die Methode des Gedankenexperiments eine unkonventionelle Herangehensweise, wodurch diese Arbeit einen Beitrag zum Diskurs leistet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachlich-semantische Untersuchung des Begriffs Ausgleich
- 3. Abhandlung gesellschaftlicher Zuschreibungen an Kunst als ausgleichsfunktionierend und deren Zusammenführung mit der Ausgleich-Definition zur Klärung der Bedeutungsdimensionen von Ausgleich
- 3.1. Position S. Freuds: Psychische Sublimierung durch Kunst
- 3.2. Position A. Gehlens: Psychische Entlastung durch Kunst
- 3.3. Gemeinsame Position J. Ritters, O. Marquards und H. Lübbes: Entschleunigung durch Kunst
- 3.4. Position H. Hoffmanns: Soziale Teilhabe durch Kunst
- 3.5. Position B. Mandels: Soziale Gerechtigkeit durch Kunst
- 3.6. Position C. Mörschs: Empowerment durch Kunst
- 3.7. Zwischenzusammenfassung
- 4. Ein Gedankenexperiment: Übertragung der Positionen auf den Kunstunterricht
- 4.1. Position S. Freuds: Psychische Sublimierung durch Kunst
- 4.2. Position A. Gehlens: Psychische Entlastung durch Kunst
- 4.3. Gemeinsame Position J. Ritters, O. Marquards und H. Lübbes: Entschleunigung durch Kunst
- 4.4. Position H. Hoffmanns: Soziale Teilhabe durch Kunst
- 4.5. Position B. Mandels: Soziale Gerechtigkeit durch Kunst
- 4.6. Position C. Mörschs: Empowerment durch Kunst
- 4.7. Resultierende Überlegungen
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungsdimensionen von Ausgleich im Kunstunterricht. Sie befasst sich mit der Frage, wie exemplarische Positionen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Kunst als "Ausgleichsfunktionärin" für die Gesellschaft im Kontext des Kunstunterrichts verstehen würden. Durch ein Gedankenexperiment wird die Relevanz und Aktualität dieser Zuschreibung an Kunst, sowie deren Wandelbarkeit deutlich. Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Schriften in zweifacher Hinsicht zu lesen: einerseits als Positionen, die Kunst eine spezifisch ausgleichende Funktion zuschreiben, und andererseits als Konzepte für ausgleichenden Kunstunterricht.
- Sprachlich-semantische Analyse des Begriffs "Ausgleich"
- Gesellschaftliche Zuschreibungen an Kunst als ausgleichende Funktion
- Übertragung der Positionen auf den Kunstunterricht durch ein Gedankenexperiment
- Analyse der Relevanz und Aktualität von Kunst als "Ausgleichsfunktionärin"
- Reflexion über die Bedeutung und Praxis von ausgleichenden Kunstunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, wie exemplarische Positionen ihr spezifisches Konzept von Kunst als Ausgleich für die Gesellschaft im Kunstunterricht verhandeln würden. Sie erläutert die Personifizierung von Kunst als "Ausgleichsfunktionärin" und die Notwendigkeit, unterschiedliche Zugänge zur Verbindung von Kunst und Ausgleich zu betrachten.
- Sprachlich-semantische Untersuchung des Begriffs Ausgleich: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem sprachlich-semantischen Verständnis des Begriffs "Ausgleich" und konstituiert ein differenziertes Verständnis, einen Arbeitsbegriff, der eine interdisziplinäre Untersuchung ermöglicht.
- Abhandlung gesellschaftlicher Zuschreibungen an Kunst als ausgleichsfunktionierend und deren Zusammenführung mit der Ausgleich-Definition zur Klärung der Bedeutungsdimensionen von Ausgleich: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Positionen von Autor*innen wie Sigmund Freud, Arnold Gehlen, Joachim Ritter, Odo Marquard, Hermann Lübbe, Hilmar Hoffmann, Birgit Mandel und Carmen Mörsch. Es wird analysiert, wie diese Autor*innen Kunst in Bezug auf ihre jeweiligen Konzepte von Ausgleich verstehen.
- Ein Gedankenexperiment: Übertragung der Positionen auf den Kunstunterricht: Dieses Kapitel überträgt die verschiedenen Positionen aus dem vorherigen Kapitel auf den Kunstunterricht. Es werden verschiedene Konzepte für ausgleichenden Kunstunterricht entwickelt, basierend auf den jeweiligen Positionen der Autor*innen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit fokussiert auf die Bedeutung von Ausgleich im Kunstunterricht und untersucht die Verbindung von Kunst und Ausgleich aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kunst, Ausgleich, Kompensation, gesellschaftliche Zuschreibungen, Gedankenexperiment, Kunstunterricht, ausgleichender Kunstunterricht, Positionen, Theorien, Sublimierung, Entlastung, Entschleunigung, Teilhabe, Gerechtigkeit, Empowerment.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ausgleich“ im Kontext des Kunstunterrichts?
Der Begriff „Ausgleich“ wird als Alternative zum oft negativ besetzten Begriff der „Kompensation“ verwendet. Er beschreibt die Funktion von Kunst, gesellschaftliche oder psychische Defizite zu balancieren.
Wie interpretierte Sigmund Freud die Funktion von Kunst?
Freud sah in der Kunst ein Mittel zur psychischen Sublimierung, bei der unterdrückte Triebe in kulturell anerkannte, schöpferische Leistungen umgewandelt werden.
Was versteht Arnold Gehlen unter „psychischer Entlastung“ durch Kunst?
Gehlen argumentiert, dass Kunst den Menschen von der Reizüberflutung und dem Handlungsdruck des Alltags entlastet und so eine stabilisierende Funktion einnimmt.
Welche Rolle spielt Kunst für die soziale Gerechtigkeit?
Positionen wie die von Birgit Mandel betonen, dass Kunst soziale Teilhabe ermöglichen und zur sozialen Gerechtigkeit beitragen kann, indem sie Barrieren abbaut.
Was ist das Ziel des Gedankenexperiments in dieser Arbeit?
Das Gedankenexperiment überträgt theoretische Positionen (z.B. Empowerment nach Mörsch) auf die Praxis des Kunstunterrichts, um deren Relevanz für moderne pädagogische Konzepte zu prüfen.
Kann Kunstunterricht zur Entschleunigung beitragen?
Ja, basierend auf den Thesen von Ritter, Marquard und Lübbe kann Kunstunterricht als kompensatorisches Element zur modernen Beschleunigung wirken und Räume für Verweilen und Reflexion schaffen.
- Quote paper
- Frederike Gadeberg (Author), 2019, Bedeutungsdimensionen von Ausgleich im Kunstunterricht. Gesellschaftliche Zuschreibungen an Kunst als "Ausgleichsfunktionärin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290046