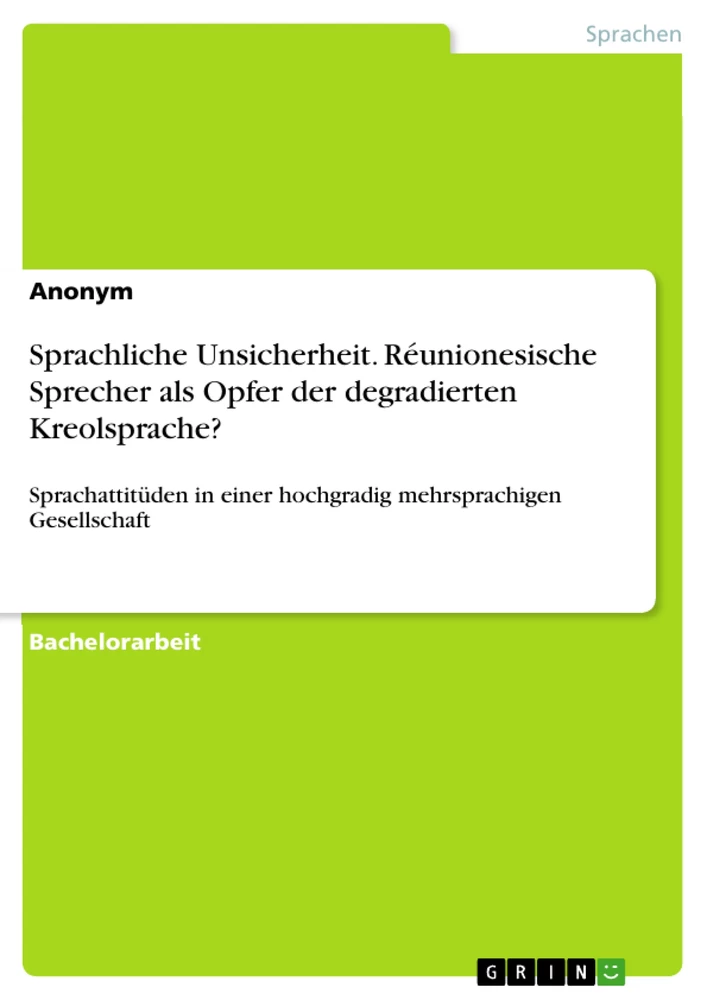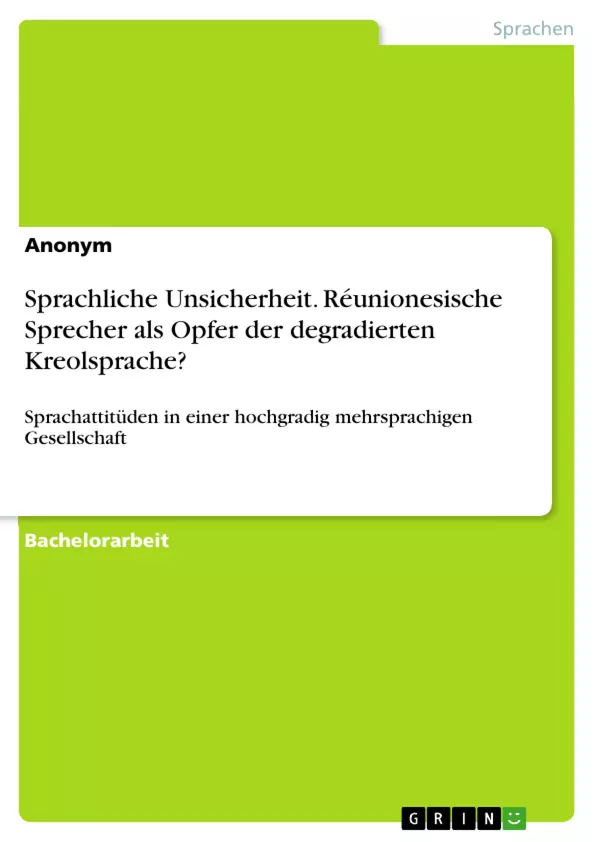Heute ist die Mehrsprachigkeit die Norm und bestimmt durch die verschiedenen Kreolsprachen auch die Alltagsrealität in den Überseegebieten Frankreichs. Auch La Réunion gilt als eine zu Frankreich gehörende mehrsprachige Insel, da neben Kreolisch auch die Landessprache Französisch eine wichtige Rolle im Alltag der Bewohner von La Réunion spielt.
Daher konzentriert sich die Forschungsfrage darauf, wie sich der Verfall des Kreolischen in den sprachlichen Einstellungen der Bevölkerung von La Réunion in Bezug auf das Kreolische bemerkbar macht. Diese Frage wird im Rahmen einer Analyse der Ergebnisse einer Umfrage einer gemischten Gruppe von Einwohnern von La Réunion behandelt.
Die folgende Ausarbeitung thematisiert die sprachliche Wirklichkeit auf der Insel La Réunion und insbesondere die aktuellen Spracheinstellungen der Sprecher:innen der mehrsprachigen réunionesischen Gesellschaft. Der erste Teil der Ausführungen widmet sich den theoretischen Grundlagen und Begriffsdefinitionen. Zunächst wird der Begriff der Mehrsprachigkeit erklärt, die unterschiedlichen Typen von Mehrsprachigkeit werden vorgestellt und der Erwerb von Mehrsprachigkeit wird erläutert. Danach wird das Phänomen des Sprachkontakts genauer beleuchtet und auch die sprachlichen Erscheinungen Di-, Tri- und Polyglossie werden aufgezeigt. Im Folgenden wird die réunionesische Gesellschaft als Mischvolk, das als Schmerztiegel der verschiedensten Kulturen erscheint, vorgestellt. Der anschließende Teil befasst sich mit der Geschichte der Insel La Réunion, die sich von der Sklaverei und Kolonialisierung befreit hat und nun als Départment d’Outre-Mer zum französischen Staatsgebiet zählt. Des Weiteren wird der soziolinguistische Kontext erörtert und dabei werden unter anderem auch die Entwicklung des créole réunionnais und die aktuelle Sprachsituation auf dem Überseedepartement La Réunion dargestellt. Der letzte Teil der Ausarbeitung ist meiner Umfrage gewidmet, die die Sprachhaltungen von Réuniones:innen in der heutigen Zeit genauer untersucht. Die Leitfrage, ob und inwiefern die kreolsprechende Bevölkerung Opfer der degradierten Kreolsprache ist, soll im Zuge der empirischen Auswertung des Fragebogens diskutiert und beantwortet werden. Den Abschluss meiner Ausarbeitung bildet eine kritische Reflexion meiner Umfrage. Abschließend wird das Fazit die wichtigsten Erkenntnisse und Thesen zusammenfassen, sowie die Forschungsfrage der vorliegenden Abschlussarbeit beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Begriffserklärungen
- Mehrsprachigkeit
- Typen von Mehrsprachigkeit
- Erwerb von Mehrsprachigkeit
- Sprachkontakt
- Di-, Tri- und Polyglossie
- Mehrsprachigkeit
- La Réunion - Ein ethnisches Mosaik
- Historischer Kontext
- Soziolinguistischer Kontext
- Die Entwicklung des créole réunionnais
- Die aktuelle Sprachsituation auf La Réunion
- Sprachliche Unsicherheit
- Zum Konzept der sprachlichen Unsicherheit
- Gründe für die sprachliche Unsicherheit auf La Réunion
- Sprachpolitische Gründe
- Soziale Gründe
- Sprachattitüden: Ergebnisse einer Umfrage bei Réuniones:innen
- Begriffserklärung Sprachattitüden
- Forschungsdesign und Leitfrage
- Methode und Vorgehensweise
- Empirische Auswertung des Fragebogens
- Merkmale der Proband:innengruppe
- Dargestellter Sprachgebrauch
- Sprachrezeption im Kreol
- Einstellungen zum Sprachgebrauch
- Kritische Abschlussevaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der sprachlichen Unsicherheit bei Réuniones:innen im Kontext der Mehrsprachigkeit auf der Insel La Réunion. Ziel ist es, die Auswirkungen der Degradierung des créole réunionnais auf die Sprachhaltungen der Bevölkerung zu untersuchen. Hierzu werden sowohl theoretische Grundlagen der Mehrsprachigkeit und des Sprachkontakts erläutert als auch der soziolinguistische Kontext La Réunions beleuchtet. Die Arbeit analysiert insbesondere die Ergebnisse einer Umfrage, die sich mit den Sprachattitüden von Réuniones:innen beschäftigt.
- Mehrsprachigkeit auf La Réunion
- Die Rolle des créole réunionnais in der Gesellschaft
- Sprachliche Unsicherheit und ihre Ursachen
- Sprachattitüden und deren Einfluss auf den Sprachgebrauch
- Die Bedeutung des Sprachkontakts für die Entwicklung der Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sprachlichen Unsicherheit auf La Réunion ein und skizziert den historischen und soziolinguistischen Kontext der Insel. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Mehrsprachigkeit, des Sprachkontakts und der Di-, Tri- und Polyglossie. Im dritten Kapitel wird La Réunion als ethnisches Mosaik vorgestellt. Die Kapitel vier und fünf beleuchten den historischen und soziolinguistischen Kontext der Insel, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung des créole réunionnais und der aktuellen Sprachsituation liegt. Das sechste Kapitel behandelt das Konzept der sprachlichen Unsicherheit und analysiert die Gründe für diese Unsicherheit auf La Réunion, unterteilt in sprachpolitische und soziale Ursachen. Das siebte Kapitel stellt die Ergebnisse einer Umfrage zu den Sprachattitüden von Réuniones:innen vor. Die Umfrage beleuchtet den Sprachgebrauch, die Sprachrezeption im Kreol und die Einstellungen der Teilnehmer:innen zum Sprachgebrauch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachliche Unsicherheit, Sprachattitüden, créole réunionnais, La Réunion, Frankreich, Soziolinguistik, Ethnografie, Empirische Forschung, Fragebogenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Sprachen werden auf La Réunion primär gesprochen?
Die Bewohner nutzen sowohl das Créole Réunionnais als auch die offizielle Landessprache Französisch im Alltag.
Was versteht man unter "sprachlicher Unsicherheit" auf La Réunion?
Es beschreibt das Gefühl der Minderwertigkeit vieler Sprecher gegenüber dem Französischen, da das Kreolische oft als "degradierte" Sprache wahrgenommen wird.
Was sind die Ursachen für die Degradierung des Kreolischen?
Gründe sind vor allem sprachpolitische Vorgaben Frankreichs sowie soziale Strukturen, die Französisch mit Bildung und Erfolg verknüpfen.
Was ist der Unterschied zwischen Diglossie und Polyglossie?
Diglossie bezeichnet das Nebeneinander zweier Sprachvarianten, während Polyglossie die Verwendung vieler verschiedener Sprachen in einer Gesellschaft meint.
Wie wirkt sich die Geschichte der Sklaverei auf die heutige Sprache aus?
Das Kreolische entstand als Kontaktsprache während der Kolonialzeit und ist heute ein zentrales Element der ethnischen Identität auf der Insel.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2022, Sprachliche Unsicherheit. Réunionesische Sprecher als Opfer der degradierten Kreolsprache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290184