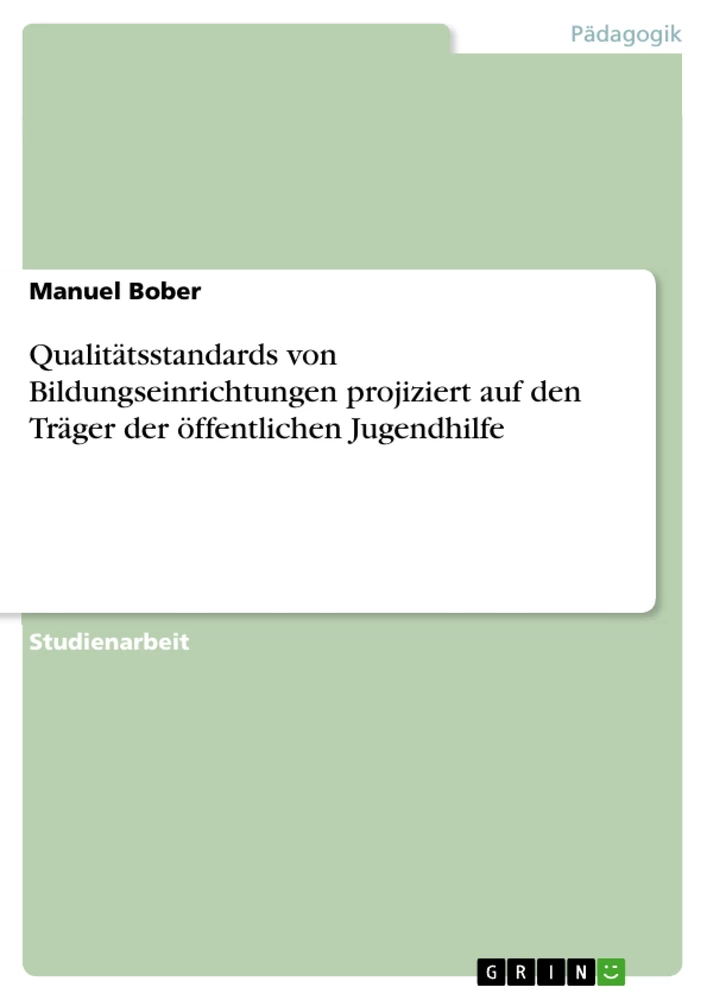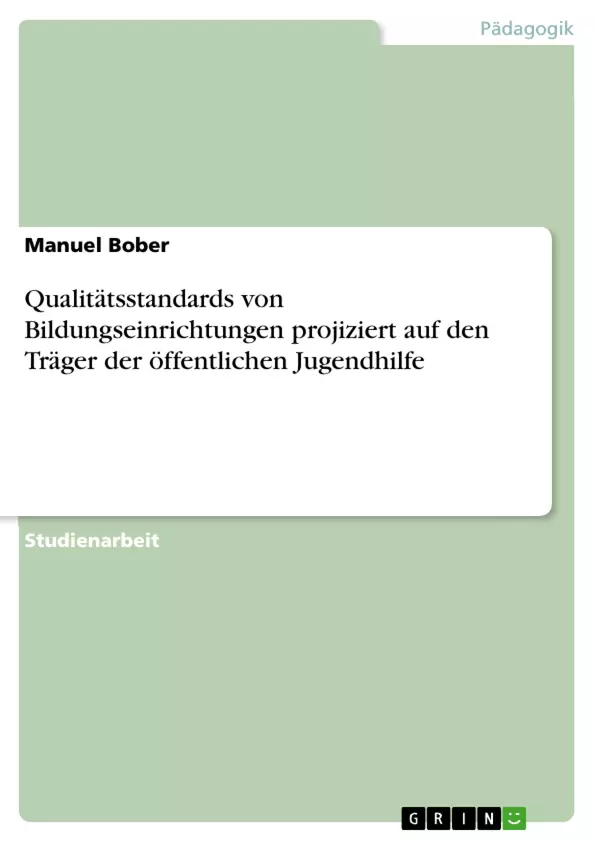In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Fragestellung auseinandersetzen, in welcher Weise die Qualitätsmerkmale des European Foundation for Quality Management Modells (fortan „EFQM-Modell“ abgekürzt) zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Bereich des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Kontext seines gesetzlich verankerten Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII unterstützend eingesetzt werden?
Einen Bezug von Qualitätsmanagementsystemen aus der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf einen öffentlichen Träger der Jugendhilfe ist nur möglich, da Qualitätsmanagementsysteme keine produktorientierte Ausrichtung verfolgen. Sie können daher unabhängig von der Branche und dessen spezifischen Produkten angewandt werden. Die Einführung eines Managementsystems mit dem Fokus der ständigen Leistungsverbesserung unter der Berücksichtigung aller Parteien kann ein Erfolgsfaktor sein. Aus der Vielzahl der nötigen Managementdisziplinen, welche eine Organisation zum Lenken und Leiten benötigt, ergeht auch ein Teilbereich als Qualitätsmanagement.
„Was macht guten Kinderschutz in der Praxis aus?“ In der Vergangenheit rückten das Kindeswohl und der im § 8a des Achten Sozialgesetzbuch (fortan „SGB VIII“ abgekürzt) festgehaltene Schutzauftrag des Jugendamtes zunehmend in den fachlichen, aber auch öffentlich Fokus. Auslöser hierfür waren meist tragisch verlaufene Kinderschutzfälle. Im letzten Jahrzehnt kam es zu diversen Verabschiedungen von Gesetzen, welche das Ziel hatten, den Kinderschutz zu verbessern und beteiligte Akteure in ihren Rechten und Pflichten zu stärken. Maßgebend für die Veränderung der Kinderschutzpraxis war die Einführung des § 8a SGB VIII mit der Konkretisierung des Schutzauftrags des Jugendamtes und der Ausweitung des Schutzauftrags auf die Träger der freien Jugendhilfe. Neben dem § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im SGB VIII wurde auch der § 79a SGB VIII eingeführt und verpflichtete Jugendämter zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Dies umfasst auch den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualitätssicherung und -entwicklung in der Weiterbildung
- DIN EN ISO 9000 ff.
- EFQM-Modell
- Handeln im Kontext Kindeswohlgefährdung
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
- Professionelles Handeln im ASD
- Das EFQM-Modell in der Sozialen Arbeit
- Anwendbarkeit - EFQM
- Kritik an der Methode
- Resümee
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Qualitätsmerkmale des European Foundation for Quality Management Modells (EFQM-Modell) zur Qualitätsentwicklung und -sicherung im Bereich des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Kontext seines gesetzlich verankerten Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII unterstützend eingesetzt werden können.
- Die Relevanz von Qualitätsmanagement in der Jugendhilfe im Kontext des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII
- Die Anwendung des EFQM-Modells auf den Bereich der Jugendhilfe
- Die Stärken und Schwächen des EFQM-Modells im Kontext der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung der Qualitätssicherung und -entwicklung im Bereich der Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Qualitätsstandards von Bildungseinrichtungen im Kontext der öffentlichen Jugendhilfe ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über Qualitätssicherung und -entwicklung in der Weiterbildung, wobei insbesondere das EFQM-Modell im Detail vorgestellt wird.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Handeln im Kontext von Kindeswohlgefährdung, dem Schutzauftrag der Jugendämter und dem professionellen Handeln von Mitarbeitenden im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD).
Kapitel 4 untersucht die mögliche Anwendbarkeit des EFQM-Modells in der Sozialen Arbeit, wobei sowohl die Stärken als auch die Kritikpunkte der Methode beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Qualitätsmanagement, Jugendhilfe, Kindeswohlgefährdung, Schutzauftrag, § 8a SGB VIII, EFQM-Modell, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Sozialer Dienst, Professionelles Handeln
Häufig gestellte Fragen
Was ist das EFQM-Modell?
Das EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management) ist ein Qualitätsmanagementsystem zur ständigen Leistungsverbesserung von Organisationen, das unabhängig von der Branche angewandt werden kann.
Wie unterstützt EFQM den Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII?
Es bietet Strukturen zur Qualitätssicherung und -entwicklung, die dabei helfen, den Prozess der Gefährdungseinschätzung bei Kindeswohlgefährdung professioneller und systematischer zu gestalten.
Warum ist Qualitätsmanagement in der Jugendhilfe heute verpflichtend?
Der Gesetzgeber hat mit § 79a SGB VIII die Jugendämter zur Qualitätsentwicklung verpflichtet, um die Professionalität im Kinderschutz zu sichern und tragische Fälle zu vermeiden.
Was sind die Kritikpunkte am EFQM-Modell in der Sozialen Arbeit?
Kritisiert wird oft die Übertragbarkeit wirtschaftlicher Managementmethoden auf soziale Dienstleistungen, da soziale Arbeit weniger produktorientiert und stärker beziehungsorientiert ist.
Welche Rolle spielt der ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) beim Kinderschutz?
Der ASD ist die zentrale Instanz für die Umsetzung des Schutzauftrags; seine Mitarbeiter müssen Gefährdungseinschätzungen vornehmen und entsprechende Hilfen oder Schutzmaßnahmen einleiten.
- Arbeit zitieren
- Manuel Bober (Autor:in), 2019, Qualitätsstandards von Bildungseinrichtungen projiziert auf den Träger der öffentlichen Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290343