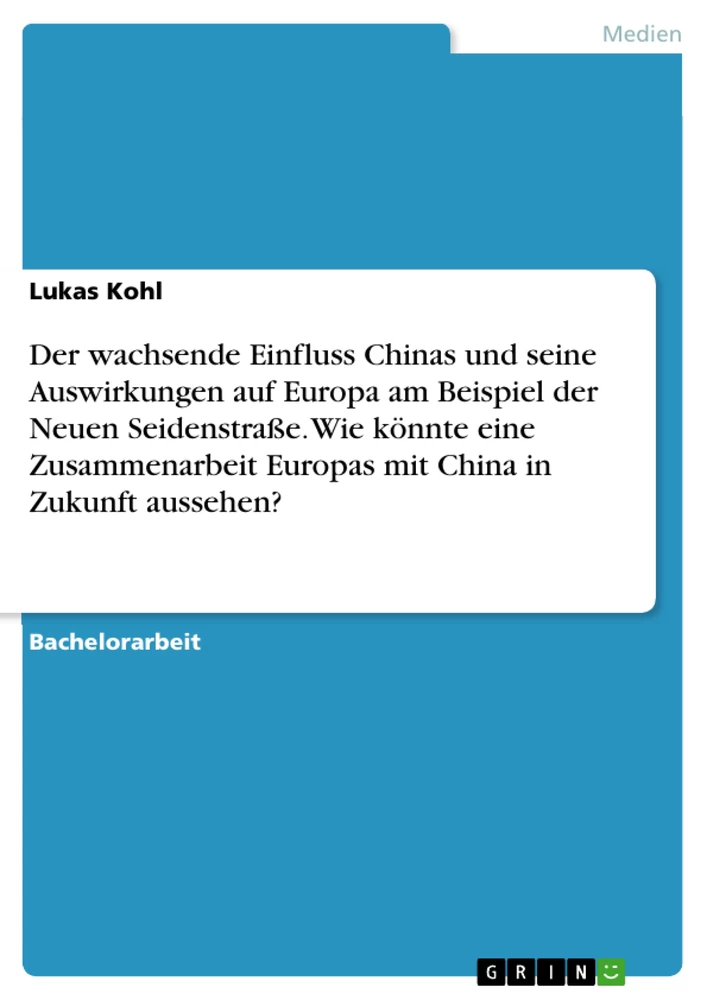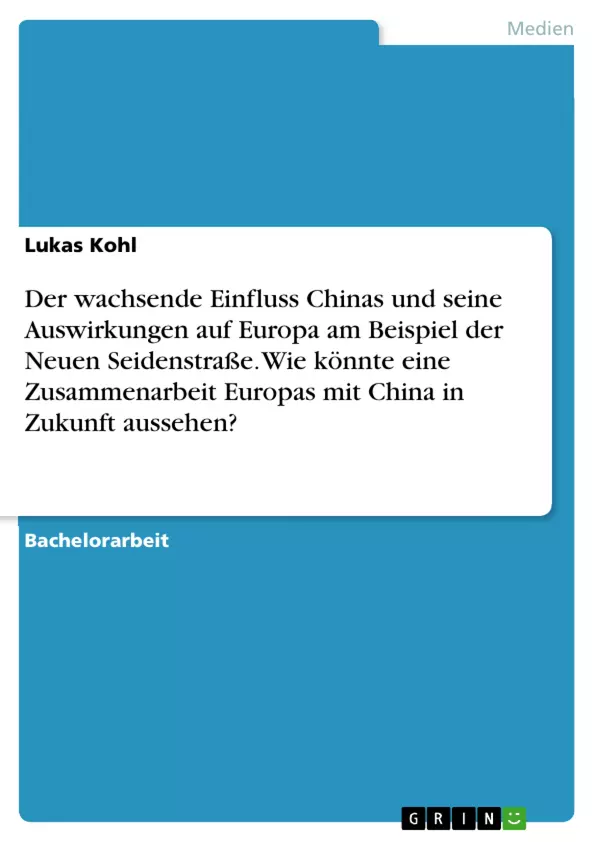Das Ziel dieser Arbeit ist es, den wirtschaftlichen Aufschwung der Volksrepublik China und dessen Bedeutung für die Welt aufzuzeigen. Im Speziellen wird der Einfluss der Initiative Neue Seidenstraße auf Europa untersucht und der Frage nachgegangen, wie in Zukunft eine Zusammenarbeit Europas mit China aussehen könnte.
"If we don’t write the rules, China will write the rules out in [Asia]" (Barack Obama). – Und nicht nur in Asien: Chinas rasantes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten hat seine Rolle in der Welt drastisch verändert. Die Volksrepublik gilt heutzutage als zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt und auch als wichtigster Handelspartner für die EU. Und China hat nicht vor, sich auf diesem Platz auszuruhen: Mithilfe massiver Investitionen im Rahmen der Initiative Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative) strebt das Land die Schaffung eines neuen globalen Handelsnetzes an, das die Machtverhältnisse, wie wir sie kennen, für immer verschieben könnte.
Im ersten Teil der Bachelorarbeit wird Chinas Rolle in der Welt erörtert. Dafür bietet Kapitel 2 einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung Chinas von der Ausrufung der Volksrepublik 1949 bis heute. Der Blick auf die Ursprünge des Wirtschaftsmodells des Landes, auf die wichtigsten Reformen, die es geprägt haben, sowie auf die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 2008 soll dem Leser ein tieferes Verständnis von Chinas aktuellem Wirtschaftssystem ermöglichen. Im dritten Kapitel wird zudem Chinas Rolle als größter Gläubiger der Welt erörtert.
Kapitel 4 gibt durch einen Vergleich an Ideologien und Zielen eine Einleitung in das Thema der chinesisch-europäischen Beziehungen. Das fünfte Kapitel stellt Chinas Projekt der Neuen Seidenstraße vor, die als maßgebliche Strategie von Chinas internationaler Wirtschaftspolitik der nächsten Jahre gilt. Im sechsten Kapitel wird dann die Neue Seidenstraße in Europa genauer betrachtet, u. a. wird dabei auf Duisburg und Piräus eingegangen. Vor dem Fazit wird die Initiative der Neuen Seidenstraße im siebten Kapitel dann noch aus verschiedenen Blickwinkeln bewertet und mögliche Vorgehensweisen der EU aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Aufbau der Arbeit
- Chinas Wirtschaft von 1949 bis heute
- Von der Gründung der Volksrepublik 1949 bis 2008
- Die Ära Mao Zedong 1949–1978
- Reform und Öffnung des Landes 1978–1997
- Fortschreitende Öffnung 1997–2008
- Chinas Wirtschaft nach der globalen Krise 2008
- Die Nachwirkungen der Finanzkrise
- Kreditboom und Verschuldung
- Das System der Schattenbanken
- Von der Gründung der Volksrepublik 1949 bis 2008
- Chinas Rolle in der Globalisierung
- Chinas Rolle im Finanzhandel
- Empfangsländer
- Verträge und Klauseln
- Wirtschaftliche Abhängigkeiten von China
- Natürliche Ressourcen
- China und Deutschland
- Auswirkungen der Coronapandemie
- Einflussnahme Chinas
- Chinas Rolle im Finanzhandel
- Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ideologien und Ziele
- Europäische Union
- China
- Vergleich
- Die Initiative der Neuen Seidenstraße
- Das Vorbild: die antike Seidenstraße
- Beschreibung der Initiative
- Umfang und Eckdaten
- Ziele des Projektes
- Die Neue Seidenstraße in Europa
- Interesse an Europa
- Europäische Kooperationspartner
- Landrouten nach Europa
- Einführung Silk Road Economic Belt
- Projekte in Europa
- Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs
- Zugstrecke nach Duisburg
- Maritime Routen nach Europa
- Häfen in Europa
- Investitionen in Griechenland am Beispiel von Piräus
- Einordnung des Projekts
- Meinungen zum Projekt
- Hoffnungen an das Projekt
- Kritik und Sorgen
- Bedeutung für Europa
- Die chinesisch-europäische Zusammenarbeit in der Zukunft
- Einblick in das europäische Gegenprojekt
- Meinungen zum Projekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den wachsenden Einfluss Chinas auf Europa und untersucht die Auswirkungen der Neuen Seidenstraße. Im Fokus steht die Frage, wie sich die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen China und Europa im Kontext der Initiative gestaltet und welche Folgen sie für beide Seiten hat.
- Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas von 1949 bis heute
- Die Rolle Chinas in der Globalisierung und die daraus resultierenden Abhängigkeiten
- Das Aufeinandertreffen von europäischen und chinesischen Zielen und Ideologien
- Die Initiative der Neuen Seidenstraße als strategisches Projekt Chinas
- Die Auswirkungen der Neuen Seidenstraße auf Europa und die Folgen für die europäische Zusammenarbeit mit China
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und legt die Zielsetzung, Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung Chinas von der Gründung der Volksrepublik bis heute, inklusive der wichtigsten Meilensteine und Herausforderungen. Im dritten Kapitel wird die Rolle Chinas in der Globalisierung untersucht, wobei die Bedeutung des Landes im Finanzhandel und die Abhängigkeiten von China im Fokus stehen. Das vierte Kapitel analysiert das Aufeinandertreffen von europäischen und chinesischen Ideologien und Zielen im Kontext der Globalisierung. Kapitel fünf befasst sich mit der Initiative der Neuen Seidenstraße und beschreibt deren Zielsetzungen und Inhalte. Das sechste Kapitel widmet sich der Umsetzung der Neuen Seidenstraße in Europa, inklusive der Land- und Seestrategien, der Projekte und der Herausforderungen. Kapitel sieben ordnet das Projekt der Neuen Seidenstraße in einen größeren Kontext ein und betrachtet die Meinungen und Sorgen, die mit dem Projekt verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Chinas wirtschaftlicher Aufstieg, Globalisierung, Neue Seidenstraße, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit, Abhängigkeiten, Einflussnahme, europäische Interessen, Infrastrukturprojekte und geopolitische Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen zur Neuen Seidenstraße
Was verbirgt sich hinter der Initiative "Neue Seidenstraße"?
Die "Belt and Road Initiative" (BRI) ist ein massives Infrastrukturprojekt Chinas, das durch Land- und Seerouten ein neues globales Handelsnetzwerk zwischen Asien, Europa und Afrika schaffen soll.
Welche Interessen verfolgt China mit diesem Projekt?
Neben wirtschaftlichem Wachstum geht es um geostrategischen Einfluss, die Sicherung von Rohstoffen und die Schaffung neuer Absatzmärkte für chinesische Unternehmen.
Welche Auswirkungen hat die Neue Seidenstraße auf europäische Häfen?
China investiert massiv in strategische Knotenpunkte wie den Hafen von Piräus in Griechenland oder Logistikzentren in Duisburg, um den Warenfluss nach Europa zu kontrollieren.
Warum wird das Projekt von der EU kritisch gesehen?
Kritiker befürchten eine politische Abhängigkeit durch Schuldenfallen, den Verlust europäischer Standards und eine Verschiebung der globalen Machtverhältnisse zugunsten Chinas.
Wie hat sich Chinas Wirtschaft seit 1949 entwickelt?
Von der Planwirtschaft unter Mao Zedong über die Reform- und Öffnungspolitik ab 1978 hat sich China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und zum "Exportweltmeister" entwickelt.
- Quote paper
- Lukas Kohl (Author), 2022, Der wachsende Einfluss Chinas und seine Auswirkungen auf Europa am Beispiel der Neuen Seidenstraße. Wie könnte eine Zusammenarbeit Europas mit China in Zukunft aussehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290844