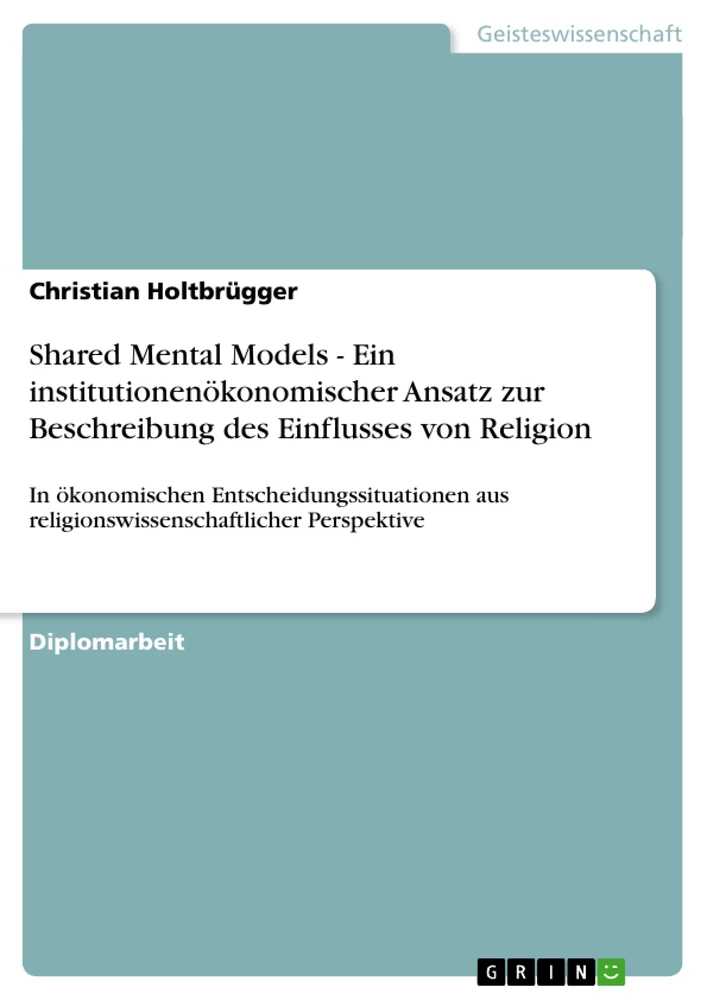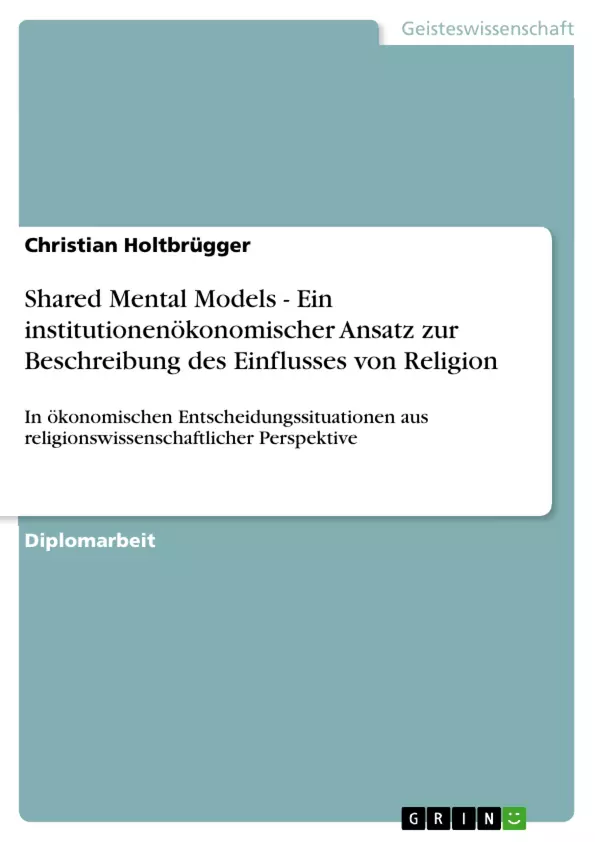Die Bedeutung von Religion als grundlegendes Muster menschlichen Handelns wird seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt wahrgenommen, sowohl von der Geschichtswissenschaft als auch von den ökonomischen Disziplinen.
Seit den 1990er Jahren entwickelt sich die Religionsökonomie als Unterdisziplin der Religionswissenschaft. Neben Finanzierungsfragen von Religion und der Beschreibung von Religion mittels ökonomischer Modelle behandelt sie die Frage, in wie weit religiöses Handeln und Verhalten von Einzelnen und Gemeinschaften wirtschaftlich relevant ist.
Auch in den ökonomischen Disziplinen hat man begonnen, sich mit Kultur und damit auch mit Religion als einem Teil von Kultur auseinander zu setzen. Einflüsse von Kultur auf ökonomisches Handeln werden erforscht und die gewonnen Erkenntnisse umgesetzt.
Das Bild des Menschen, das vom Paradigma der rationalen Wahl propagiert wird, ist der nach Nutzenmaximierung strebende, perfekt informierte Homo-Oeconomicus, mit dem bisher ökonomisches Verhalten erklärt wurde. In diesem Modell kommt Religion aber nicht vor. Die Institutionenökonomik als ein Teilbereich der Ökonomik hat in jüngerer Zeit mit dem sich von der Rational-Choice-Theorie absetzenden Konzept der überindividuell geteilten mentalen Modelle einen Ansatz hervorgebracht, mit dem die Beschreibung von Einflüssen religiöser Vorstellungen auf das Verhalten in ökonomischen Entscheidungssituationen möglich ist. Ihn zeichnet aus, dass er sich in Unsicherheit befindet, also nicht alle Handlungsalternativen und daraus resultierenden Konsequenzen kennt und daher nur begrenzt rational handeln kann.
Zunächst werden in Kapitel2 Begriffsbestimmungen vorgenommen. In Kapitel3 soll zunächst die Rational-Choice-Theorie dargestellt werden. Sie ist das Modell, mit dem wirtschaftliches Verhalten bislang beschrieben wurde. Es schließt sich die Untersuchung an, ob Religion in der Rational-Choice-Theorie Platz findet. Kapitel4 stellt das Konzept der mentalen Modelle dar, welches kulturelle Faktoren in die Beschreibung von wirtschaftlichen Zusammenhängen einführt. In Kapitel5 wird die Übertragung des Konzepts der mentalen Modelle auf den Bereich Religion unternommen. Anschließend findet in Kapitel6 eine Diskussion der beiden Ansätze auf ihre Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Darstellung von Religion in wirtschaftlichen Situationen statt. Kapitel7 schließt mit einer Annäherung an die Realität und einer Schlussbetrachtung die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2 Begriffsbestimmungen
- 2.1 Handeln
- 2.2 Wirtschaftliches Handeln
- 2.3 Religion
- 2.4 Modell
- 3 Darstellung der Rational-Choice-Theorie
- 3.1 Historische Entwicklung des Homo-Oeconomicus-Modells
- 3.2 Darstellung der Rational-Choice-Theorie
- 3.2.1 Der Homo-Oeconomicus als Menschenbild der Rational-Choice-Theorie
- 3.2.2 Sechs Grundannahmen des Modells
- 3.2.3 Der Homo-Oeconomicus in Entscheidungssituationen
- 3.2.4 Koordination und Interdependenz des Homo-Oeconomicus
- 3.3 Kritische Würdigung der Rational-Choice-Theorie
- 3.3.1 Die axiomatische Dimension des Modells
- 3.3.2 Die phänomenologische Dimension
- 3.3.3 Die ethisch-politische Dimension
- 3.4 Die Rational-Choice-Theorie und Religion
- 3.4.1 Vom Haushaltsmodell zum Markt der Religionen
- 3.4.2 Religion als Präferenz im Ökonomischen Modell
- 3.5 Fazit
- 4 Darstellung des Konzepts der Shared Mental Models
- 4.1 Forschungsprogramm der Institutionenökonomik
- 4.2 Kritik an der Rational-Choice-Theorie durch die Institutionenökonomik
- 4.3 Modellierung von Entscheidungssituationen in der Institutionenökonomik
- 4.4 Verhaltenswirkung mentaler Modelle
- 4.4.1 Der deskriptive Charakter von mentalen Modellen
- 4.4.2 Der präskriptive Charakter von mentalen Modellen
- 4.4.3 Lernen: Über die Entstehung mentaler Modelle
- 4.4.4 Direktes Lernen aus eigener Erfahrung
- 4.4.5 Indirektes Lernen durch Kommunikation
- 4.5 Kommunikation und Kultur
- 4.6 Ideologien
- 4.7 Institutionen
- 4.8 Organisationen
- 4.9 Fazit
- 5 Das Konzept der Shared Mental Models und Religion
- 5.1 Übertragung des Modells auf den Bereich Religion
- 5.2 Wirkung von Religion auf wirtschaftliches Verhalten
- 5.2.1 Funktionale Wirkung von Religion
- 5.2.2 Dysfunktionale Wirkung von Religion
- 5.3 Fazit
- 6 Diskussion des Konzepts der Shared Mental Models
- 6.1 Historisch-Kritische / Hermeneutische Diskussion
- 6.2 Diskussion des Konzepts der mentalen Modelle
- 6.2.1 Menschenbild
- 6.2.2 Religion
- 6.2.3 Interaktion und Koordination
- 6.2.4 Restriktionen versus Präferenzen
- 6.2.5 Transaktion
- 6.3 Fazit
- 6.4 Zur Anwendung des Konzepts der mentalen Modelle in der Religionswissenschaft
- 6.4.1 Aussagekraft von Modellen
- 6.4.2 Religionswissenschaft und mentale Modelle
- 6.4.3 Religionswissenschaft und Rational-Choice
- 7 Ausblick und Schlussbetrachtung
- 7.1 Ausblick: Annäherungen an die Wirklichkeit
- 7.2 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Religion auf ökonomische Entscheidungssituationen. Sie zielt darauf ab, geeignete Modelle zur Beschreibung dieser Einflüsse zu finden und zu bewerten. Die Rational-Choice-Theorie und das Konzept der Shared Mental Models werden dabei im Detail betrachtet und verglichen.
- Der Einfluss von Religion auf wirtschaftliches Handeln
- Bewertung der Rational-Choice-Theorie im Hinblick auf die Einbeziehung religiöser Faktoren
- Das Konzept der Shared Mental Models als alternatives Modell
- Anwendung des Konzepts der Shared Mental Models in der Religionswissenschaft
- Die Rolle kultureller Faktoren in ökonomischen Entscheidungsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den wachsenden Fokus auf den Einfluss von Religion auf menschliches Handeln, insbesondere in der Wirtschaftswissenschaft. Sie hebt die Entstehung der Religionsökonomie hervor und stellt die Forschungslücke heraus, die diese Arbeit zu schließen versucht: die Anwendung des Konzepts der Shared Mental Models auf den Bereich der Religion und ökonomischer Entscheidungen.
2 Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen zentraler Begriffe wie Handeln, wirtschaftliches Handeln, Religion und Modell. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die spätere Analyse und den Vergleich der verschiedenen theoretischen Ansätze.
3 Darstellung der Rational-Choice-Theorie: Dieses Kapitel präsentiert die Rational-Choice-Theorie, einschließlich ihrer historischen Entwicklung, Grundannahmen und Kritikpunkte. Es wird der Homo Oeconomicus als Modell des nutzenmaximierenden Individuums vorgestellt und die Grenzen dieses Modells hinsichtlich der Berücksichtigung religiöser Einflüsse aufgezeigt. Die kritische Würdigung betrachtet die axiomatische, phänomenologische und ethisch-politische Dimension des Modells.
4 Darstellung des Konzepts der Shared Mental Models: Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Shared Mental Models, das im Gegensatz zur Rational-Choice-Theorie Unsicherheit und begrenzte Rationalität berücksichtigt. Es wird detailliert beschrieben, wie mentale Modelle Entscheidungen beeinflussen, wie sie entstehen (durch direktes und indirektes Lernen) und wie sie durch Kommunikation und Kultur geprägt sind. Die Rolle von Ideologien, Institutionen und Organisationen wird im Kontext der Shared Mental Models ebenfalls diskutiert.
5 Das Konzept der Shared Mental Models und Religion: Dieses Kapitel wendet das Konzept der Shared Mental Models auf den Bereich der Religion an. Es untersucht, wie religiöse Überzeugungen das wirtschaftliche Verhalten beeinflussen können, sowohl funktional als auch dysfunktional. Dieser Abschnitt legt die Brücke zwischen den theoretischen Modellen und ihrer Anwendung auf die empirische Realität.
6 Diskussion des Konzepts der Shared Mental Models: Dieses Kapitel vergleicht die Rational-Choice-Theorie und das Konzept der Shared Mental Models hinsichtlich ihrer Eignung zur Beschreibung des Einflusses von Religion auf wirtschaftliches Handeln. Es analysiert die jeweiligen Menschenbilder, die Rolle der Religion und die Möglichkeiten der Modellierung von Interaktion und Koordination. Die Anwendung der Modelle in der Religionswissenschaft wird ebenfalls kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Religion, ökonomisches Handeln, Rational-Choice-Theorie, Shared Mental Models, Institutionenökonomik, Modell, Menschenbild, Kultur, Entscheidungssituationen, Interaktion, Koordination.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Einfluss von Religion auf ökonomische Entscheidungssituationen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Religion auf ökonomische Entscheidungssituationen. Sie analysiert und vergleicht zwei Modelle – die Rational-Choice-Theorie und das Konzept der Shared Mental Models – um diesen Einfluss zu beschreiben und zu bewerten.
Welche Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Rational-Choice-Theorie mit dem Konzept der Shared Mental Models. Die Rational-Choice-Theorie basiert auf dem Modell des Homo Oeconomicus, der rational und nutzenmaximierend handelt. Im Gegensatz dazu berücksichtigt das Konzept der Shared Mental Models Unsicherheit und begrenzte Rationalität, indem es die Rolle von geteilten mentalen Modellen in Entscheidungsprozessen betont.
Was sind Shared Mental Models?
Shared Mental Models sind geteilte mentale Repräsentationen der Wirklichkeit. Sie beeinflussen Entscheidungen, entstehen durch Lernen (direktes und indirektes), und werden durch Kommunikation und Kultur geprägt. Die Arbeit untersucht ihre Rolle in Bezug auf Ideologien, Institutionen und Organisationen.
Wie wird die Rational-Choice-Theorie bewertet?
Die Arbeit bietet eine kritische Würdigung der Rational-Choice-Theorie, indem sie deren axiomatische, phänomenologische und ethisch-politische Dimensionen beleuchtet. Sie untersucht die Grenzen des Modells, insbesondere die unzureichende Berücksichtigung religiöser Einflüsse auf wirtschaftliches Handeln.
Wie wird der Einfluss von Religion auf wirtschaftliches Handeln untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Religion auf wirtschaftliches Handeln, indem sie sowohl funktionale als auch dysfunktionale Wirkungen religiöser Überzeugungen analysiert. Sie beleuchtet, wie religiöse Präferenzen im ökonomischen Modell berücksichtigt werden können und wie mentale Modelle religiöse Überzeugungen in ökonomisches Verhalten übersetzen.
Welche Rolle spielt die Religionswissenschaft in dieser Arbeit?
Die Arbeit diskutiert die Anwendung des Konzepts der Shared Mental Models in der Religionswissenschaft. Sie untersucht die Aussagekraft der Modelle und bewertet deren Eignung zur Beschreibung von religiösen Phänomenen im Kontext ökonomischer Entscheidungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen, Darstellung der Rational-Choice-Theorie, Darstellung des Konzepts der Shared Mental Models, Das Konzept der Shared Mental Models und Religion, Diskussion des Konzepts der Shared Mental Models, Ausblick und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Religion, ökonomisches Handeln, Rational-Choice-Theorie, Shared Mental Models, Institutionenökonomik, Modell, Menschenbild, Kultur, Entscheidungssituationen, Interaktion, Koordination.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete Modelle zur Beschreibung des Einflusses von Religion auf ökonomische Entscheidungssituationen zu finden und zu bewerten. Sie untersucht, ob und wie die Rational-Choice-Theorie und das Konzept der Shared Mental Models dazu beitragen können, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen.
- Quote paper
- Christian Holtbrügger (Author), 2008, Shared Mental Models - Ein institutionenökonomischer Ansatz zur Beschreibung des Einflusses von Religion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129145