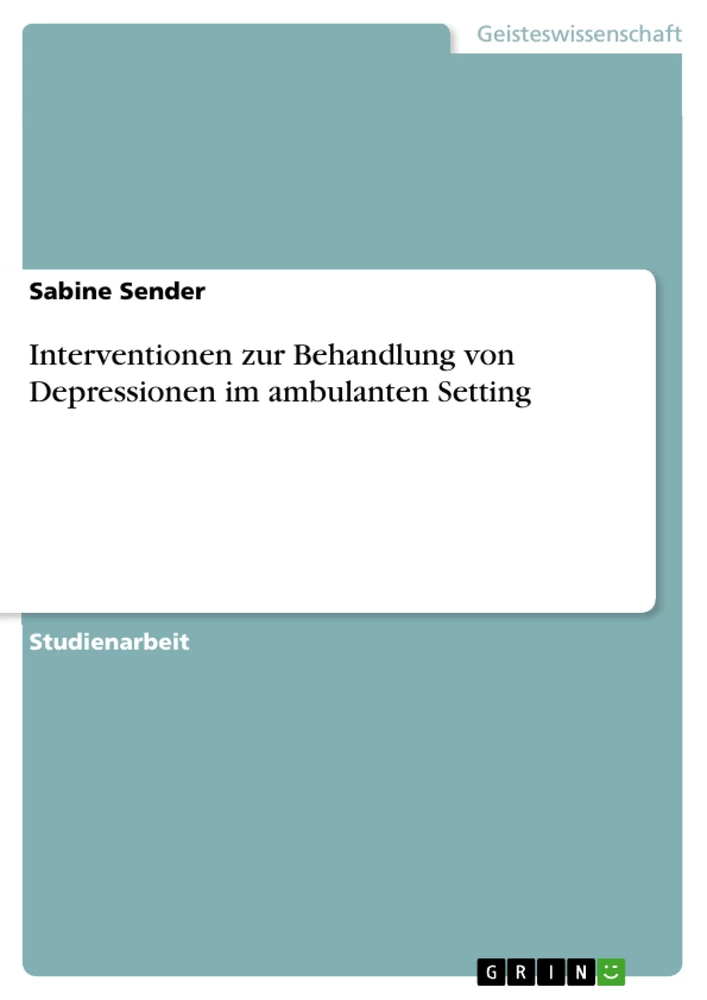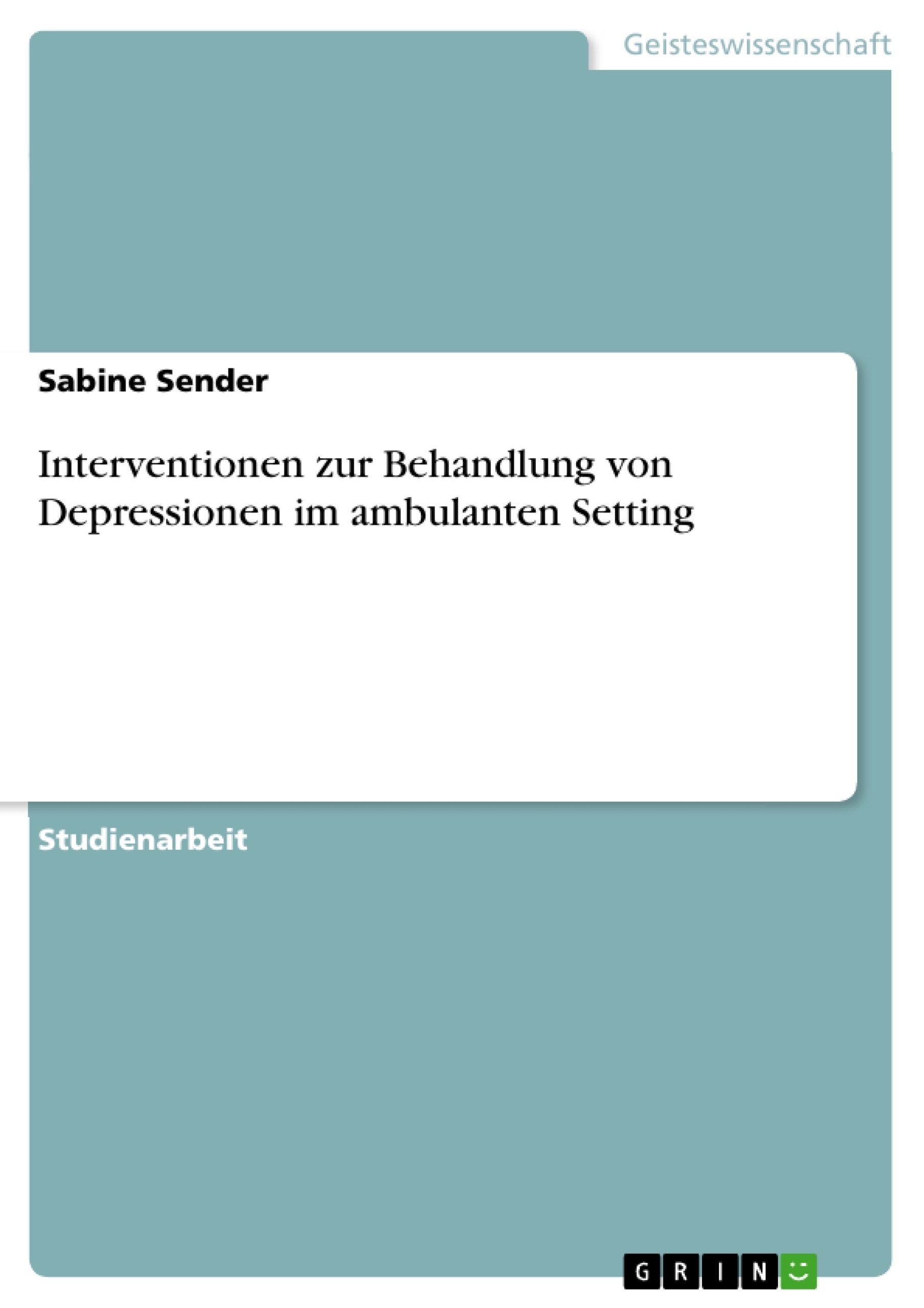Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es zur Behandlung von Depressionen im ambulanten Setting?
Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden allgemein bekannte Interventionsmöglichkeiten betrachtet, aber auch Interventionen, die neu erprobt wurden und eine gute Wirksamkeit belegen. Da die ambulanten und stationären Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen in der Literatur nicht immer eindeutig beschrieben werden, werden in dieser Hausarbeit immer auch ein Bezug zum stationären Setting hergestellt und daraus ambulante Möglichkeiten abgeleitet.
Zu Beginn der Hausarbeit wird in Kapitel 2 das Krankheitsbild der Depression vorgestellt unter Einbezug der affektiven Störungen nach dem International Classification of Deseases (ICD). Im sich anschließenden Unterkapitel 2.1 werden die Epidemiologie und der Verlauf der Depressionen vorgestellt. Die Ätiologie schließt sich diesem Kapitel an. Kapitel 2.3 bildet die unterschiedliche Symptomatik des Krankheitsbildes ab, woraus sich in der Summation, die Schweregrade und Behandlungsmöglichkeiten ableiten lassen können. Das dritte Kapitel widmet sich den Interventionsansätzen bei Depressionen, speziell auf den ambulanten Bereich bezogen. Dabei werden auch Zahlen betrachtet, die die aktuelle Versorgungsproblematik in der Psychotherapie abbilden. Kapitel 3.1 stellt die medikamentöse Therapie vor. Das darauffolgende Kapitel eröffnet den Lesern einen Einblick in die Sporttherapie, welche alternativ oder begleitend erfolgen kann. Das Kapitel 3.3 stellt die Möglichkeit der Psychotherapie dar. Den Abschluss des Kapitels bildet das Kapitel 3.4, indem Internetbasierte Selbsthilfeprogramme vorgestellt werden Um eine einheitliche Begriffsdefinition zu verwenden und den Lesefluss zu erleichtern, wird der Begriff „Betroffene“ stellvertretend für alle Patienten und Menschen mit Depressionen verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Depressionen
- 2.1 Epidemiologie und Verlauf
- 2.2 Ätiologie
- 2.3 Symptomatik
- 3. Interventionsansätze bei Depressionen
- 3.1 Medikamentöse Therapie
- 3.2 Sporttherapie - adjuvant oder alternativ
- 3.3 Psychotherapie
- 3.4 Internet-basierte Selbsthilfeprogramme
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen im ambulanten Setting. Sie zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Interventionsansätze zu vermitteln und die Frage zu beantworten, welche Möglichkeiten es zur Behandlung von Depressionen in einer ambulanten Umgebung gibt.
- Das Krankheitsbild der Depression und dessen Einteilung nach dem ICD-10
- Epidemiologie und Verlauf von Depressionen, einschließlich der Prävalenz
- Ätiologie der Depressionen, einschließlich der verschiedenen Faktoren, die zur Entstehung beitragen können
- Die Symptomatik von Depressionen und die daraus resultierenden Schweregrade
- Verschiedene Interventionsansätze zur Behandlung von Depressionen im ambulanten Setting
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die Depression als psychische Erkrankung vor und beleuchtet ihre Einteilung im ICD-10. Es werden die Epidemiologie und der Verlauf der Depressionen erläutert, einschließlich der Prävalenz und der Entwicklung der Erkrankung. Die Ätiologie wird im Detail betrachtet, um die verschiedenen Faktoren zu beleuchten, die zur Entstehung der Depression beitragen. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung der Symptomatik von Depressionen, wodurch sich die Schweregrade und Behandlungsmöglichkeiten ableiten lassen.
Kapitel 3 widmet sich den Interventionsansätzen bei Depressionen im ambulanten Setting. Es werden verschiedene Behandlungsoptionen wie die medikamentöse Therapie, die Sporttherapie, die Psychotherapie und internetbasierte Selbsthilfeprogramme vorgestellt. Die Diskussion umfasst auch die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Versorgungsprogblematik in der Psychotherapie.
Schlüsselwörter
Depressionen, ICD-10, Epidemiologie, Prävalenz, Ätiologie, Symptomatik, Interventionsansätze, medikamentöse Therapie, Sporttherapie, Psychotherapie, internetbasierte Selbsthilfeprogramme, ambulantes Setting.
Häufig gestellte Fragen
Welche ambulanten Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Depressionen?
Zu den Möglichkeiten zählen Psychotherapie, medikamentöse Behandlung, Sporttherapie sowie internetbasierte Selbsthilfeprogramme.
Was ist der ICD-10 im Zusammenhang mit Depressionen?
Der ICD-10 ist ein internationales Klassifikationssystem, das Depressionen als affektive Störungen einordnet und nach Schweregraden (leicht, mittel, schwer) unterteilt.
Wie hilft Sporttherapie bei Depressionen?
Sport kann adjuvant (begleitend) oder alternativ wirken, da körperliche Aktivität die Stimmung verbessert, Stress abbaut und das Selbstwertgefühl steigert.
Was sind internetbasierte Selbsthilfeprogramme?
Dies sind digitale Angebote, die Betroffenen helfen, Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu überbrücken oder begleitend zur Therapie Strategien zur Krankheitsbewältigung zu erlernen.
Was bedeutet Ätiologie bei Depressionen?
Ätiologie bezeichnet die Ursachenforschung. Bei Depressionen spielen meist biologische, psychologische und soziale Faktoren zusammen.
- Quote paper
- Sabine Sender (Author), 2022, Interventionen zur Behandlung von Depressionen im ambulanten Setting, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291745