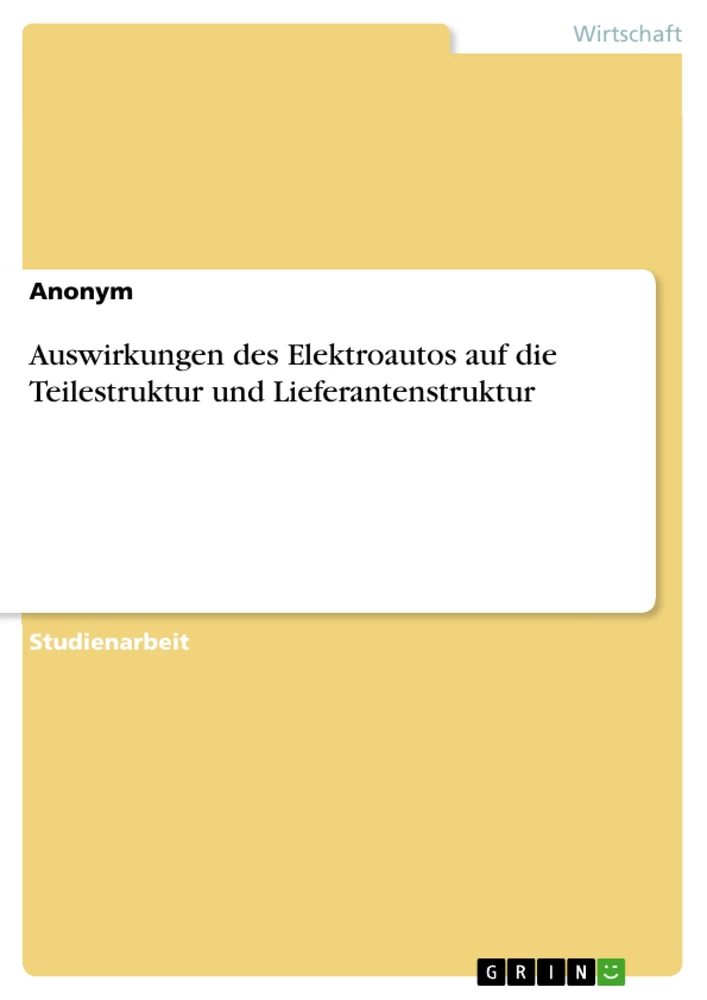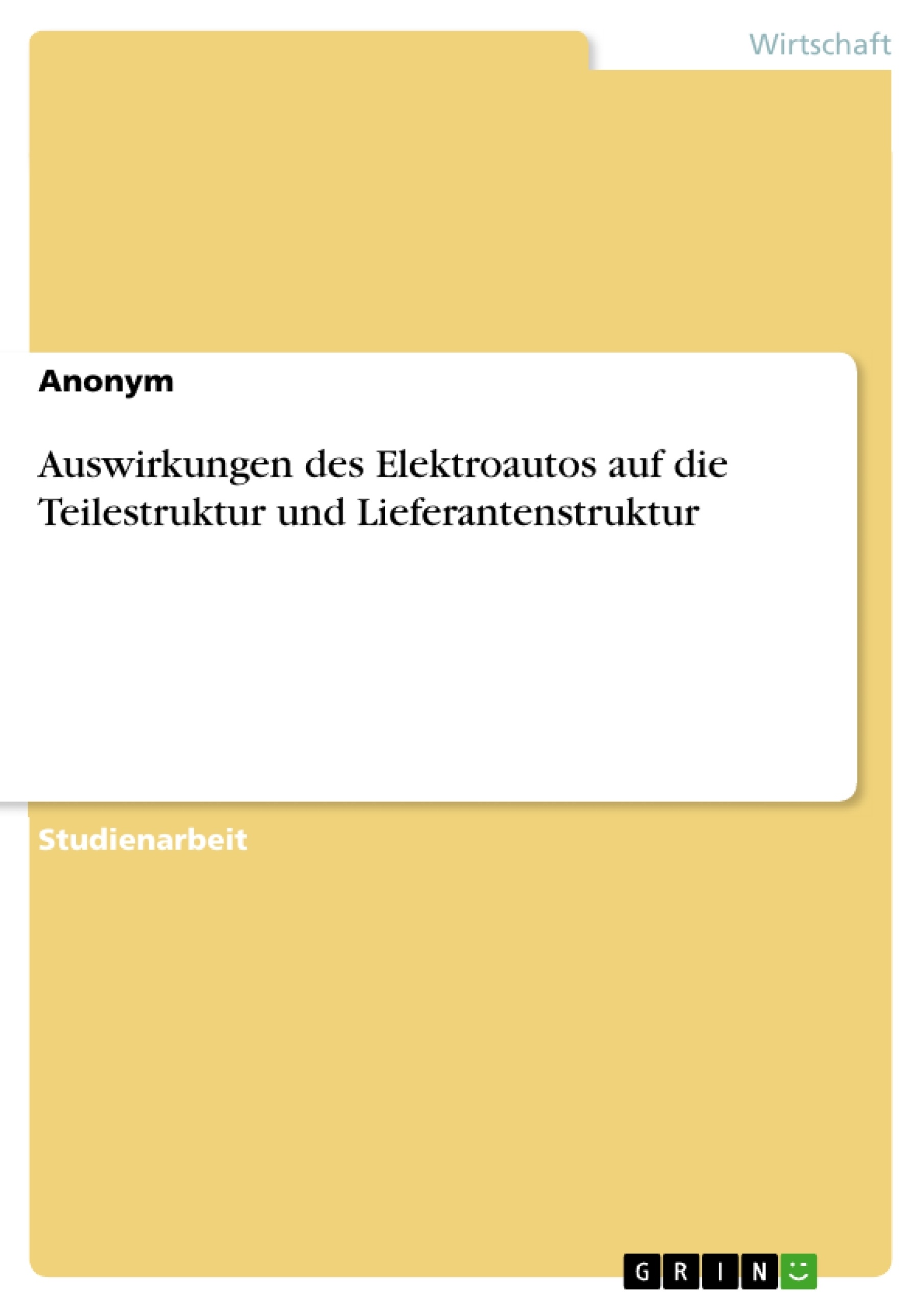Welche Veränderungen ergeben sich bei Teile- und Lieferantenstrukturen im Automotive Cluster durch die erhöhte Produktion von elektrisch betriebenen Autos und welche Konsequenzen resultieren daraus für die komplette Wertschöpfungskette?
Das Ziel der Arbeit ist es, einen Einblick in die einzelnen Bestandteile des Wandels der Automobilindustrie zu gewinnen. Dafür wird der Nutzen bestehender Lieferketten und Teilestrukturen unter dem Hinblick der (auch gesetzlich bedingten) Veränderungen durch die Elektrifizierung des Antriebsstranges analysiert. Zudem werden hieraus resultierende prozessbedingte Effekte, wie z.B. die Beschäftigungsentwicklung oder die Veränderung der Kostenstrukturen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Hinführung und theoretische Grundlagen zur Umstrukturierung von Verbrennungsmotoren zu elektrischen Antriebssträngen
- Aktuelle Wertschöpfungskette bei der Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren
- Theoretische Grundlagen zur Produktion von Autos mit elektrischen Antriebssträngen
- Wandel zur Elektromobilität
- Praxisbezogene Analyse der Auswirkungen bei einem Produktionsanstieg von Elektroautos
- Folgen für die Lieferantenstruktur unter dem Hinblick des gesamten Automotive Clusters
- Folgen für die Teilestruktur anhand eines praktischen Vergleichs
- Auswirkungen auf die Kostenstrukturen eines Automobils
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Veränderungen in der Automobilindustrie, die durch die zunehmende Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen entstehen. Sie analysiert die bestehenden Lieferketten und Teilestrukturen im Hinblick auf die notwendigen Anpassungen durch die Elektrifizierung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Beschäftigungsentwicklung und die Kostenstrukturen. Die zentrale Forschungsfrage ist, welche Veränderungen bei Teilen und Lieferantenstrukturen im Automotive Cluster durch die erhöhte Produktion von elektrisch betriebenen Autos entstehen und welche Konsequenzen sich daraus für die gesamte Wertschöpfungskette ergeben.
- Analyse der Auswirkungen der Elektrifizierung des Antriebsstrangs auf die Automobilindustrie
- Bewertung der bestehenden Lieferketten und Teilestrukturen im Hinblick auf die Elektrifizierung
- Untersuchung der prozessbedingten Effekte, wie z.B. Beschäftigungsentwicklung und Veränderung der Kostenstrukturen
- Beurteilung der Chancen und Risiken der Elektromobilität für den Automotive Cluster
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Automobilindustrie im Kontext der Elektrifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz der Elektromobilität im Kontext des Klimaschutzes und die damit verbundenen Herausforderungen für die Automobilindustrie. Sie stellt die Problemstellung dar und definiert die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel 2 beleuchtet die aktuellen Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie, die mit Verbrennungsmotoren arbeiten. Es werden die theoretischen Grundlagen der Produktion von Autos mit elektrischen Antriebssträngen erläutert und die Herausforderungen und Chancen des Wandels zur Elektromobilität diskutiert.
Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen eines Produktionsanstiegs von Elektroautos auf die Lieferantenstruktur und die Teilestruktur im Automotive Cluster. Es werden die Veränderungen der Kostenstrukturen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren untersucht.
Schlüsselwörter
Elektromobilität, Automotive Cluster, Lieferantenstruktur, Teilestruktur, Wertschöpfungskette, Kostenstrukturen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Elektrifizierung, Antriebsstrang, Hybridfahrzeug, Plug-in-Hybridfahrzeug, Elektroauto, OEM-Endhersteller, Modul Sourcing, Komponenten, Einzelteile, Beschäftigungsentwicklung, Dekarbonisierung, CO2-Emissionen
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert das Elektroauto die Lieferantenstruktur?
Durch den Wegfall komplexer Verbrennungsmotoren und Getriebe verschiebt sich die Wertschöpfung hin zu Batterieherstellern und Elektroniklieferanten, was traditionelle Lieferanten unter Druck setzt.
Was sind die Folgen für die Teilestruktur im Auto?
Ein Elektroauto benötigt deutlich weniger bewegliche Teile als ein Verbrenner. Dies führt zu einer Vereinfachung der Teilestruktur, erfordert aber neue Komponenten wie Leistungselektronik und Batteriemodule.
Welche Auswirkungen hat die Elektromobilität auf die Kosten?
Die Kostenstruktur verschiebt sich massiv: Während der Antriebsstrang einfacher wird, machen die Batteriekosten derzeit einen sehr großen Teil der Gesamtkosten eines Elektrofahrzeugs aus.
Was bedeutet der Wandel für die Beschäftigung in der Automobilindustrie?
Da die Produktion von Elektromotoren weniger arbeitsintensiv ist als die von Verbrennungsmotoren, wird mit einem Rückgang der Beschäftigung in traditionellen Bereichen und einem Bedarf an neuen Qualifikationen gerechnet.
Warum ist die Dekarbonisierung ein Treiber für diesen Wandel?
Gesetzliche Vorgaben zur Reduzierung von CO2-Emissionen zwingen die Hersteller (OEMs), ihre Flotten auf elektrische Antriebe umzustellen, um Strafzahlungen zu vermeiden und Klimaziele zu erreichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Auswirkungen des Elektroautos auf die Teilestruktur und Lieferantenstruktur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291830