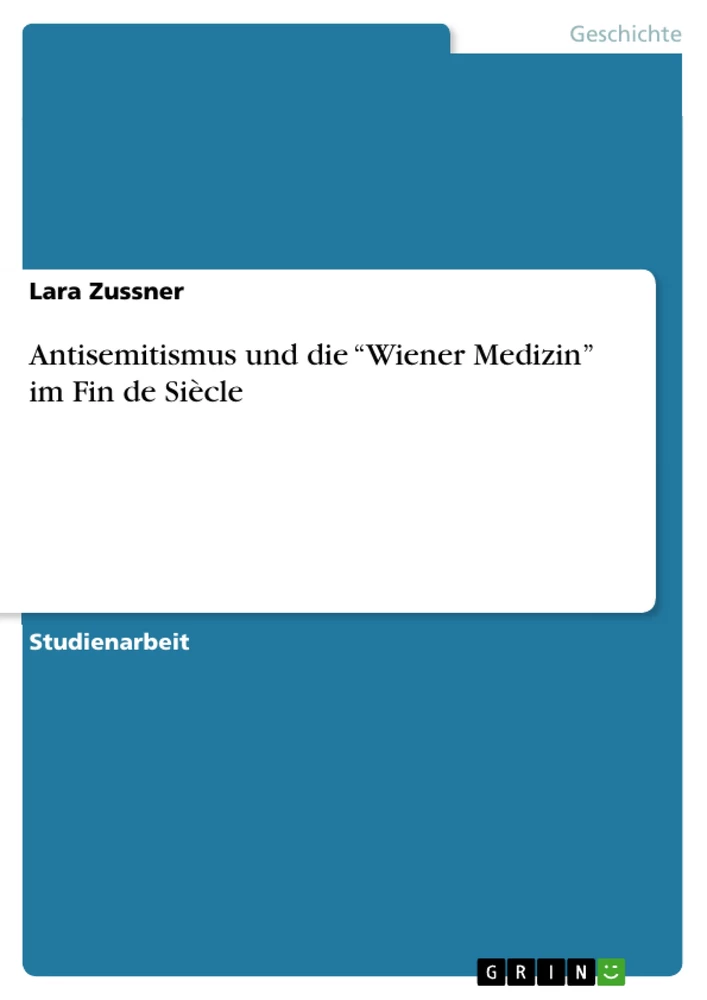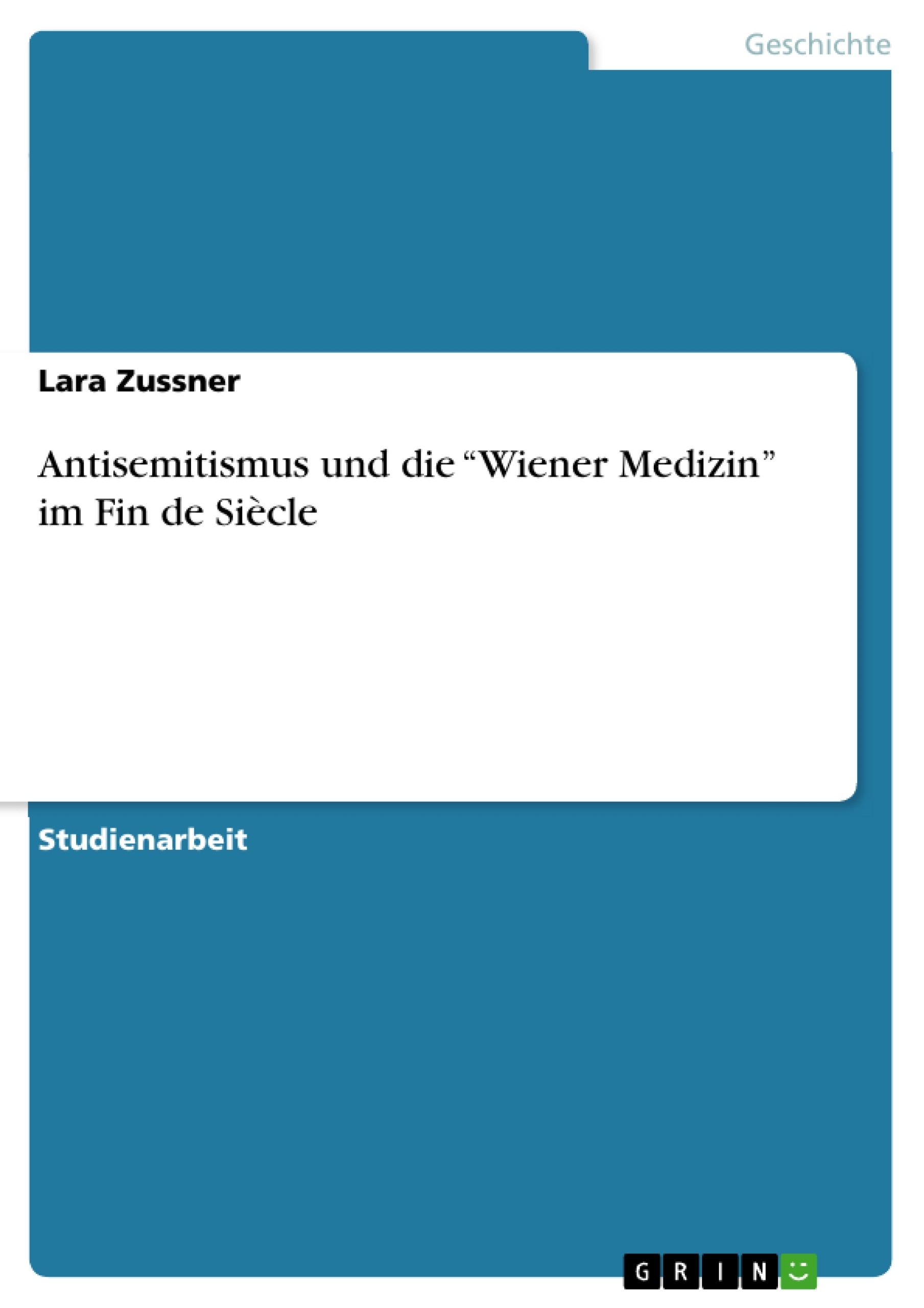Antisemitismus und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung im Habsburgerreich zur Zeit des Fin de Siècle manifestiert sich durch konfessionell, rassisch-biologisch und nationalistisch bedingte Aversion. Jede Art von Integration und Assimilation von Juden wurde im Fin de Siècle ausgeschlossen, da die biologische, geistige und moralische Überlegenheit von Nichtjuden im Vordergrund stand. Des Weiteren wurde die Diskriminierung aufgrund vermeintlich pathologischer Andersartigkeit der Juden, mit verstärkter Disposition zu Krankheiten, begründet. Dies wird in der folgenden Arbeit anhand der Zweiten Wiener Medizinischen Schule und dessen berühmte Vertretern erläutert und es wird des Weiteren auf das krankheitsbedingte Feindbild gegen Juden eingegangen. In diesem Hinblick wird auf die Krankheitsbilder der Syphilis, Cholera, Pest und der Hysterie eingegangen. Die Feindseligkeit gegenüber der jüdischen Bevölkerung zeigte sich nicht ausschließlich durch nationales, rassistisches oder antisemitisches Gedankengut, sondern unterlag einem Gesamtkonstrukt aus Vorurteilen und Mythen, wie beispielsweise der Ritualmordlegende. Im letzten Teil der Arbeit wird die Bedeutsamkeit des ästhetischen Ideals behandelt, welche die Stereotypisierung der körperlichen Unfähigkeit und der Schwäche der Juden, innehat.
Inhaltsverzeichnis
- ABSTRACT
- DER ANTISEMITISMUS IN DER HABSBURGERMONARCHIE
- ANTISEMITISMUS UND DIE ,,WIENER MEDIZIN“
- Die Zweite Wiener Medizinische Schule
- Antisemitismus im Gesundheitswesen
- ANTISEMITISMUS UND DIE JÜDISCHE BEVÖLKERUNG IM FIN DE SIECLE
- Das krankheitsbedingte Feindbild „Der Jude“
- Ästhetik und Verweiblichung der Juden
- RESÜMEE
- BIBLIOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Antisemitismus im Habsburgerreich zur Zeit des Fin de Siècle, mit besonderem Fokus auf die "Wiener Medizin" und die Darstellung von Juden als krankheitsanfällig. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Antisemitismus in der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung.
- Antisemitische Stereotype und Feindbilder im Habsburgerreich
- Die "Wiener Medizin" und ihre Rolle im Antisemitismus
- Krankheitsbilder und die Konstruktion des "Juden" als pathologische Andersartigkeit
- Ästhetische Stereotypisierung der jüdischen Bevölkerung
- Politische, soziale und kulturelle Auswirkungen des Antisemitismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Antisemitismus in der Habsburgermonarchie, insbesondere mit der jüdischen Migration nach Wien und der Entwicklung antisemitischer Bewegungen. Es beleuchtet die politische und soziale Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert.
Das zweite Kapitel analysiert den Antisemitismus in der "Wiener Medizin", insbesondere die Rolle der Zweiten Wiener Medizinischen Schule. Es beleuchtet die Verwendung von medizinischen Argumenten zur Diskriminierung von Juden und die Konstruktion von Krankheitsbildern, die als spezifisch jüdisch wahrgenommen wurden.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Habsburgermonarchie, Fin de Siècle, Wiener Medizin, Zweite Wiener Medizinische Schule, Krankheitsbilder, Stereotypisierung, Juden, Assimilation, Diskriminierung, Pathologisierung, Ästhetik, Verweiblichung.
Häufig gestellte Fragen
Wie manifestierte sich der Antisemitismus in der Wiener Medizin?
Durch die Diskriminierung jüdischer Bevölkerungsgruppen aufgrund vermeintlicher pathologischer Andersartigkeit und einer unterstellten höheren Disposition für Krankheiten.
Welche Rolle spielte die Zweite Wiener Medizinische Schule?
Berühmte Vertreter dieser Schule nutzten medizinische Argumente, um die biologische und moralische Überlegenheit von Nichtjuden zu behaupten und Juden auszugrenzen.
Welche Krankheiten wurden mit jüdischen Stereotypen verknüpft?
In der Arbeit werden insbesondere Syphilis, Cholera, Pest und Hysterie im Zusammenhang mit dem krankheitsbedingten Feindbild gegen Juden untersucht.
Was versteht man unter der „Verweiblichung“ der Juden im Fin de Siècle?
Es war ein antisemitisches Stereotyp, das Juden körperliche Schwäche und Unfähigkeit zuschrieb, um sie vom männlich-nationalistischen Ideal der Zeit auszuschließen.
Welche Mythen befeuerten den Antisemitismus in der Habsburgermonarchie?
Neben rassistischen Theorien spielten auch uralte Vorurteile wie die Ritualmordlegende eine zentrale Rolle im Gesamtkonstrukt der Feindseligkeit.
Wurde Integration von Juden im Fin de Siècle gefördert?
Nein, die Arbeit stellt fest, dass Integration und Assimilation oft kategorisch ausgeschlossen wurden, da die „rassisch-biologische“ Differenz als unüberbrückbar galt.
- Quote paper
- Lara Zussner (Author), 2020, Antisemitismus und die “Wiener Medizin” im Fin de Siècle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1291856