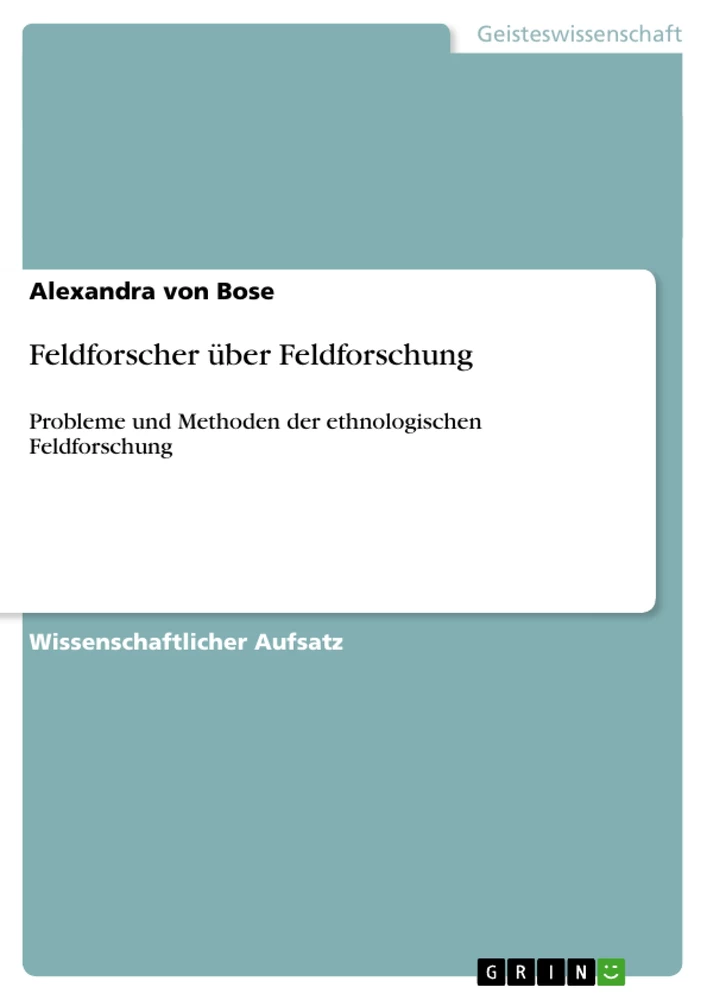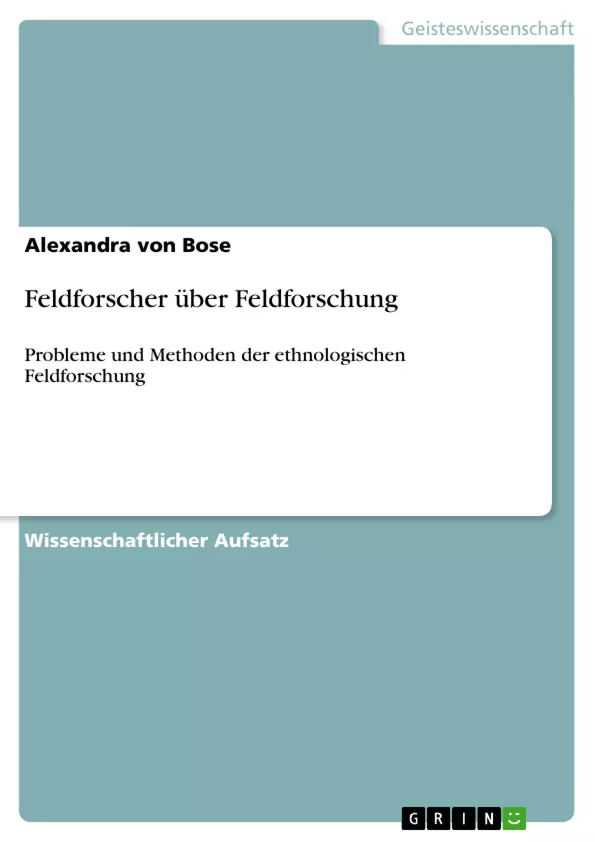Was bedeutet die Feldforschung für den Ethnologen, der nicht nur als Forscher, sondern auch als subjektiv erlebender Mensch, das "Feld" erlebt?
Was geschieht, wenn die "bunte" Schreibtischtheorie plötzlich zur problematischen, oft unverständlichen Realität wird und der Ethnologe sich überfordert fühlt? Claude Levi-Strauss sieht in der Feldforschung sogar eine Initiation, die aus dem Forscher einen neuen Menschen macht, und durch die er, auch wenn sie physisch und psychisch schmerzhaft sein kann, neue und sinnvolle Erkenntnisse über sich und die untersuchte Gesellschaft erlangt.
Bis Ende der 60er Jahre wurde aus der Feldforschung jeder subjektive und individuelle Aspekt des Ethnographen rigoros gestrichen. Man versuchte ,so einem klassischen Wissenschaftsideal gerecht zu werden, das von der Ethnologie eine exakte und rein objektive Darstellung von Daten und Eindrücken verlangte.
Die eigene Person (besonders die persönlichen Erfahrungen des Forschers, die ihm zu diesen Daten verholfen hatte) war in der klassischen ethnographischen Monographie fehl am Platz; nicht zu erschütternde Selbstgewißheit und "Resultate" sollten vermittelt werden.
Erst Ende der 60er Jahre entfachte sich eine Grundfragendiskussion in der Ethnologie,über ihren Objektivitätsbegriff. Zum Teil wurde sie ausgelöst durch den fachinternen Skandal um die Veröffentlichung der Tagebücher Malinowskis (25 Jahre nach seinem Tode). In nie dagewesener Offenheit berichtet Malinowski in seinen Tagebüchern (die nicht für eine allgemeine Leserschaft bestimmt waren) minutiös über seine persönlichen Probleme und Erfahrungen während der Feldforschung.
Durch die Krise der Ethnologie, die zum Teil bis heute andauert, wurde die Frage nach der Wirklichkeit des Ethnologen neu gestellt. Gerade in Hinblick auf diese Fragestellung bieten die persönlichen Schriften und Aufzeichnungen der Ethnologen Einblicke in die subjektiven Aspekte der Feldforschung.
Im folgenden sollen die spezifischen intellektuellen und emotionalen Konflikte einiger bekannter Ethnologen: Claude Levi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Sir Edward Evans-Pritchard, Laura Bohannan anhand ihrer zum Teil persönlichen Aufzeichnungen, die sie während der Feldforschungsphase festgehalten haben, unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Die Daten stammen aus Tagebüchern, Forschungsberichten und einem autobiographischen Roman.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Motivation zur Feldforschung
- Der Forscher als "Instrument"
- Der wissenschaftliche Anspruch
- Der Feldforscher im zwischenmenschlichen Spannungsfeld
- Identität und Rollenerwartung
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Feldforschung in der Ethnologie und untersucht die subjektiven Erfahrungen und Herausforderungen, denen Ethnologen während ihrer Feldforschung begegnen. Sie analysiert die Motivationen, die Ethnologen zur Feldforschung antreiben, und beleuchtet die Rolle des Forschers als "Instrument" im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Anspruch und zwischenmenschlichen Beziehungen. Darüber hinaus werden die Themen Identität und Rollenerwartung im Kontext der Feldforschung betrachtet.
- Motivationen zur Feldforschung
- Der Forscher als "Instrument" und seine Rolle im Feld
- Die subjektiven Erfahrungen des Forschers
- Identität und Rollenerwartung in der Feldforschung
- Die Herausforderungen der Feldforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Feldforschung in der Ethnologie ein und stellt die Frage nach der Bedeutung der Feldforschung für den Ethnologen als subjektiv erlebenden Menschen. Sie beleuchtet die Entwicklung des Objektivitätsbegriffs in der Ethnologie und die Bedeutung der persönlichen Schriften und Aufzeichnungen von Ethnologen für das Verständnis der subjektiven Aspekte der Feldforschung.
Das Kapitel "Die Motivation zur Feldforschung" untersucht die bewussten und unbewussten Beweggründe, die Ethnologen zur Feldforschung antreiben. Es analysiert die Rolle der Flucht aus der eigenen Kultur oder der Zuflucht in eine fremde Kultur als treibende Kraft und beleuchtet die Motivationen von Claude Levi-Strauss und Bronislaw Malinowski anhand ihrer persönlichen Aufzeichnungen.
Das Kapitel "Der Forscher als "Instrument"" befasst sich mit der Rolle des Forschers als "Instrument" im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Anspruch und zwischenmenschlichen Beziehungen. Es analysiert den wissenschaftlichen Anspruch der Feldforschung und die Herausforderungen, die sich aus den zwischenmenschlichen Beziehungen im Feld ergeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Feldforschung, Ethnologie, subjektive Erfahrungen, Motivationen, wissenschaftlicher Anspruch, zwischenmenschliche Beziehungen, Identität, Rollenerwartung, Ethnologen, Claude Levi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Sir Edward Evans-Pritchard, Laura Bohannan.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Feldforschung für den Ethnologen als Mensch?
Sie wird oft als „Initiation“ erlebt, die den Forscher physisch und psychisch fordert und ihn als Person nachhaltig verändert.
Wie änderte sich der Objektivitätsbegriff in der Ethnologie?
Bis Ende der 60er Jahre wurde Subjektivität ignoriert; erst durch die Veröffentlichung von Malinowskis Tagebüchern begann eine Debatte über die Rolle des Forschers.
Welche Ethnologen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Aufzeichnungen von Claude Lévi-Strauss, Bronislaw Malinowski, Edward Evans-Pritchard und Laura Bohannan.
Was ist der „Forscher als Instrument“?
Dieses Konzept beschreibt, dass der Ethnologe selbst das wichtigste Werkzeug der Datenerhebung ist, was zu emotionalen und intellektuellen Konflikten führen kann.
Welche Motivationen treiben Ethnologen in die Feldforschung?
Oft ist es eine Mischung aus wissenschaftlichem Drang und einer Flucht aus der eigenen Kultur oder der Suche nach Identität in der Fremde.
- Quote paper
- Alexandra von Bose (Author), 1990, Feldforscher über Feldforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129211