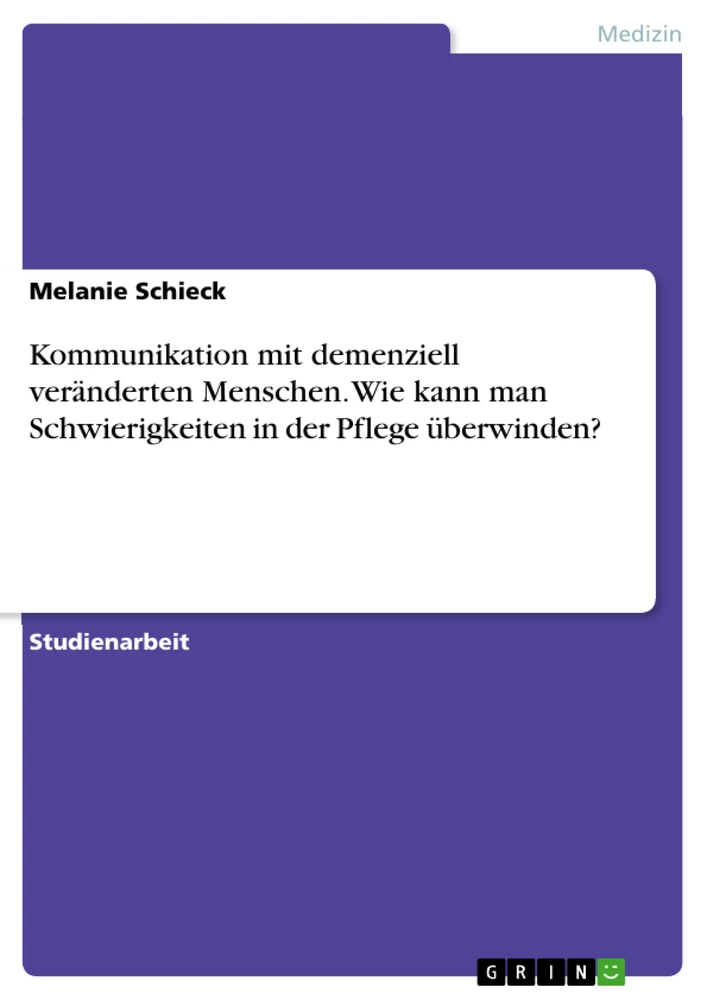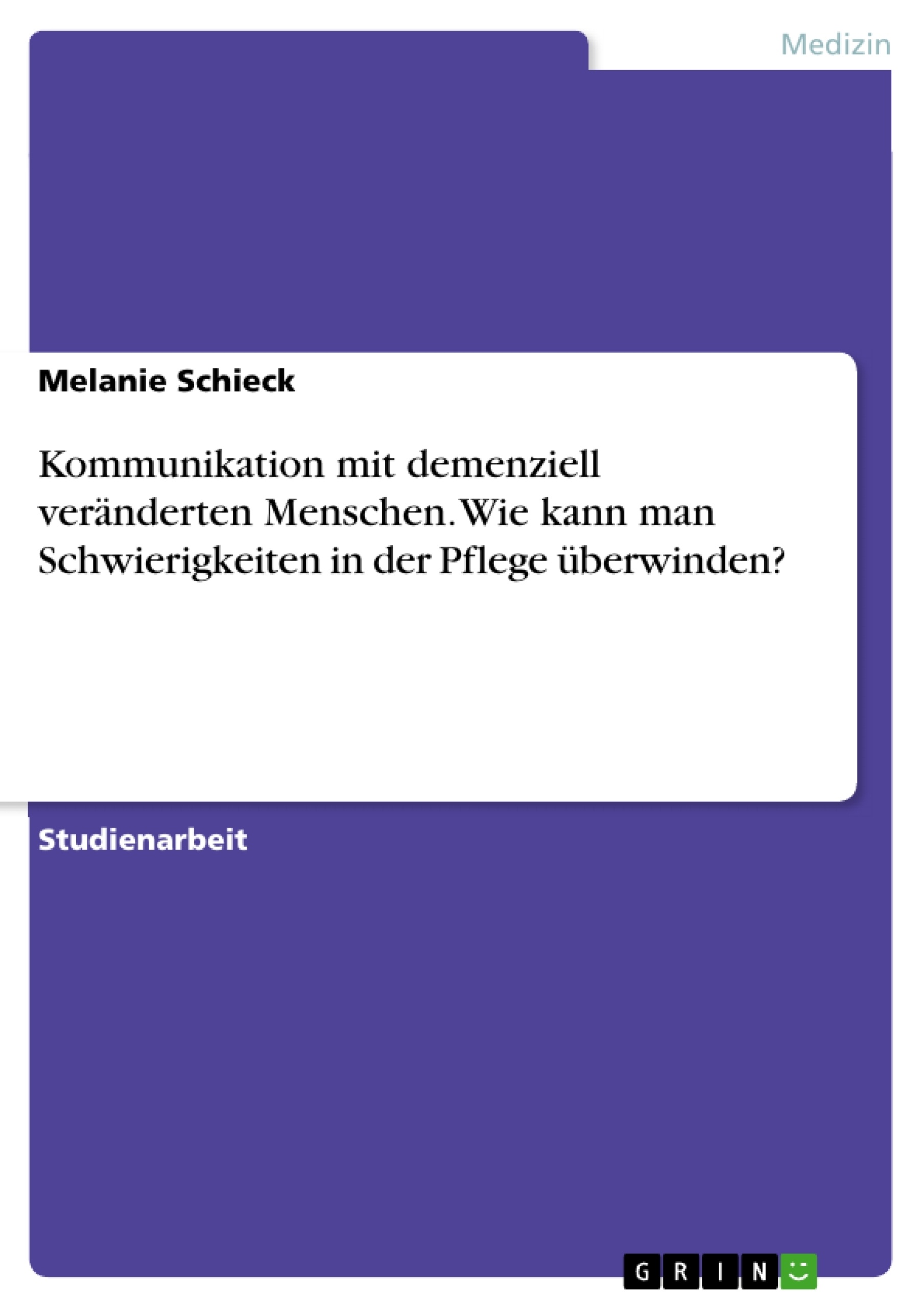Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie es zu Schwierigkeiten in der Kommunikation mit dementen Menschen kommt und welche Lösungsmöglichkeiten und Auswege es für die pflegerische Interaktion gibt. Vorgestellt werden außerdem zwei konkrete Modelle, die bei der Bewältigung von Kommunikationsproblemen mit Menschen, die an Demenz leiden, helfen.
Zweifelsohne nimmt die Anzahl der an Demenz erkrankten Patienten und Patientinnen in der Pflege aufgrund des demografischen Wandels stetig zu. Die medizinische Versorgung schreitet immer weiter voran und die Menschen werden immer älter. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft veröffentlichte 2012 alarmierende Zahlen: Es leben 1,4 Millionen Demenzkranke in Deutschland und diese Zahl wird bis zum Jahre 2050 auf bis zu 3 Millionen steigen. Die Kommunikation mit diesen Patienten/-innen ist eine große Herausforderung für die Pflegekräfte, da mit Fortschreiten der Erkrankung die kommunikativen Fähigkeiten immer mehr nachlassen. Hauptaufgabe des Pflegepersonals besteht darin, das psychische Befinden der Betroffenen herauszufinden und Verständnis zu entwickeln für das veränderte Erleben eines dementen Menschen. Ein positiver Kommunikationsverlauf ist von großer Bedeutung für den Pflegeprozess, da Stress, Missverständnisse und unangebrachte Pflege zu Isolierung der betroffenen Patienten/-innen führt und so das Vertrauensverhältnis zwischen Patient/-in und Krankenpfleger/-in negativ beeinflusst.
Auch für die Pflegekräfte werden die Kommunikationsprobleme mit dementiell erkrankten Menschen in der täglichen Arbeit schnell zum Frust. So kostet es viele Nerven, immer wieder die gleiche Frage zu beantworten oder dass auf gesprochene Sätze nicht adäquat reagiert wird. Daher soll diese Arbeit einen Einblick in verschiedene kommunikative Modelle für den Umgang mit Demenzkranke bieten, um mit diesen Problemen professionell umgehen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Demenz
- Was bedeutet „Demenz“?
- Die verschiedenen Formen der Demenz
- Die Alzheimer-Demenz
- Die Vaskuläre Demenz
- Die gemischte Demenz
- Andere Demenz-Arten
- Kommunikationsprobleme mit dementen Menschen
- Allgemeine Regeln zur Verbesserung des Gesprächsverlaufs
- Die Bedeutung der Biografiearbeit
- Was ist bei Biografiearbeit im Gespräch zu beachten?
- Kommunikationsmodelle
- Das ABC-Modell
- Die validierende Kommunikation nach Feil
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Herausforderungen in der Kommunikation mit dementiell erkrankten Menschen im Pflegebereich. Die Autorin, selbst als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig, analysiert die Problematik und zeigt Lösungsansätze aus der Pflegeforschung auf.
- Definition und verschiedene Formen der Demenz
- Ursachen für Kommunikationsschwierigkeiten mit dementen Menschen
- Verbesserung des Gesprächsverlaufs durch allgemeine Regeln
- Bedeutung der Biografiearbeit in der Kommunikation
- Kommunikationsmodelle für den Umgang mit Demenzkranken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Demenz“ und erläutert die verschiedenen Formen der Erkrankung. Anschließend werden die Ursachen für Kommunikationsschwierigkeiten im Detail analysiert, um ein besseres Verständnis für die Betroffenen zu schaffen. Die Autorin präsentiert allgemeine Regeln zur Verbesserung des Gesprächsverlaufs und betont die Bedeutung der Biografiearbeit im Umgang mit dementen Menschen. Schließlich werden zwei konkrete Kommunikationsmodelle – das ABC-Modell und die validierende Kommunikation nach Feil – vorgestellt, die bei der Bewältigung von Kommunikationsproblemen helfen können.
Schlüsselwörter
Demenz, Kommunikation, Pflege, Biografiearbeit, validierende Kommunikation, ABC-Modell, Alzheimer-Demenz, Vaskuläre Demenz, gemischte Demenz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kommunikation mit Demenzkranken so schwierig?
Mit fortschreitender Erkrankung lassen die kommunikativen Fähigkeiten nach, was oft zu Missverständnissen, Stress und Isolation führt.
Was ist die validierende Kommunikation nach Feil?
Es ist ein Modell, bei dem die Gefühle und die innere Erlebniswelt des Dementen akzeptiert und bestätigt werden, anstatt ihn korrigieren zu wollen.
Welche Rolle spielt die Biografiearbeit?
Kenntnisse über das frühere Leben des Patienten helfen dabei, sein aktuelles Verhalten besser zu verstehen und Anknüpfungspunkte für Gespräche zu finden.
Was ist das ABC-Modell in der Pflege?
Das ABC-Modell ist ein konkretes Kommunikationswerkzeug, das Pflegekräften hilft, professionell auf herausforderndes Verhalten zu reagieren.
Wie viele Menschen sind in Deutschland von Demenz betroffen?
Im Jahr 2012 waren es 1,4 Millionen; Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl bis 2050 auf 3 Millionen ansteigen wird.
- Citar trabajo
- Melanie Schieck (Autor), 2015, Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen. Wie kann man Schwierigkeiten in der Pflege überwinden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1292474