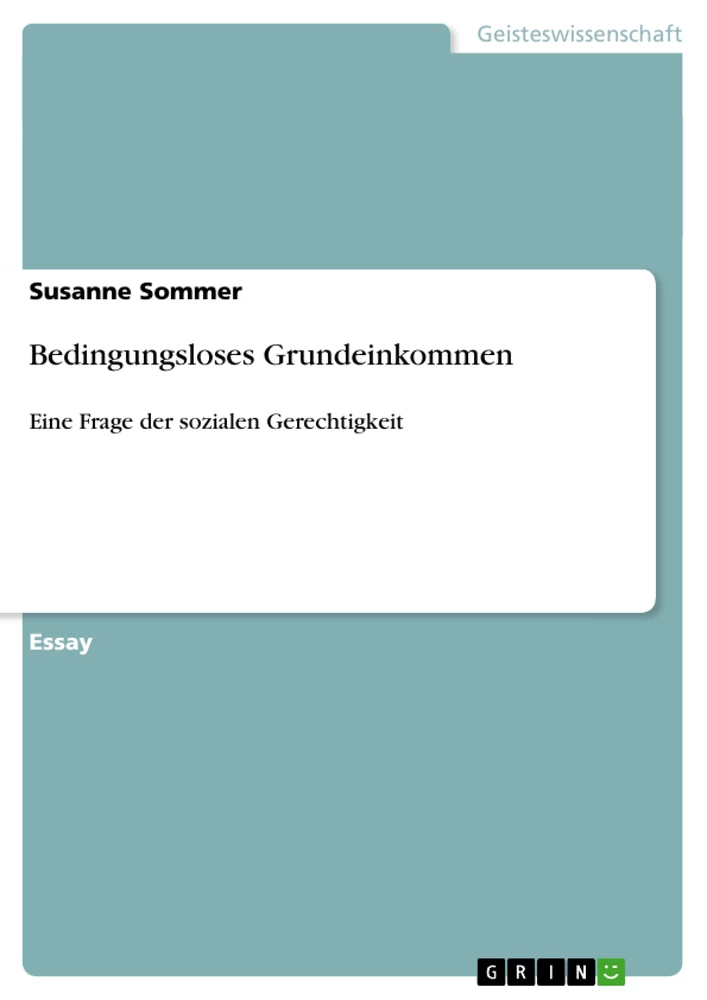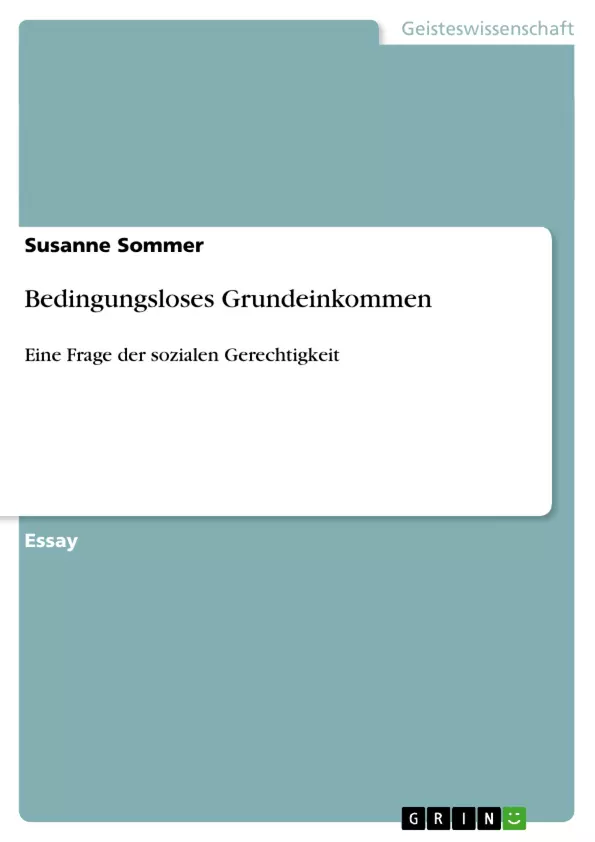In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion werden mehrere Modelle von Grundsicherung, Bürgergeld, Grundeinkommen, negative Einkommenssteuer diskutiert, wobei zentrale begriffliche Differenzen nicht immer deutlich werden. Generell handelt es sich um Finanztransfers für jene Bürger, die ihren Lebensunterhalt nicht mittels der eigenen Arbeitskraft bestreiten können.
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert.
Inhalt
1. Bedingungsloses Grundeinkommen
1.1 Begriffliche Abgrenzungen
1.2 Das HWWI-Modell des bedingungslosen Grundeinkommens
2. Bedingungsloses Grundeinkommen – bürgerlicher Sozialismus?
Literaturverzeichnis
1. Bedingungsloses Grundeinkommen
1.1 Begriffliche Abgrenzungen
In der politischen und wissenschaftlichen Diskussion werden mehrere Modelle von Grundsicherung, Bürgergeld, Grundeinkommen, negative Einkommenssteuer diskutiert, wobei zentrale begriffliche Differenzen nicht immer deutlich werden. Generell handelt es sich um Finanztransfers für jene Bürger, die ihren Lebensunterhalt nicht mittels der eigenen Arbeitskraft bestreiten können. Sie sind von Vorleistungen unabhängig, steuerfinanziert, teilweise pauschalisiert, d. h. nicht am tatsächlichen Bedarf orientiert, wenngleich die individuelle Bedürftigkeit festgestellt werden muss und dauerhaft überprüft wird[1]. Genau im letzten Punkt liegen die entscheidenden Differenzen zu den Konzepten des bedingungslosen Grundeinkommens. In folgender Aufzählung sind diese wichtigsten Punkte aufgeführt[2].
- keine Bedarfsabhängigkeit, also auch keine Bedürftigkeitsprüfung (einkommens- und lebenslagenunabhängig),
- keine Arbeitsverpflichtung, kein Arbeitszwang ("starke" Form der Entkoppelung von Lohn-/Erwerbs-Arbeit),
- Individualbezug statt Haushalt-/Familienbezug der Leistung (individueller Anspruch)
- alle Bürger sind anspruchsberechtigt
Wie zu sehen ist, stellt eine solche Konzeption des Grundeinkommens im Vergleich zur jetzigen Grundsicherung über Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einen Paradigmenwechsel an der Sozialpolitik und Armutsprävention dar. Denn unabhängig von Vorleistungen, von der konkreten Lebens- und Bedürfnislage und auch unabhängig von Gegenleistungen des Bezugsberechtigten wird hier jedem Bürger des Landes eine finanzielle Grundsicherung seines Lebensstandards gewährt. Es handelt sich um die radikale Entkopplung der Lebensunterhaltssicherung von der Erwerbsarbeit bzw. dem Arbeitszwang, da die Zahlung nicht mehr an die Verfügbarkeit des Einzelnen für den Arbeitsmarkt gekoppelt ist. Das aktuelle Sozialversicherungssystem ist aus dem 19. Jahrhundert überkommen und in den 1950er und 1960er Jahren überarbeitet und ausgeweitet worden. Es beruht auf den Annahmen einer größeren Zahl an Erwerbstätigen als Leistungsempfängern (mehr Junge als Alte), einer wachsenden Wirtschaft und einer lebenslangen, sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit des Einzelnen, um die Lebensrisiken tatsächlich abzusichern[3]. Argumente für den sozialpolitischen Paradigmenwechsel berufen sich darauf, dass diese Vorbedingungen heute nicht mehr gegeben sind, das klassische Modell des deutschen Sozialstaats also nicht mehr funktioniert. Folgende Aufzählung gibt die wichtigsten Punkte dafür wieder[4]:
- demographische Veränderungen drehen das Verhältnis von Anspruchsberechtigten und Einzahlern in die Sozialversicherungen um, so dass die Finanzierungsbasis schmaler wird
- von stabilem wirtschaftlichem Wachstum über längere Zeiträume kann längst nicht mehr ausgegangen werden.
- Lebens- und Erwerbsverläufe sind heute so vielgestaltig und diskontinuierlich, dass ein Sozialversicherungssystem, welches einer konkreten Normalbiographie komplementär ist, davon abweichende Lebensverläufe und Notlagen nicht adäquat erfassen und beheben kann.
Fazit: „Je stärker sich die in der Vergangenheit gesetzten Fundamente von den gegenwärtigen und künftigen Realitäten entfernen, desto stärker verliert das soziale Sicherungssystem seine Verankerung und desto schwerwiegender gerät seine Finanzierung aus den Fugen.“[5] Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine mögliche Antwort auf die Krise des deutschen Wohlfahrtsstaates und die Herausforderungen der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung[6].
1.2 Das HWWI-Modell des bedingungslosen Grundeinkommens
Es gibt eine Vielzahl von Modellen und Vorstellungen in der wissenschaftlichen Literatur und in den politischen Programmen. Bei letzteren sind die nicht einmal mehr auf die linken Parteien beschränkt, sondern finden im gesamten Parteienspektrum Anklang, wobei die Unterschiede dabei aber im Detail und ihren Auswirkungen bedeutsam sind. Im Folgenden möchte ich eines dieser Modelle kurz näher vorstellen. Es handelt sich dabei um das Modell des Hamburger WeltWirtschaftsInstituts (HWWI-Modell)[7]. Es weist folgende Merkmale auf:
- Alle Staatsangehörige erhalten unabhängig vom Alter lebenslang eine Transferzahlung in der Höhe des soziokulturellen Existenzminimums
- Anspruchsberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger sowie Ausländer mit legaler Aufenthaltsdauer.
- Finanzierung über direkte und indirekte Steuern (Einkommens- und Konsumsteuer)
- Grundeinkommen ist steuerfrei, alles weitere Einkommen wird mit einheitlichem Steuersatz besteuert, es gibt keine weiteren Steuerfreibeträge
- Grundeinkommen ersetzt nahezu alle anderen steuer- und abgabefinanzierten Sozialleistungen (Leistungen der Sozialversicherungen, Kindergeld, Wohngeld, Arbeitslosengeld I + II)
- Es entfallen die direkten Lohnnebenkosten (Beiträge für die Sozialversicherungen)
- Versicherungspflicht für Kranken- und Unfallversicherung, Beitrag ist im Grundeinkommen enthalten bzw. hinzuzufügen.
Als Kernpunkt des Konzeptes des bedingungslosen Grundeinkommens möchte ich die Entkopplung von Arbeit und Lebensunterhalt ansehen. Mit der Sozialhilfe wie den Leistungen der Sozialversicherungen gab es dies und mit dem Arbeitslosengeld I + II gibt es dies heute bereits, allerdings in enger Abhängigkeit von der Erwerbsarbeit. Zum einen wurden und werden diese Leistungen zum Teil über die Sozialversicherungsbeiträge abhängig Beschäftigter finanziert; zum anderen beruht die Anspruchsberechtigung auf konkreten Erwerbs- oder Beitragszeiten bzw. auf der prinzipiellen Verfügbarkeit der Bedürftigen für den Arbeitsmarkt. Die Höhe des gewährten Grundeinkommens differiert zwischen den verschiedenen Ansätzen, dementsprechend unterschiedlich sind auch die zu erwartenden Auswirkungen. Im Modell des thüringischen Ministerpräsidenten Althaus schwanken die Zahlungen des „solidarischen Bürgergeldes“ zwischen 400-600 Euro (plus 200 Euro für Krankenversicherung)[8]. Dabei handelt es sich aber eher um ein Kombilohn-Modell, denn im auch im Falle der Arbeitslosigkeit würde der Einzelne nicht mehr bekommen, die Höhe des Bürgergeldes liegt damit „deutlich unter der von der EU festgelegten Armutsgrenze.“[9] Mit dem Anspruch das „soziokulturelle Existenzminimum“ zu sichern, wird die Befreiung von existentieller Not, d. h. grundlegender Armutsbekämpfung und ein Leben in Würde und Freiheit in Aussicht gestellt[10]. Was nach Sozialismus klingt, hätte tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensführung und die Sozialstruktur unserer Gesellschaft, die in ihrer Gesamtheit hier nicht diskutiert werden können. Ich möchte das bedingungslose Grundeinkommen unter dem Kriterium der sozialen Gerechtigkeit und Gleichheit beurteilen.
[...]
[1] Blaschke (2005): 10
[2] Blaschke (2005): 11
[3] Hohenleitner/Straubhaar (2007a): 7
[4] Kipping (2005): 521ff.
[5] Hohenleitner/Straubhaar (2007a): 7
[6] Liebermann (2005): 525f.
[7] Hohenleitner/Straubhaar (2007b): 13
[8] Opielka (2007): 9
[9] Butterwegge (2007): 26
[10] Kipping (2005): 521, Hohenleitner/Straubhaar (2007b), Opielka (2007): 9
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet das bedingungslose Grundeinkommen von der aktuellen Grundsicherung?
Ein bedingungsloses Grundeinkommen erfordert keine Bedürftigkeitsprüfung, keinen Arbeitszwang und wird individuell statt pro Haushalt ausgezahlt.
Was sind die Kernmerkmale des HWWI-Modells?
Es sieht eine lebenslange Transferzahlung in Höhe des Existenzminimums vor, finanziert durch Einkommens- und Konsumsteuern, und ersetzt fast alle anderen Sozialleistungen.
Warum wird über ein Grundeinkommen diskutiert?
Gründe sind der demographische Wandel, instabiles Wirtschaftswachstum und diskontinuierliche Erwerbsverläufe, die das klassische Sozialversicherungssystem unter Druck setzen.
Was bedeutet die „Entkopplung von Arbeit und Lebensunterhalt“?
Es bedeutet, dass die finanzielle Absicherung des Einzelnen nicht mehr an die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt oder an vorherige Erwerbsarbeit gebunden ist.
Wie wird das Grundeinkommen im HWWI-Modell finanziert?
Die Finanzierung erfolgt über direkte und indirekte Steuern, wobei das Grundeinkommen steuerfrei bleibt und alle weiteren Einkommen einheitlich besteuert werden.
Was ist das „solidarische Bürgergeld“ nach Althaus?
Ein Modell mit Zahlungen zwischen 400-600 Euro, das jedoch kritisiert wird, da es deutlich unter der Armutsgrenze liegt und eher einem Kombilohn-Modell ähnelt.
- Arbeit zitieren
- Susanne Sommer (Autor:in), 2008, Bedingungsloses Grundeinkommen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129265